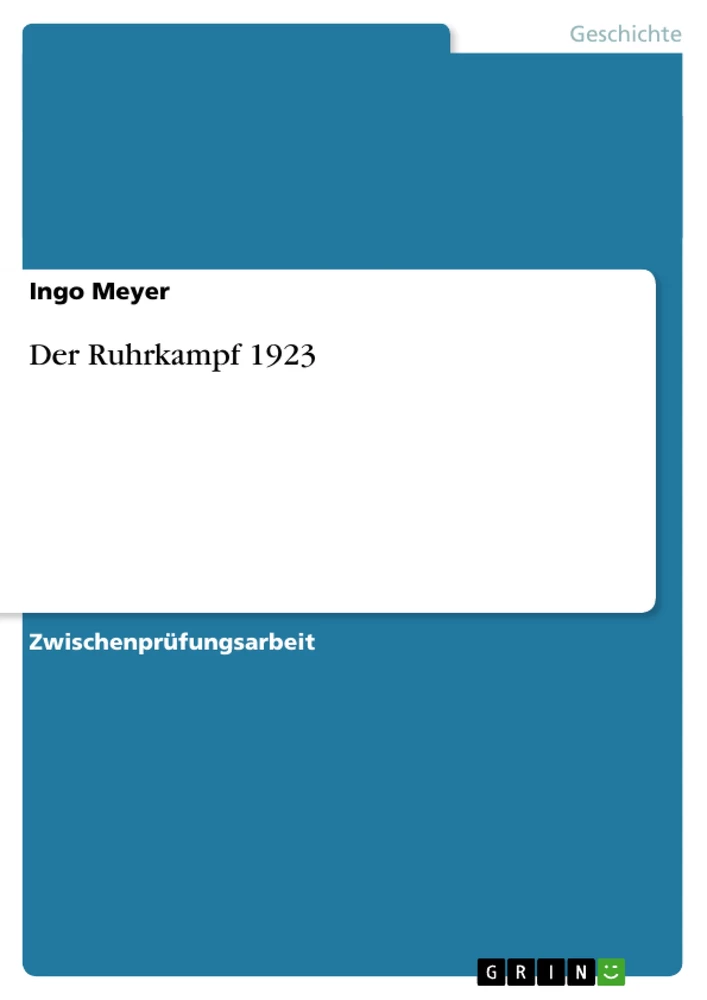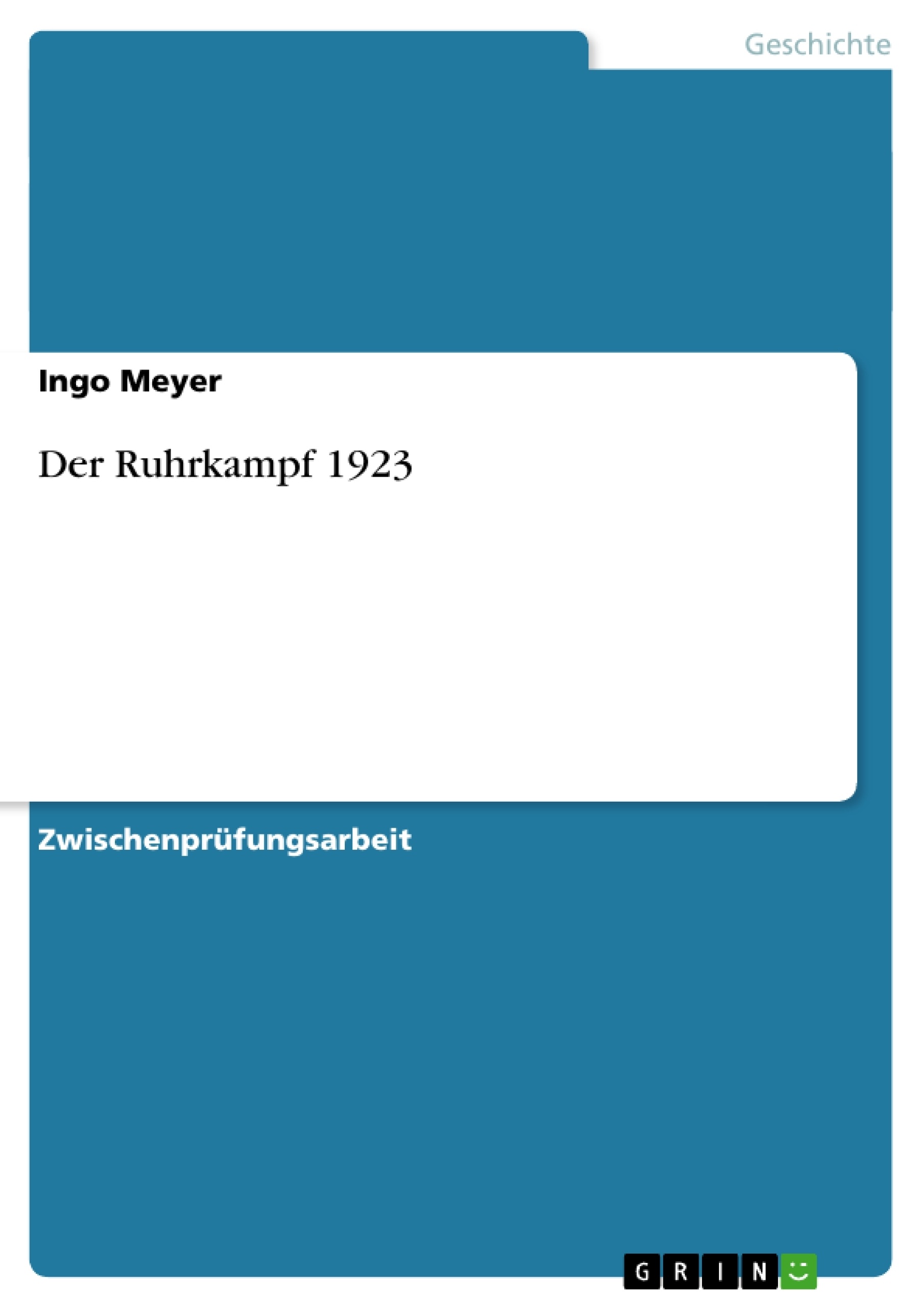Autor: Ingo Meyer
Der Ruhrkampf 1923
Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für die Sekundarstufe I, dem Staatlichen Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen in Essen vorgelegt von:
Ingo Meyer
Wuppertal, 8.4.1998
BUGH Wuppertal, Historisches Seminar
1. Einleitung
In der Geschichtswissenschaft ist das Thema Weimar beinahe unweigerlich mit der Frage verknüpft, wie es zu der Katastrophe, dem ,,Dritten Reich", kommen konnte; d.h., Weimar dient oftmals nur als Modell zur Erklärung seines eigenen Scheiterns und seines schlimmen Erbes. Nicht selten wird hierbei der Schwerpunkt der Betrachtungen auf die Endphase der Republik gesetzt, wodurch die Bedeutung langfristiger Entwicklungen in den Hintergrund gerückt wird.
Doch gerade eben jene Entwicklungen und gewachsenen Strukturen sind von großer Bedeutung für die Interpretation einzelner Ereignisse. Im Vordergrund steht hier die Mentalität des deutschen Volkes, die sich sowohl aus der preußisch-deutschen Geschichte, als auch aus den Entstehungsbedingungen Weimars ableiten läßt.
Als einer der wichtigsten Brennpunkte sei hier das deutsch-französische Verhältnis genannt, dessen Geschichte nicht zum letzten Mal im Versailler Vertrag Ausdruck finden sollte. Mentalitätsgeschichtlich bedeutsam ist der Umstand, daß der deutsche Nationalstaat zu Beginn der Weimarer Republik kaum ein halbes Jahrhundert alt war und die monarchistische Gesinnung noch tief in den Köpfen steckte.
Weimar ist also nicht nur die Vorgeschichte des ,,Dritten Reiches", sondern ebenso auch die Nachgeschichte des Kaiserreiches; eine nur oberflächlich betrachtet banale Feststellung. Da jedes Ereignis Resultat und Ursache weiterer Ereignisse ist, darf in der ersten deutschen Republik nicht nur der Keim des Nationalsozialismus gesucht werden, es müssen ebenso die Schwierigkeiten berücksichtigt werden, die die junge Republik vom Kaiserreich geerbt hatte. Neben dem monarchistischen Patriotismus, der schließlich nicht binnen kürzester Zeit durch etwas Neues, schon gar nicht durch einen demokratischen Geist, ersetzt werden konnte, blieb natürlich auch die geopolitische Mittellage zwischen Rußland und den Westmächten bestehen; eine für Deutschland zugleich bedrohliche und begünstigende Position.
Schon das erstarkende Preußen stand vor dem Zwiespalt, einerseits für jeden seiner Nachbarn eine Bedrohung darzustellen und andererseits von jedem als intakter Puffer benötigt zu werden. Bereits Napoleon wußte diese Funktion gegenüber Rußland zu schätzen, hier war Preußens Mittellage der Garant seines Fortbestandes.
Diese besondere geopolitische Position sollte u.a. auch Weimars größtes Pfand darstellen, auch die Überwindung des Ruhrkampfes, das Thema dieser Arbeit, läßt sich nicht ohne sie erklären.
2. Der Weg zum Waffenstillstand
Das Jahr 1917 markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der deutschen Geschichte.
Angesichts der immer deutlicher werdenden Krisenlage des deutschen Heeres und der wachsenden Gewißheit einer unabwendbaren Niederlage besannen sich selbst so überzeugte Annexionisten wie der Zentrums-Abgeordnete Matthias Erzberger und der nationalliberale Gustav Stresemann eines neuen Weges: Nicht mehr ein Siegfrieden konnte und sollte das Ziel sein, sondern ein Verständigungsfriede mußte her, eine realistische Einschätzung der Situation und der Wunsch nach Schadensbegrenzung waren hier die Väter dieses Gedankens. Ein interfraktioneller Ausschuß, bestehend aus MSPD, Zentrum, FVP und DVP, wurde am 6.7.1917 einberufen, um die gemeinsamen Ziele Verständigungsfrieden und Verfassungsreformen auszuarbeiten. Ein mutiger Schritt, war es doch das erste Mal, daß sich in Deutschland parlamentarische Kräfte dazu durchrangen, eigenverantwortlich zu handeln. Daß dieser Verständigungsfriede nicht zustande kam, lag einerseits an der Handlungsunfähigkeit des Ausschusses -man verzettelte sich in langen Diskussionen um ,,[...]zweitrangige(n) taktische(n) Differenzen[...]"1 - und andererseits an der Leitung der OHL, Ludendorff und Hindenburg, beide entschiedene Gegner eines Verständigungsfriedens, wobei die Unbeweglichkeit des Ausschusses die Durchsetzung der Interessen der OHL noch begünstigte, sie hatte nicht nur die militärische, sondern de facto auch die politische Führung inne.
So kam es zur Märzoffensive von 1918, die mit ihrem verheerendem Ausgang für das deutsche Militär die letzte Tür zum Verständigungsfrieden hinter sich schloß. Die deutschen Truppen wurden durch die alliierte Gegenoffensive im Juli/August 1918, speziell durch den Tankangriff von Amiens am 8.8.1918 (der laut Ludendorff ,,schwarze Tag" des deutschen Heeres), in die sogenannte ,,Siegfriedstellung" zurückgedrängt, so daß die OHL am 14.8.1918 auf der Konferenz im Hauptquartier von Spa die Fortführung des Krieges für aussichtslos erklärte.
Die deutsche Öffentlichkeit erfuhr von alledem nichts. Sie wurde weiterhin über Erfolge des deutschen Heeres informiert; die Propaganda konnte funktionieren, da die Fronten außerhalb Deutschlands lagen und nach bisheriger Kriegserfahrung ein Krieg erst dann verloren war, wenn der Feind ins eigene Landesinnere eingedrungen war und das eigene Militär besiegt hatte. Die Meldungen über Gebietsgewinne entsprachen zu Beginn der Offensive auch der Wahrheit; der Betrug bestand darin, das deutsche Volk im Glauben an die Motivation und Kraft des Heeres zu lassen, obwohl das Militär am Ende seiner Möglichkeiten war.
Selbst nach der gescheiterten Offensive stemmte sich Ludendorff, der wußte, daß Deutschland seine letzte Karte verspielt hatte, zunächst gegen die Information der Öffentlichkeit über den Ernst der Lage, ja sogar gegen militärische Konsequenzen: ,,Ludendorff war der Überzeugung, daß jede Zurücknahme der Fronten und auch das Eingeständnis des Ernstes der Kriegslage vor der Öffentlichkeit einen Prestigeverlust bedeute und die eigene Position schwäche."2
Erst als der Verbündete Österreich am 14.September eigenmächtig Friedensverhandlungen anbot, gewannen Ludendorff und Hindenburg endgültig die Einsicht, daß die Niederlage nicht mehr abwendbar war.3
Ludendorff versuchte nun mittels Rückgriffes auf Wilsons 14 Punkte vom 8. Januar 1918 einen Waffenstillstand herbeizuführen, der für Deutschland moderater ausgefallen wäre, als derjenige, der von Frankreich oder England zu erwarten war.
Er wußte, an welche Vorbedingung Wilson seine 14 Punkte geknüpft hatte: Ein dauerhafter Friede konnte nur zwischen Staaten geschaffen werden, deren Regierungen Volksvertretungen waren.
Ludendorff forderte also folgerichtig eine parlamentarische Regierungsform, sowie die Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahlrechtes. Mit Prinz Max von Baden trat nun ein Anhänger des Versöhnungsfriedens sein Amt als Reichskanzler an, und erst jetzt wurde die neue Regierung über die militärische Lage informiert.
Es ging ein Aufschrei der Ohnmacht und der Empörung durch die Reihen der Parlamentarier, man erkannte, daß man einer von der OHL verbreiteten Illusion aufgesessen war.
Die Geburtsstunde der ersten deutschen Demokratie stand unter einem ungünstigen Stern: Die erste parlamentarische Volksvertretung auf deutschem Boden hatte die undankbare Aufgabe eines Konkursverwalters. Es war ihre Pflicht, der deutschen Öffentlichkeit den Ernst der Lage zu verdeutlichen, da sich die Leitung des Militärs ihrer Verantwortung zu entziehen versuchte.
Die ganze Nation setzte jetzt zuversichtlich auf einen ,,Wilson-Frieden" und man beeilte sich, die bekannten Vorbedingungen zu schaffen, d.h., man bemühte sich, ein Zeichen im demokratisch-republikanischen Sinne zu setzen, um ein wohlwollendes Einlenken der USA zu erzielen.
So wurde die neue Regierungsform in der ,,Oktoberverfassung" vom 28.10.1918 manifestiert, kurz nachdem mit Wilhelm Groener ein Demokrat an die Spitze der OHL getreten war. Der Kaiser hatte General Ludendorff nach dessen erneutem Kampfaufruf entlassen, am 9. November legte er selbst die Krone nieder, er wäre der Glaubwürdigkeit der parlamentarischen Absichten abträglich gewesen.
Am 11.November unterschrieb Matthias Erzberger im Wald von Compiègne einen Waffenstillstandsvertrag, der für Deutschland so niederschmetternd war, daß Hitler denselben Ort 22 Jahre später zur Revanche mißbrauchte.
Die neue Regierung war sich der Sündenbockrolle, die ihr in weiten Teilen der Bevölkerung zugeschrieben wurde, bewußt. Das parlamentarische System konnte nur dann auf sicheren Fortbestand hoffen, wenn es der Bevölkerung einen akzeptablen Frieden bereiten würde. Der Waffenstillstand von Compiègne war ein Tiefschlag für die hoffnungsvollen Erwartungen auf einen Wilson-Frieden, doch man gab die Hoffnung noch nicht auf, zumal aus einer Note des amerikanischen Staatssekretärs Lansing die Bereitschaft der Alliierten hervorging, wenn auch mit Einschränkungen, Wilsons vierzehn Punkte als Grundlage eines Friedensvertrages zu akzeptieren.
Auf der anderen Seite standen die Forderungen Poincarés und Clemenceaus nach einem harten Friedensschluß, der Deutschland um die Substanz seiner wirtschaftlichen Existenz bringen sollte, mehr noch, man verlangte den Ausschluß aus dem Völkerbund, Deutschland sollte eine Erniedrigung erfahren.
Daher setzte man von deutscher Seite aus alles auf die Vermittlung der USA und hoffte, mittels ,,guter Führung" ihre Unterstützung gegen Frankreichs Forderungen zu erlangen.4
Völlig übersehen oder sogar verdrängt wurde aber der Umstand, daß Wilsons vierzehn Punkte für einen Verständigungsfrieden zu einem Zeitpunkt präsentiert wurden, als Deutschland noch nicht besiegt war.
Die Märzoffensive hatte diesen Rückweg verschlossen, man stand nun als Verlierer da und dennoch bewahrte man sich bis zum 7.Mai 1919, der Übergabe des Friedensvertragsentwurfs, einen Rest Hoffnung.
3. Der Versailler Vertrag
Während in Weimar die Nationalversammlung tagte, um eine Verfassung zu erarbeiten, hatten sich in Paris die Siegermächte versammelt, um einen Friedensvertrag zu schaffen, der eine neue Ordnung in Europa und Übersee herstellen sollte.
Nach der Unterschrift unter das Waffenstillstandsabkommen mußte das aus der Niederlage geborene Deutschland tagtäglich das Schicksal des Besiegten erdulden. Die alliierten Truppen folgten den sich zurückziehenden deutschen bis zum Rhein, das linke Rheinufer wurde besetzt. Zur Friedenskonferenz wurde keine deutsche Delegation eingeladen. Am 7.Mai 1919 wurden der deutschen Friedensdelegation, die vor verschlossenen Türen hatte warten müssen, die ,,Friedensbedingungen der alliierten und assoziierten Regierungen" übergeben.
Die deutsche Öffentlichkeit reagierte mit einem Aufschrei der Empörung, sie war von der Reichsregierung nicht im mindesten über die drohenden Opfer informiert worden. Die Regierung hatte, ähnlich wie kurz zuvor die OHL, den Ernst der Lage unter den Tisch gekehrt und sich an eine Illusion wie die des ,,Wilsonfriedens" geklammert, um ihren eigenen Status zu schützen.
Die Bestimmungen des Vertragsentwurfs lassen sich in vier grundlegende Bereiche gliedern:
a) Reparationen
b) Gebietsabtretungen
c) Abrüstung/Beschränkungen
d) Schuldfrage
a) Reparationen
Zur Festlegung der wirtschaftlichen Wiedergutmachungsforderungen bildeten die Alliierten eine Reparationskommission (Repko), deren endgültige Forderungen Deutschland erst später vorgelegt werden sollte. Die deutsche Schätzung von 30 Milliarden Reichs- bzw. Goldmark sollte sich als weit untertrieben herausstellen.
Zur sofortigen Lieferung wurden hingegen 60 Prozent der deutschen Kohleförderung verlangt.
Weitere Sachlieferungen beinhalteten u.a. Verkehrs- und Transportmittel, Lokomotiven, Eisenbahnwaggons, alle Handelsschiffe, Maschinen, ein Viertel der Erzeugung chemischer und pharmazeutischer Produkte, sowie mehr als die Hälfte des Milchviehbestandes.
b) Gebietsabtretungen
Dem Versailler Friedensvertrag nach sollte Deutschland folgende Gebiete an die unterschiedlichsten Länder (meist Siegermächte) abtreten:
- Elsaß-Lothringen an Frankreich (ohne Abstimmung)
- Saargebiet (Saarland) für 15 Jahre unter Völkerbundkontrolle, Benutzung der Kohlegruben durch Frankreich (danach Abstimmung)
- Eupen und Malmedy an Belgien (mit -umstrittener- Abstimmung)
- Nordschleswig an Dänemark (mit Abstimmung)
- Posen, Westpreußen, Teile von Ostpreußen und Hinterpommern (als ,,polnischen Korridor"), sowie Ostoberschlesien an Polen (mit Abstimmung)5
- Danzig mit Weichselmündung wurde ,,Freie Stadt" unter Kontrolle des Völkerbundes, Polen erhielt Sonderrechte
- sämtliche Kolonien wurden Mandatsgebiete verschiedener alliierter Staaten
- Verbot der Vereinigung mit Österreich
c) Abrüstung / Beschränkungen
- Beschränkung des Heeres auf 100.000 Berufssoldaten
- Verbot der allgemeinen Wehrpflicht
- Verbot schwerer Waffen (Panzer, Flugzeuge, U-Boote, Schlachtschiffe)
- Kontrolle der Abrüstung durch eine Interalliierte Kommission
- Besetzung des linken Rheinufers auf 15 Jahre
- Verbot der Truppenstationierung und des Unterhalts von Verteidigungsanlagen in einer Zone von 50 km rechtsseits des Rheins
e) Schuldfrage
- Im Artikel 231 des Versailler Vertrags wurde Deutschland die Alleinschuld am Ausbruch des Krieges zugesprochen; d.h., daß für alle aus dem Krieg resultierenden Verluste, Ausgaben und Schulden Deutschland allein zu zahlen hatte.
Dieser Vertrag war ein Schock für die deutsche Öffentlichkeit. In der deutschen Bevölkerung hatte man den Krieg als einen erzwungenen Verteidigungskrieg verstanden, doch nun wurde man zum Agitator gestempelt, als solcher gar diffamiert.
Der größte Stein des Anstoßes war der Kriegsschuldparagraph6, ein Novum in der Geschichte. Bisher hatte es nur Sieger und Verlierer gegeben, doch mit §231 hielt erstmals die Moral Einzug in einen Friedensvertrag:7,,Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an, daß Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben."8
Der Begriff Reparationen birgt schon diesen moralischen Ansatz. Wiedergutmachungen kann man nur da fordern, wo es einen Geschädigten und einen Schuldigen gibt. Wilsons vierzehn Punkte hatten einen Frieden gefordert, der weitgehend auf Annexionen und ganz auf Kontributionen verzichtete, doch solch ein Friede war mit der Bevölkerung der alliierten Staaten, speziell Frankreichs, nicht mehr zu vereinbaren. Mit dem Schlagwort ,,Reparationen" und seiner eindeutigen Schuldzuweisung manövrierten sich die Siegermächte aus der Zwickmühle zwischen Wilsons ethischen Zielen und der materiellen Erwartungshaltung der westeuropäischen Bevölkerung.
Das Wort ,,Diktatfrieden" war in Deutschland in aller Munde, ein Begriff, der angesichts der angedrohten Sanktionsmaßnahmen für den Fall der Nichteinhaltung der Reparationsforderungen berechtigt war.
Die Aufforderung, diese ,,Selbstbezichtigung und Selbstverurteilung"9 zu unterschreiben, wurde als unerträgliche Erniedrigung empfunden; sie schürte Haß, revanchistische, antirepublikanische Stimmen erhoben sich, der innen- und außenpolitische Friede war weiterhin in Gefahr.
,,Freilich war auch die Unterzeichnung des Friedensvertrags mit großen inneren Risiken verbunden. In den preußischen Ostprovinzen waren für den Fall, daß Deutschland sich den Friedensbedingungen der Entente beugen sollte, Pläne für die Errichtung eines selbständigen ,,Oststaates" ausgearbeitet worden."10
Dieser Vertrag kompromittierte die junge deutsche Republik in einem ihrer empfindlichsten Momente, nämlich in ihrer Entstehung.
Nach langen Debatten innerhalb des Parlaments wurde der Vertrag am 28.Juni 1919 im Spiegelsaal von Versailles ratifiziert.
4. Die Folgen des Vertrags / der Weg in die Krise
Die Reparationskonferenz von Spa (5.-16.7.1920) setzte sich aus Vertretern der Siegermächte Frankreich, England, Belgien, Italien und den USA zusammen, wobei Frankreich als Hauptgeschädigtem der Vorsitz zufiel und die USA nur durch Beobachter vertreten waren; sie hatten den Versailler Vertrag nicht ratifiziert. Für die deutsch - französischen Beziehungen sollte dies zum Nachteil sein, denn Frankreich war über den amerikanischen Rückzug und der damit nicht eingelösten Sicherheitsversprechungen schwer getroffen, zumal der Versailler Vertrag nur deshalb Deutschlands Einheit nicht in Frage gestellt hatte, weil Frankreich auf amerikanische Rückendeckung zählte. Folglich mußte man aus französischer Sicht nun auf anderem Wege eine Sicherheit schaffen, man mußte für eine nachhaltige Schwächung Deutschlands sorgen. Das naheliegende Werkzeug hierfür hieß Reparationskommission. Hauptgegenstand der Repko waren aber nicht die Reparationszahlungen, sondern die militärische Abrüstung Deutschlands und die Festlegung der Kohlelieferungen, die in den letzten Monaten von deutscher Seite aus gekürzt worden waren. Dies entsprach aus alliierter Sicht einer Verletzung des Friedensvertrages, weswegen die Kohlelieferungen und mögliche Sanktionen im Vordergrund standen. Mit Hilfe der Vermittlung Lloyd Georges kam ein Abkommen zustande, nach dem Deutschland für die monatliche Lieferung von 2 Millionen Tonnen Kohle besonders guter Qualität eine Prämie von 5 Goldmark pro Tonne für die Lebensmittelversorgung der Bergleute zugesichert wurde.
Doch ebenso wurde hier mit Sanktionen gedroht: Bei Nichteinhaltung des Abkommens, sei es durch Verzögerung der Lieferungen, wurde eine Besetzung des Ruhrgebietes in Aussicht gestellt. Im Versailler Vertrag war festgehalten worden, daß die Repko bei absichtlicher Nichteinhaltung der Lieferungen, bzw. Zahlungen, Sanktionsmaßnahmen vorschlagen sollte. Das heißt, eine vorsätzliche Verletzung des Vertrages hätte dann nicht bestanden, wenn das Lieferungssoll aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht erfüllt worden wäre. Eine absichtliche Nichteinhaltung war nach alliierter Ansicht auch die Kürzung der Lieferung oberschlesischer Kohle, die von der deutschen Industrie benötigt wurde; d.h., die Alliierten zeigten sich deutschen Bedürfnissen gegenüber unnachgiebig.
Die Frage der Reparationszahlungen wurde aufgrund der Uneinigkeiten zwischen den einzelnen Parteien zurückgesetzt, was das Verhältnis zwischen Deutschland und den Alliierten, sowie zwischen den Alliierten selbst, weiter spannte.
Insgesamt fiel das Ergebnis der Konferenz von Spa sehr spärlich aus; es wurden zwar kaum konkrete Angaben über die Höhe der Lieferungen und Zahlungen gemacht, aber in der Frage der Sanktionsmaßnahmen war man sich bereits einig - unter diesen Voraussetzungen mußte man mit baldigen Sanktionen rechnen. Die deutschen Versuche, das Thema Ruhrgebiet vom Verhandlungstisch zu nehmen, waren an der Uneinigkeit der deutschen Vertreter gescheitert. Das Ende der Konferenz von Spa bezeichnet eine Kampfpause zwischen Deutschland und Frankreich; beide Seiten waren noch nicht bereit, aufeinander zuzugehen, es wurde am Verhandlungstisch weitergekämpft.
Frankreich war, wie schon beim Versailler Vertrag, die treibende Kraft in der Frage der Reparationsforderungen. Sein Interesse an deutscher Kohle, speziell der qualitativ hochwertigen Ruhrgebietskohle, lag in seiner Schwerindustrie begründet, die diese zur Stahlerzeugung benötigte. Dennoch war es durchaus im französischen Interesse, die endgültige Festlegung der Reparationen hinauszuschieben. Eine voreilige Entscheidung, eine zu schnell fixierte Summe, hätte sich als zu niedrig erweisen können, man stand schließlich in der Pflicht, das vollmundig verkündete ,,le boche payera tout" auch in die Tat umzusetzen - ohne Rücksicht auf die tatsächliche Zahlungsfähigkeit des Schuldners. Zudem war der französische Respekt vor der Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie noch so groß, daß man eine reale Zahlungsunfähigkeit gar nicht in Erwägung zog. Im Gegenteil, Hinweise auf die Inflation der Mark hielt man für einen Versuch, sich seiner finanziellen Verpflichtungen zu entziehen.11
Auch die Reparationskonferenz von Brüssel im Dezember 1920 brachte keine Lösung des Problems, und so trat am 24.1.1921 der Oberste Rat, bestehend aus den Regierungschefs Frankreichs, Englands, Italiens und der USA, in Paris zusammen. Notwendig wurde diese Beschränkung, weil erkannt worden war, daß die Beteiligung aller Siegermächte die Verhandlungen nur erschwerte.
Am 29.Januar unterbreiteten die Alliierten gegen den Widerstand der britischen Vertreter den ,,Vorschlag", daß Deutschland über einen Zeitraum von 42 Jahren insgesamt 226 Milliarden Goldmark zu zahlen habe, zusätzlich sollten 12% der Ausfuhr als Reparationsleistung abgeführt werden. Dieser Vorschlag war allerdings wiederum mit Sanktionsdrohungen versehen, daher kam er einem Ultimatum nahe.
Die Bekanntmachung der Pariser Forderungen löste in Deutschland eine Welle der Empörung aus, ähnlich wie bei der Verkündung der Friedensbedingungen. Ungeachtet aller Proteste und Appelle des amtierenden Reichskanzlers Fehrenbach wurden diese Forderungen zur Basis der Londoner Konferenz vom 1.-7.3.1921, die die Reparationsleistungen endgültig festsetzen sollte; die Alliierten hatten sich hierfür selbst bis zum 1.5.1921 ein Ultimatum gesetzt. Fehrenbach blieb bei seiner Haltung, daß die Pariser Beschlüsse unausführbar seien, wofür er im eigenen Land viel Applaus erntete, da endlich wieder ein deutscher Politiker dem Ausland die Stirn bot. Das Angebot, daß Deutschland noch 30 Milliarden Goldmark zahlen werde, charakterisiert Krüger12 mit Recht als ungeschickt. Der offensive Weg, Stärke zu beweisen, wo gar keine sein konnte und damit die Alliierten zu brüskieren, war sicherlich der falsche
Weg, denn das ließ England, das bereits Vorbehalte gegen die schonungslose Vorgehensweise Frankreichs hegte, wieder hart werden.
Da die ausgesetzte Frist, sich bis zum 7.März zu entscheiden, von den deutschen Delegierten nicht eingehalten wurde, kam es zu den angedrohten Sanktionen: Am 8.März wurden die Städte Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort besetzt, die deutschen Zölle der Westgrenze wurden einbehalten. Diese Maßnahme war aus alliierter Sicht erfolgreich, die Deutschen wähnten sich kurz vor der Ruhrbesetzung. Das Kabinett Fehrenbach blieb unnachgiebig, man setzte, weder zum ersten, noch zum letzten Mal, auf eine Vermittlung der USA, die jedoch nicht den erhofften Erfolg brachte.13
Fehrenbach zog seine Konsequenzen und trat am 4. Mai 1921 vom Amt des Reichskanzlers zurück.
Das Kabinett Wirth
Am Tage nach Fehrenbachs Rücktritt traf das Londoner Ultimatum in Berlin ein: Deutschland sollte 132 Milliarden Goldmark zahlen, bei einer jährlichen Verzinsung von 6%. Hinzu kam eine zusätzliche Reparationsleistung von 26% der deutschen Ausfuhr. Eine deutliche Verringerung also, verglichen mit den Pariser Forderungen, dennoch: Expertenmeinungen zufolge trug auch diese Reparationsregelung der deutschen Wirtschaft nicht Rechnung.14 Die französische Regierung hatte im Obersten Rat ein Ultimatum an Deutschland durchsetzen können: Die Reichsregierung hatte 6 Tage Zeit , den Plan zu unterschreiben. Für den Fall der Nichtannahme wurde wiederum die Besetzung des Ruhrgebietes in Aussicht gestellt. Wie war es möglich, daß England nichts gegen Frankreichs harte Linie im Obersten Rat unternahm, obwohl es mit J.M. Keynes einen Wirtschaftsexperten in den eigenen Reihen hatte, der bereits auf die Unerfüllbarkeit der Reparationsregelungen hingewiesen hatte? Winkler sieht den Grund hierfür in der Nichterfüllung eines anderen Punktes des Versailler Vertrags15: Die Sollgröße der Reichswehr war auf eine Stärke von 100 000 Mann festgelegt worden, doch die Reichsregierung versuchte den Umstand zu decken, daß die tatsächliche Größe sich durch die aufgelösten Freikorps auf nunmehr 200 000 Mann belief. Außerdem gab es noch paramilitärische Verbände, die noch nicht aufgelöst worden waren.
Nach Fehrenbachs Rücktritt trat am 10.Mai 1921 der Zentrumspolitiker Joseph Wirth das Amt des Reichskanzlers an. Wirth, ein Freund und Anhänger Erzbergers, gehörte als bekennender Republikaner dem linken Flügel seiner Partei an, was aber nicht darüber hinweg täuscht, daß er ein ebenso starker Nationalist war. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger nahm er den Londoner Zahlungsplan an und bemühte sich um dessen Erfüllung - allerdings mit dem gleichen Ziel aller seiner Vorgänger: der Revision von Versailles. Er hatte erkannt, daß aktiver Widerstand zwecklos war, daher versuchte er, die alliierten Reparationspläne ad absurdum zu führen, indem Deutschland sein Äußerstes geben sollte, diese zu erfüllen und am Ende bankrott dazustehen, woran die westeuropäischen Mächte kein Interesse haben konnten.16 In den folgenden drei Monaten wurde die geforderte Summe von einer Milliarde Goldmark fristgerecht aufgebracht, doch schon bald danach zeigte sich angesichts der mangelnden Leistungsfähigkeit die Sinnlosigkeit der Ultimaten. Am 14.12.1921 mußte die Reichsregierung bei der Repko um Stundung der ersten Zahlungen des Jahres 1922 bitten. Die Beschaffung der Devisen gestaltete sich zu einem Problem, da England und Frankreich aus Sorge um ihre eigenen Marktchancen den deutschen Export erschwerten. Also bediente das Kabinett Wirth die Banknotenpresse, es wurde mehr Geld in den Umlauf gebracht, wodurch eine immer drastischer werdende Geldentwertung entstand. Die zunehmende Entwertung der Mark wiederum öffnete deutschen Exporteuren ausländische Märkte, was nicht in Frankreichs oder Englands Sinn sein konnte.
Es zeichnete sich ab, daß das Kräftemessen zwischen Deutschland und Frankreich zu einer Sackgasse wurde, daher schlug Lloyd George auf der Konferenz von Cannes im Januar 1922 Briand vor, eine weitere Konferenz solle sich, losgelöst von allen Forderungen und politischen Vorbehalten, um die gesamten internationalen Schuldverpflichtungen kümmern. Zu dieser Konferenz sollten auch Rußland und Deutschland geladen werden. Als Sicherheit bot George dem Franzosen den Abschluß eines Garantiepakts, der 1919 nicht zustande gekommen war. Doch ,,Briand, der persönlich geneigt war, auf das Angebot Lloyd Georges einzugehen"17, wurde gestürzt; an seine Stelle trat im Januar 1922 Poincaré, ein politischer Hardliner, was die französisch-deutschen Beziehungen betraf. Dieser Wechsel charakterisiert die Stimmung in Frankreich: Der französischen Öffentlichkeit war Briands Vorgehen zu nachgiebig, zu weich, man wollte eine härtere Politik gegen Deutschland, dem Erzfeind, der für die immensen Schäden aufkommen und ein für alle mal in seine Schranken verwiesen werden sollte.
Eine Verhärtung der Situation fand auch in Deutschland statt: Der Nervenkrieg der Reparationskonferenzen und das Schlagwort der ,,Erfüllungspolitik" leistete revanchistischen Parolen deutlich Vorschub, große Teile der deutschen Presse heizten die Stimmung auf, und so kam es am 26.August 1921 zum Mord an Matthias Erzberger, der aufgrund seiner republikanischen Gesinnung als ,,Verschwörer" sein Leben lassen mußte.18
Der Vertrag von Versailles war mittlerweile zu Deutschlands Trauma geworden. Mit jeder Konferenz, mit jeder alliierten Note, mit jeder angedrohten Sanktionsmaßnahme wuchs dieses Trauma zu einer stolz- und haßerfüllten Neurose, die sich ihr Ventil im Inneren suchte. Wie schon angedeutet, kam es zu Aufständen wie den Kapp- Putsch und zu politischen Morden, genannt seien hier nur Erzberger und Rathenau, weil sie für revanchistische Republikgegner Repräsentanten der Politik waren, die Deutschland ans französische Messer geliefert hatten.19 Wirths Erfüllungspolitik, vom Ansatz her durchaus redlich dahin zielend, den Alliierten die Unerfüllbarkeit ihrer Forderungen vor Augen zu führen, um so eine Revision von Versailles herbeizuführen, scheiterte schon bald an dessen politischer Unglaubwürdigkeit: Zu Wirths Zielen gehörte nämlich die Auflösung Polens, das einen Freundschaftsvertrag mit Frankreich geschlossen hatte, eine Maßnahme, die Frankreich zur Einkreisung Deutschlands ergriffen hatte. Die Umsetzung dieses Plans sollte mit russischer Hilfe geschehen, daher gab es seit September 1921 eine geheime Kooperation zwischen Reichswehr und Roter Armee, für die Wirth, bis November 1921 noch Reichsfinanzminister, die notwendigen Gelder beschaffte. Ende April 1922 begannen die Junkers - Werke in Rußland mit dem Bau von Militärflugzeugen, ein klarer Verstoß gegen die Abrüstungsparagraphen des Versailler Vertrags.20
Wirths revisionistisch angelegte Erfüllungspolitik erwies sich also schnell als vergebliche Hoffnung, sie wurde schon im Herbst 1921 zugunsten einer revanchistischen Boykottpolitik ad acta gelegt. Wirth war naiv genug zu glauben, daß diese Interaktion bei den Westmächten unentdeckt bleiben würde und war sogar bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen.21
Der Vertrag von Rapallo - Zuspitzung der Lage
Am 10. April 1922 trat in Genua eine internationale Konferenz zusammen, deren Aufgabe es sein sollte, Sieger und Besiegte an einem Verhandlungstisch zusammenzubringen, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas zu erörtern. Poincaré hätte sie gerne verhindert, denn mit jeder Konferenz stand ein Stück Versailles auf dem Spiel. Bezeichnenderweise blieb er der Konferenz fern.
Für Deutschland zeichnete sich bereits ein Teilerfolg ab: Alliierte Experten räumten ein, daß der deutsche Währungsverfall zum großen Teil durch die Reparationszahlungen verursacht werde und daß aus diesem Grund die Leistungskraft des Reiches untersucht werden müsse. Doch auf französisches Drängen hin wurde die Reparationsfrage gestrichen - die USA zogen daraufhin ihre Teilnahme zurück, denn auch sie waren nicht bereit, von ihren Forderungen gegenüber Frankreich abzurücken. Statt dessen kursierte das Gerücht eines Abkommens zwischen Rußland und den Westmächten, das über die Köpfe deutscher Interessen hinweg zustande zu kommen drohe. Von dieser Nachricht muß sich die deutsche Delegation nervös in Handlungsdrang gebracht gefühlt haben, denn sie hatte jetzt nichts Eiligeres zu tun, als sich selbst um Separatverhandlungen mit Rußland zu bemühen.
Während Außenminister Rathenau, um das Verhältnis zu England besorgt, noch zögerte, drängte Reichskanzler Wirth auf ein Sondertreffen mit der russischen Delegation. Wie bereits erwähnt, hatte Frankreich ein Bündnis mit Polen geschlossen, wodurch sich Deutschland mit Recht umzingelt fühlen durfte. Die Aussicht auf ein - wenn auch nur nominelles - Bündnis mit Rußland ließ einerseits Polen eingekreist erscheinen, andererseits konnte es als Machtmittel eingesetzt werden - das Spiel mit der Furcht vor bolschewistischen Zuständen in Deutschland versprach eine günstigere Verhandlungsposition gegenüber den Alliierten. So kam es zum Vertrag von Rapallo, in dem die beiden ausgegrenzten Staaten auf gegenseitige Ansprüche aus dem Weltkrieg verzichteten und sich wechselseitige wirtschaftliche Förderung zusicherten. Rapallo kennzeichnet hier eine erstmalige außenpolitische Handlungsfreiheit, von der sich die Reichsregierung eine ,,verbesserte Verhandlungsposition gegenüber der Entente"22 versprach.
Daß dieses Bündnis aber nur Wasser auf die Mühlen der westeuropäischen Hardliner war, dafür fehlte ihr der Blick. Für England bedeutete dieser Ausgang ein Scheitern der Europapolitik Lloyd Georges (Einbeziehung Rußlands und Deutschlands in die Verhandlungen), der bald darauf gestürzt wurde. England blieb nichts anderes übrig, als sich seinem Ententepartner wieder anzunähern; Genua kennzeichnete das vorläufige Ende englischer ,,Good-Will-Politik", die auf der Erkenntnis fußte, daß ganz Europa den Weltkrieg verloren hatte und nun alles daran gesetzt werden mußte, über eine gesamteuropäische Verständigung Konflikte zu schlichten und gesicherte wirtschaftliche Verhältnisse zu schaffen.
In Frankreich bekam Poincarés hartnäckige Politik eine breitere Basis, zumal hier Rapallo als Revanche für das Bündnis mit Polen eine besondere Bedeutung bekam; es war ein Signal der Offensive für Frankreich, da sich Deutschland aus seiner Umklammerung löste und mit dem Partner Rußland eine besondere Bedrohung darstellte.
Nun fühlte sich Frankreich unter Handlungszwang gebracht, man sah den Zugriff auf deutsche Reparationsleistungen dahinschwinden. Der Ruhreinmarsch wurde nun immer wahrscheinlicher.23
Der Ruhrkampf
Der Ausgang der Konferenz von Genua wurde von seinem Nebenprodukt Rapallo überschattet. Europa befand sich in einer absolut verfahrenen Situation: Deutschland hatte die erste Gelegenheit, an einem gesamteuropäischen Verhandlungstisch mitzuverhandeln, durch die überhastete Unterzeichnung von Rapallo zunichte gemacht und damit Englands Einfluß auf Frankreich zerstört. Frankreich, das unter der Schuldenlast der amerikanischen Kredite stand, sah sich in die Ecke gedrängt, denn das Bündnis Deutschland - Rußland ließ nicht nur die Reparationen in die Ferne rücken, es bedeutete darüberhinaus sogar eine handfeste Bedrohung.
Zur Verschärfung der Lage trug das definitive Ende der Erfüllungspolitik bei - bedingt durch den Kursverfall der Mark erbat die Reichsregierung Mitte Juli 1922 die Stornierung aller Zahlungen bis Ende 1924. Auch der blühende Hypernationalismus, der sich im Mord an Walther Rathenau widerspiegelte, mußte für Frankreich bedeuten, daß nun Handlungsbedarf bestand.
Frankreich mußte sich in Bedrängnis sehen, denn die USA begannen nun mit der Einforderung ihrer Außenstände. Sie begannen bei England, dem zahlungsfähigsten Verbündeten, das nun seinerseits mittels Balfour - Note vom 1.8. 1922 seine Forderungen an die europäischen Schuldner schickte. Daß diese Note, ähnlich wie die Erfüllungspolitik Wirths, ein demonstrativer Schachzug, ein Wink mit dem Zaunpfahl war, wurde tragischerweise nicht wahrgenommen. Sie sollte ein Zeichen für die USA sein, daß es sinnvoll sei, in den Schulden-und Reparationsfragen zunächst Mäßigung walten zu lassen, damit sich eine wirtschaftliche Erholung einstelle. Stattdessen sahen sich die Schuldner, speziell Frankreich, unter Druck gesetzt. Der amerikanische Außenminister Hughes legte am 29.12.1922 in seiner New-Haven Rede die amerikanischen Vorstellungen zur europäischen Frage dar, man hatte erkannt, daß sich die bisherige Reparationspolitik als unpraktikabel erwiesen hatte. Das neue Konzept sah vor,
,,1. daß Deutschland bis an die Grenzen seiner Fähigkeiten für die mutwillige Aggression zu zahlen habe,
2. daß darüber hinausgehende Forderungen indes die Verwirklichung dieses Grundsatzes verhindern, während
3. eine Begrenzung der Verpflichtungen auf das Maß des Möglichen keine Konzession darstelle, sondern erst die Voraussetzung für die Erfüllung schaffe."24
Doch die Balfour-Note hatte ihr übriges getan, den Stein ins Rollen zu bringen; Frankreichs Haltung hatte sich verhärtet, und daran konnte auch eine Rede des amerikanischen Außenministers nichts ändern, allenfalls forcierte schon die Andeutung einer weiteren Zahlungsbegrenzung Frankreichs Absichten. Auf die USA konnte man nicht zählen, das hatte man schon in Versailles schmerzlich erfahren müssen -und jetzt auch noch England.25
So war es denn auch keine große Überraschung, daß die Repko am 9. Januar 1923 gegen die Stimmen der britischen Mitglieder befand, Deutschland sei mit der Lieferung einiger hunderttausend Telegraphenstangen im Rückstand. Poincaré forcierte nun die Politik der produktiven Pfänder, der Ententepartner England bot ihm nicht den erwünschten Rückhalt mehr, die USA bedrängten ihn mit Forderungen, Deutschland schien sich einerseits seiner Pflichten zu entziehen und andererseits zur erneuten Bedrohung zu werden, also rückten am 11. Januar 1923 fünf französische Divisionen, durch belgische Verbände verstärkt, ins Ruhrgebiet ein. Poincaré war sich der Notwendigkeit einer legalen Basis seiner Intervention bewußt, er spürte, daß sich Frankreich in eine Isolation begab; daher legte er Wert auf die Legitimation durch die Repko, die auf eine Nichterfüllung des Versailler Vertrags und der nachfolgenden Zahlungspläne befand.
Die Motive Frankreichs
Die Lieferrückstände sind jedoch nur ein Teil der Wahrheit, bzw. der Motive Poincarés für die Ruhrbesetzung. Sicherlich übten die USA und nun auch Englands Bonar-Law-Plan erheblichen Druck durch die Forderung nach Tilgung der Kredite auf Frankreich aus, zumal der Franc eine Talfahrt machte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, daß die deutsche Industrie nach dem Krieg schneller wieder auf die Beine gekommen war, als die französische. Doch Poincarés Maßnahme trägt ebenso revanchistische Züge: Der Vertrag von Rapallo, seinerseits ein revanchistischer Schachzug gegen das Frankreich - Polen Bündnis, stellte zwar auch eine Bedrohung für Westeuropa dar, aber er konnte genauso gut der willkommene Anlaß dafür sein, Frankreichs Wünsche und Erwartungen bezüglich der Durchführung von Versailles in die Tat umzusetzen: Deutschland ein für alle Mal ruhig zu stellen. Der Sprung an die Ruhr war Deutschlands Achillesverse im Kalten Krieg, der nun beinahe wieder ein ,,heißer" geworden wäre. Schulze faßt es kompakt zusammen: ,,>La Ruhr<: das war in französischen Augen mehr als nur eine Gegend, in der Kohle abgebaut und Erz verhüttet wurde; es war ein Mythos, das Nervenzentrum Deutschlands, der Sitz der Stahl- und Kohlebarone, die den Kern des deutschen Widerstands gegen die gerechte Ordnung von Versailles ausmachten. Man mußte die Hauptkraft des deutschen Reichs dort schlagen, wo sie saß. Das war Poincarés Absicht, und Frankreich stand beinahe geschlossen hinter ihm."26
Das bedeutet, daß Frankreichs Sicherheitsbedürfnis eine große Rolle spielte; die Angst vor der Übermacht der deutschen Schwerindustrie war außerdem berechtigt: Seit 1890 hatte sie einen großen Aufschwung erlebt; 1913 war Deutschland dank seiner Eisenindustrie hinter den USA die zweitstärkste Industriemacht, es erzielte 25% der Weltstahlproduktion. Der Eisenerzabbau in Lothringen bildete die Basis für die Stahlerzeugung im Ruhrgebiet, was der Grund für den Bau von Hochöfen auch in Lothringen war. Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung der Rückgewinnung Elsaß-Lothringens für Frankreich erst deutlich: Sie entzog der Ruhrindustrie über 80% der Eisenerzversorgung.27 Doch schon 1922 ,,[...] besaß Deutschland auf deutschem Boden das gleiche Stahlerzeugungspotential wie in den Grenzen von 1913."28 Deutsche Hütten boykottierten das luxemburgisch-lothringische Eisenerz, man beschaffte es sich nun aus Schweden und Spanien. Hingegen betrug die französische Eisenerzfördermenge 1922 gerade einmal 48% des Jahres 1913, weswegen es zu einer großen Arbeitslosigkeit in Frankreichs Schwerindustrie gekommen war.
Da die wirtschaftliche Potenz der Schwerindustrie hauptausschlaggebend für den Aufbau einer Militärmacht ist, kann man Frankreichs Sicherheitsbedürfnis und speziell seinen Zugriff auf das Ruhrgebiet gut nachvollziehen, zumal das Sicherheitsabkommen mit den USA nicht zustande gekommen war und nun auch noch Rapallo drohend im Wege stand. Bariéty führt in diesem Zusammenhang die gesamteuropäische Furcht vor der deutschen Schwerindustrie an, die ihren Ausdruck im Versailler Vertrag fand: ,,Es ist verständlich, daß die französischen Regierungen der Kriegsjahre für den Fall, daß Frankreich als Sieger aus dem Konflikt hervorgehen würde, aus Gründen des wirtschaftlichen Gleichgewichts, aber auch der militärischen Sicherheit, als eines der französischen Kriegsziele die Schwächung der deutschen Industriekapazität festgelegt haben. Mit diesen Gedanken stand die französische Regierung gegen Ende des Ersten Weltkriegs nicht allein; alle Verbündeten teilten sie, so daß dieses Ziel 1919 in den Versailler Vertrag eingehen konnte."29
Das wirtschaftliche Ziel des Vertrags bestand darin, die deutsche Industrie für einen bestimmten Zeitraum zu schwächen, der ausreichte, um die eigene Wirtschaft wieder aufzubauen. Für diesen Aufbau benötigte man die Kohle- und Kokslieferungen des Ruhrgebietes.
Dieses Ziel war in den Jahren 1919 bis 1922 nicht erreicht worden, mit jeder Konferenz wurde der alliierte Anspruch gesenkt, Frankreich mußte den Eindruck bekommen, es arbeite gegen die Zeit, denn schon bald nach der Unterzeichnung distanzierte sich England von den wirtschaftlichen Forderungen von Versailles, es fürchtete sich -immer noch die ,,balance of power" im Blick- vor einer wirtschaftlichen Hegemonie Frankreichs, der Absatzmarkt Deutschland war in Gefahr.
Rapallo löste zusätzlich eine französische Panik aus, man fürchtete sich vor der Paarung aus wirtschaftlicher und demographischer Macht, die jetzt aus dem Osten drohte, wie Bariéty sich ausdrückt.30
Zu den wirtschaftlichen Motiven gesellen sich hier also auch politische, die zur Ruhrbesetzung führten. Im Allgemeinen ging es um die Durchführung des Versailler Vertrags, die aus den oben genannten Gründen in immer weitere Ferne gerückt war. Sie sollte eine Machtprobe sein, nicht nur zwischen Frankreich und Deutschland, sondern auch zwischen Frankreich und den Ententepartnern.
Kurz umrissen, lassen sich Frankreichs Motive wie folgt auflisten:
- die problematische Situation der französischen Schwerindustrie
- das Ersuchen Cunos um mehrjährigen Zahlungsaufschub
- die Bedrohung durch das Rapallo-Bündnis
- Frankreichs zunehmende außenpolitische Isolation, speziell gegenüber England und den USA, und letztlich
- der wachsende innenpolitische Druck auf Poincaré
Der passive Widerstand
Poincaré konnte auf fertige Pläne zurückgreifen; 1919 erstellt, waren sie bis 1922 immer wieder verfeinert worden. Am 10.1.1923 überreichten Frankreich und Belgien Deutschland Noten, aus denen hervorging, daß deutsche Lieferrückstände zum Anlaß genommen wurden, eine aus Ingenieuren bestehende Kontrollkommission zur Beaufsichtigung des Kohlesyndikats ins Ruhrgebiet zu entsenden. Es wurde der nichtmilitärische Charakter dieser Maßnahme betont - es sollte nur um die Erfüllung des Versailler Vertrags gehen; dennoch rückten unter dem Vorwand des Geleitschutzes militärische Truppenverbände mit ins Ruhrgebiet ein. Poincaré war jederzeit auf die legale Absicherung durch die Repko bedacht, wohl um eine spätere Beteiligung der Briten nicht von vornherein auszuschließen. Die Ingenieure hatten den Auftrag, eine baldige Beschleunigung der Kohlelieferungen nach Frankreich und Belgien herbeizuführen. Die offizielle Devise hieß ,,Frankreich holt sich nur, was ihm rechtmäßig zusteht."
Doch schon am 10.1.1923 evakuierte das Syndikat seine Verwaltung mitsamt seinen Unterlagen nach Hamburg, der Zugriff auf einige der wichtigsten Instrumente wurde Frankreich so entzogen.
Französische und belgische Truppen, insgesamt etwa 45000 Soldaten, besetzten am 11.1.1923 vom Brückenkopf Düsseldorf - Duisburg aus Essen, um von dort aus das Dreieck Duisburg- Wesel-Haltern in Angriff zu nehmen. Die Intervention, die Einnahme der wichtigsten deutschen Dienststellen, war bereits am 16.1.1923 abgeschlossen. Der Belagerungszustand wurde verhängt, und spätestens von nun an wurde der militärische Charakter des Unternehmens immer deutlicher.
Die USA nahmen dies zum Anlaß, ihre Truppen aus dem Rheinland zurückzuziehen; eine Maßnahme, die Frankreich die Illoyalität der USA vor Augen führte31. Weder England, noch Amerika waren an einer wirtschaftlichen Hegemonialstellung Frankreichs interessiert, daher wollte man keine Unterstützung leisten. England fürchtete den Zusammenschluß französischen Erzes und der Ruhrkohle und damit die Bedrohung durch eine übermächtige französische Schwerindustrie.
Durch die ständige Drohung, man werde bei Nichterfüllung der Leistungen das Ruhrgebiet besetzen, traf dieser Schlag die deutsche Reichsregierung und Bevölkerung nicht völlig überraschend, schließlich war er seit März 1921 nach jeder Reparationskonferenz als Sanktionsmaßnahme erwogen worden. Die Bevölkerung des Ruhrgebiets hatte sich bereits seelisch darauf vorbereitet: Auf den Straßen wurden nationale Lieder gesungen; der ,,Geist von 1914" schien wiedererwacht zu sein. Reichskanzler Cuno war sich der kommenden nationalen Welle bewußt, er appellierte an das Parlament, ,,[...] sie nicht sich selbst zu überlassen und nicht etwa unter das Zeichen des Hakenkreuzes, auch nicht der schwarz-weiß- roten Flagge kommen zu lassen, sondern dafür zu sorgen, daß sie von vornherein der Einigung und Versöhnung im deutschen Volke diene."32
So stießen französische wie belgische Truppen im Ruhrgebiet zunächst auf kalte Ablehnung. Es wurde für sie deutlich, daß man im Ruhrgebiet offenbar eine Taktik verfolgte: Französisch-belgische Befehle wurden nicht befolgt, man wich ihnen aus. Ohne selber Gewalt anzuwenden, beugte man sich erst fremder Gewalt. Unternehmer, Arbeiter und Behörden praktizierten das, was bald als ,,passiver Widerstand" gelten sollte. Da die Zusammenarbeit mit rheinischen Unternehmen im Jahre 1922 keine großen Probleme aufgeworfen hatte, hatten die Besatzungsmächte nicht mit soviel Schwierigkeiten gerechnet. Man war von einem weitgehend unproblematischen Zugriff auf die Kontrolle über die Kohlelieferungen ausgegangen und hatte in Proklamationen versichert, man werde das Leben der Bevölkerung nicht stören und die Rechte der Arbeiterschaft (wie z.B. den 1918 eingeführten Achtstundentag) respektieren33.
Die ,,nationale Welle" äußerte sich u.a. in der Weigerung der Eisenbahner, die Kohle zu transportieren, die Zechen lieferten gar auf Anweisung des Reichskohlenkommissars in Berlin gar keine Kohle mehr an die Besatzungsmächte. Auf dieses Verbot berief sich am 13.1.1923 Fritz Thyssen, Wortführer der Ruhrindustriellen, als Antwort auf die französischen Forderungen, die ihm der Präsident der MICUM (,,Mission Interalliée de Contrôle des Usines et des Mines") auf Anordnung des Chefs der französischen Zivilverwaltung im Ruhrgebiet übergab. Daß die zu geringe deutsche Förderkapazität der Grund für die mangelnden Lieferungen gewesen sei, war eine Schutzbehauptung, deren Aufrechterhaltung Thyssen durch sein Angebot, Kohle an die Besatzungsmächte zu verkaufen, zunichte machte.34 Thyssen und weitere seiner Kollegen wurden verhaftet und in Mainz zu hohen Geldstrafen verurteilt. Maßnahmen wie diese schürten den nationalen Haß nun auch im übrigen Reichsgebiet, es kam zu Solidaritätsbekundungen entlang der Bahnlinie Mainz - Düsseldorf, Thyssens Rückreiseweg. Der passive Widerstand hatte seine erste Gallionsfigur.
Die MICUM verstärkte ihre Gangart. Wenn die Zechen nicht liefern wollten, dann mußte man sich die Kohle durch Beschlagnahme sichern. Die Reaktion auf eine solche harte Vorgehensweise war die sofortige Einstellung der Arbeit, die MICUM sah sich gezwungen, zunächst die Kohlehalden unter militärischem Geleitschutz abzubauen. Da der passive Widerstand auch die Eisenbahner betraf, mußten französische Eisenbahner im Ruhrgebiet beschäftigt werden. Doch auch hier stieß man auf Widerstand: Vielen Bahnhöfen hatten die jeweiligen Stadtwerke die Stromzufuhr gekappt, weswegen wiederum einige Verantwortliche ins Gefängnis wanderten.
In Essen, dem Zentrum des Ruhrkampfes, eskalierte am Karsamstag des Jahres 1923 die Situation: Auf dem Gelände der Firma Krupp wurden zwölf Arbeiter durch französisches Militär erschossen, sie hatten die Arbeit niedergelegt, als die französische Abordnung das Werksgelände betrat und sich um die Soldaten herum versammelt. Angesichts dieser Bedrohung erteilte der Kommandeur den Schießbefehl. An diesem Vorfall läßt sich die Überspanntheit des deutsch - französischen Verhältnisses im Gesamten ausmachen. Die deutsche Gegenreaktion bestand wiederum aus Solidaritätsbekundungen und Demonstrationen. Als Verantwortlicher wurde hierfür u.a. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach ausgemacht und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Deutsche und französische Aktionen und Reaktionen wechselten sich ab, es war wie die Fortführung des Krieges mit anderen Mitteln. Der passive Widerstand, getragen von der ,,nationalen Welle" und seit Mitte Januar von der Reichsregierung legalisiert, ließ dennoch unter dem Druck der harten französischen Bestrafungspolitik nach: ,,Nach Monaten zunehmenden Drucks und wirtschaftlicher Stagnation war der kleine Beamte, Geschäftsmann oder Bergmann an der Ruhr jedoch immer seltener bereit, den Helden zu spielen und wegen eines verweigerten Befehls Gefängnis oder Ausweisung auf sich zu nehmen. Zum Kummer der Nationalisten im unbesetzten Deutschland zogen es die meisten Menschen vor, sich mit dem übermächtigen Militär zu arrangieren."35
Der aktive Widerstand
Der passive Widerstand war, genauso wie Poincarés legale Absicherung, Ausdruck einer
Politik des Werbens um, oder zumindest des Nichtausschließens von britischer Unterstützung. Die passive Gegenwehr sollte das Deutschland zugefügte Unrecht demonstrieren und die Weltöffentlichkeit auf die deutsche Seite bringen. Beide Parteien buhlten nun um die britische Loyalität, doch England wich aus, hielt sich zurück, während die Kontrahenten im Ruhrkonflikt sich gegenseitig auszubluten versuchten.
Doch die Zähigkeit Poincarés ließ den passiven Widerstand gerade in den Augen politischer Extremisten als Ausdruck deutscher Schwäche erscheinen. So wurden vermehrt Rufe nach aktiver Gegenwehr laut, ,,Erfüllungspolitiker" galten als ,,Verräter des deutschen Vaterlandes", in dumpf-chauvinistischen Kreisen wurde sogar die Wiederaufnahme des Krieges verlangt. Neben der Reichswehr hatte sich bereits eine illegale ,,Schwarze Reichswehr" gebildet, rekrutiert aus Freiwilligen - der Ruhrkonflikt war zum Pulverfaß geworden.
Gerade die Aktionen der Nationalisten verdeutlichen den fließenden Übergang vom passiven zum aktiven Widerstand. Die Grenze zwischen beiden ist schwierig zu definieren. Eindeutig wird es aber, wenn es um Terrorakte, wie Attentate auf belgische oder französische Soldaten, Bahn - oder Brückensprengungen, geht.
Bei solchen Terrorakten, die oftmals nur zur Einschüchterung dienten, bezahlten unbeteiligte Menschen mit ihrem Leben. Die Folge waren wiederum französische Strafmaßnahmen, unter denen ebenfalls Unbeteiligte leiden mußten. Eine Gewaltspirale, die Frankreich aufgrund seiner militärischen Präsenz gewinnen mußte.
Zur Gallionsfigur des aktiven Widerstands wurde, besonders später, im Dritten Reich, Albert Leo Schlageter stilisiert, der nach einem mißglückten Sprengversuch an der Bahnlinie Duisburg-Düsseldorf vom französischen Kriegsgericht zum Tode verurteilt und am 26. Mai 1923 erschossen wurde. Paradoxerweise bemühten sich Kommunisten wie rechtsextreme Nationalisten um die Gallionsfigur Schlageter, der für viele zum Volksheld avancierte. Am 20. Juni würdigte Karl Radek Schlageter als einen ,,Märtyrer des deutschen Nationalismus" und ,,mutigen Konterrevolutionär".36 Der Kurs, den die deutschen Kommunisten nun einschlugen, läßt sich am besten mit dem Begriff ,,Nationalbolschewismus" belegen.37 Auch hier läßt sich die Intransigenz beider Seiten an der pauschalen Aburteilung von vermeintlichen oder tatsächlichen Verrätern ablesen, die der französischen Verurteilung von Saboteuren in nichts nachstand.
Im Gegensatz zum passiven war der aktive Widerstand nicht von der Reichsregierung abgesegnet worden. Aus bereits erwähnten Gründen paßte er nicht in die Politik der ,,weißen Weste", die als Selbstdarstellung englische oder amerikanische Loyalität wecken sollte. Er mußte der Reichsregierung ein Dorn im Auge sein, zumal Teile der Reichswehr mit Hilfe von Sprengstoff und finanziellen Mitteln den Terrorismus unterstützten. Dennoch unternahm die Reichsregierung "[...]nichts, um die Terroristen, die doch auf Unterstützung aus dem unbesetzten Deutschland angewiesen waren, an der Ausführung ihrer Aktionen zu hindern,[...]"38, was wiederum natürlich der deutsch-englischen Annäherung abträglich war.
In den Widerstand, passiv oder aktiv, mischten sich durchaus auch innenpolitische Interessen. Es war nicht nur ein Kampf gegen Frankreich, der anfangs innenpolitische Gegensätze zu überbrücken schien und dann in der Stilblüte des Schlageter-Brückenschlag zwischen links und rechts kulminierte.
Der Ruhrkampf wurde zunehmend auch zum Profilierungsfeld antirepublikanisch Gesinnter. Während sich die an der Cuno-Regierung unbeteiligte SPD, sowie die Gewerkschaften aufgrund der errungenen sozialen Rechte hinter den passiven Widerstand stellten, zeigten sich Kommunisten und Rechtsradikale wesentlich opportunistischer. Hitler schwang sich mit seiner Gefolgschaft zum Verteidiger der deutschen Ehre auf, die er durch die Regierung geschändet sah. Der Appell an nationalistische Gefühle war eines der naheliegendsten und zugleich billigsten Mittel - gerade in diesem Tanz auf dem Vulkan - um Sympathisanten hinter sich zu scharen. Auf der anderen Seite standen die Kommunisten, die den Ruhrkampf auf ihre alte Parole des Klassenkampfes zurechtreduzierten: Die Ruhrbesetzung sei eine kapitalistisch-imperialistische Maßnahme der Franzosen, gegen welche man sich genauso zur Wehr zu setzen habe wie gegen die von Cuno ausgegebene Parole des passiven Widerstandes, die nur zu Lasten des Proletariats gehe: ,,Schlagt Poincaré an der Ruhr und Cuno an der Spree"39. Die Kommunisten erhielten, Resultat von Rapallo, Unterstützung durch die Sowjetunion, die Unterstützung finanzieller und administrativer Art in Form von Agenten über die Grenze schleusen konnte. Selbst französische Kommunisten - wiederum eine Stilblüte - versuchten ihre deutschen Genossen im Kampf um die Weltrevolution zu unterstützen.
Ironischerweise war der Kampf gegen den Kommunismus, der durch die sich beiderseitig zunehmend verschlechternde wirtschaftliche Situation Zulauf bekam, das einzig verbindende Element zwischen Frankreich und Deutschland - selbst auf dem Höhepunkt des Ruhrkampfes.
Die Folgen des Ruhrkampfes
Der passive Widerstand hatte in den ersten beiden Monaten des Jahres 1923 erfolgreich die Pläne der Besatzungsmächte durchkreuzen können: Von Januar bis Februar hatte Frankreich gerade einmal 4800 Tonnen Ruhrkoks erhalten, eine Menge, die vor der Ruhrbesetzung zwei Tageslieferungen ausgemacht hatte- und das bei zunächst unverminderter Förderung. Es war gelungen, Kohle an der französischen Zollgrenze vorbei ins unbesetzte Deutschland zu schmuggeln. Ein Teil der Kohle konnte sogar ans neutrale Ausland verkauft werden, so daß der militärische Klammergriff auf Deutschlands Industrie nicht wie beabsichtigt funktionieren konnte.
Frankreich mußte nicht nur auf Reparationsgelder und große Teile der Kohlelieferungen verzichten, der Boykott des lothringischen Erzes schlug außerdem zu Buche. Zu diesen Ausfällen kam aber noch eine Belastung hinzu: Die Kosten der Ruhrinvasion wurden in den ersten Monaten auf 40 bis 50 Millionen Franc geschätzt, die nun auch noch die Staatskasse und mit ihr die Währung belasteten.
Auf der anderen Seite wurde die deutsche Staatskasse durch die Unterstützung des Ruhrkampfes belastet: Im unbesetzten Deutschland wurden die Bezüge öffentlich Bediensteter auf zwei Drittel reduziert, weil die sich im Zwangsausstand befindende Ruhrbevölkerung ernährt werden mußte. Die Kohlelieferungen ans unbesetzte Deutschland verringerten sich von Tag zu Tag, je stärker die französische Kontrolle wurde. Die zur Widerstands-Finanzierung notwendigen Devisen durch den Kohlehandel blieben aus, man sah sich gezwungen, ausländische Kohle einzukaufen.
Demgegenüber konnte Frankreich seine Defizite durch die Beschäftigung eigener (und polnischer) Bergarbeiter und Eisenbahner, sowie der Errichtung der ,,Regiebahn" (ein von Deutschland unabhängiges Transportmittel) mindern. Das Tauziehen um den längeren Atem war im Prinzip schon früh von der deutschen Seite aus verloren, dennoch war die Regierung Cuno nicht bereit, den passiven Widerstand abzubrechen. Man sah in der Ruhrbesetzung eine klare Verletzung des Versailler Vertrages und hoffte auf ein englisch-amerikanisches Einwirken auf Frankreich, ohne jedoch auf irgendwelche Pläne zurückgreifen zu können.40 Zu Verhandlungen war man nicht bereit, man konnte lediglich Protestnoten zur diplomatischen Gegenwehr heranziehen, die dann auch eifrig hin- und hergeschickt wurden. Beide Parteien bezichtigten sich gegenseitig der Verletzung des Versailler Vertrags, auf den sich beide beriefen, um die Weltöffentlichkeit auf die Legitimität ihres jeweiligen Vorgehens aufmerksam zu machen.
Im passiven Widerstand drückte sich die passive Grundhaltung der Regierung Cuno aus, die auch die Außenpolitik bestimmte. Man verharrte in einer Erwartungshaltung, ohne eine ,,[...] Basis für effektive Politik gegenüber Großbritannien und den USA (zu) entwickeln - den Staaten, auf deren Wohlwollen es in der Frage der Ruhrbesetzung entscheidend ankam."41 Doch diese beiden Staaten verhielten sich reserviert. Daran konnten auch deutsche Reparationsangebote vom 2.5. und 7.6. 1923 nichts ändern, die als erste Ansätze zur Beendigung des Konfliktes angesehen werden können.
Denn die Widerstandsmoral verschlechterte sich angesichts der rapiden Geldentwertung täglich. Die Lohnerhöhungen konnten den sinkenden Wert der Mark nicht ausgleichen, die Bedienung der Banknotenpresse trieb die Währung in die Hyperinflation. Die Reichsbank griff vergeblich auf eigene Goldreserven, die sie durch die Einbehaltung von Reparationszahlungen hatte, zur Stützung der Währung zurück. Die Entwicklung des amtlichen Dollarkurses im Juni zeigt es: Am 1. Juni 1923 lag er bei 74 750 Mark, am 28. Juni bei 150 000 Mark.
Die patriotische Durchhaltemoral wurde mehr und mehr unterwandert, im Ruhrgebiet begann man, sich mit den Besatzungsmächten zu arrangieren. Pabst sieht die Initialzündung für diese langsame Wendung im Verhalten der Rheinländer, die als erste Abstand vom passiven Widerstand nahmen: ,,Die Rheinländer kannten ihre Besatzung seit Jahren und wußten, daß sie auch nach einer Räumung der Ruhr noch lange Zeit mit ihr auskommen mußten. Sie wollten den Widerstand daher nicht überspitzen und traten für eine erträgliche Regelung der Beziehungen zu Belgien und Frankreich ein"42 Das Rheinland spielte schließlich im Ruhrkonflikt eine Sonderrolle, da das Gerücht kursierte, es gäbe französische Pläne zur Abtrennung des Rheinlands. Tatsächlich gab es in den Personen Marschall Fochs und des Hohen Kommissars Tirard Befürworter einer aktiven Rheinlandpolitik43, die bereit waren, existierende separatistische Bewegungen zu unterstützen. Doch von offizieller Seite aus wurde eine solche Politik nicht forciert.
Gastwirte und Kleinhändler waren es, die als erste den passiven Widerstand abbrachen, da sie nicht, wie Arbeiter und Beamten, vom Staat finanziert wurden. Sie standen teilweise kurz vor dem Ruin und hatten daher keine andere Wahl als die des Arrangements mit den Besatzern. Die Waagschale neigte sich langsam zugunsten Frankreichs. Während Frankreich die Kohlelieferungen - wenn auch nicht im gewünschten Umfang - wieder steigern konnte, wurde die Finanzierung des Kampfes zum unüberschaubaren Problem für Deutschland. Die Regierung Cuno versäumte es, durch Steuererhöhungen die finanzielle Last abzumildern. Statt dessen wurden die täglich wachsenden Kosten mit der Notenpresse ,,bekämpft", ein Unterfangen, das zur bekannten Hyperinflation dieser Jahre führte. Leidtragende waren hauptsächlich Lohn- und Gehaltsempfänger, deren Reallöhne ständig sanken. Der soziale Zündstoff, der hieraus erwuchs, entlud sich teils im aktiven Widerstand, gewalttätigen Streiks, oder er richtete sich gegen die Republik selbst, wodurch separatistische Bewegungen Zulauf bekamen.
Die Untätigkeit der Regierung Cuno tat in den Augen der Bevölkerung ihr Übriges. Die einzigen beiden Zeugnisse Cunoscher Außenpolitik, die Reparationsangebote vom 2.5. und 7.6. 1923 waren zum Scheitern verurteilt. Ersteres, weil Cuno in Verkennung der Lage den Alliierten ein für sie unverschämt niedriges und damit unannehmbares Angebot machte. Cuno hatte den innenpolitischen Vorwurf der Untätigkeit und eine Oberhausrede Lord Curzons vom 20.4., in der von Deutschland der erste Schritt verlangt wurde, zum Anlaß genommen, in der Note den Reparationshöchstwert auf 30 Milliarden Goldmark festzusetzen. Frankreichs geforderte Garantien spielten hier gar keine Rolle. Statt dessen glaubte man, selber Bedingungen stellen zu können: Dieses ,,Angebot" war unter anderem an die Räumung des Ruhrgebietes und der Gewährung wirtschaftlichen und politischen Handlungsspielraumes geknüpft.
Das zweite Angebot kam zum falschen Zeitpunkt: Im Juni zeigten sich erste Erfolge der Ruhrbesetzung, so daß Frankreich keine weiteren Verhandlungen mehr nötig hatte. Dabei sprach hier ein kooperativeres Deutschland: Man erklärte sich bereit, seine Wirtschafts- und Finanzlage zum Zwecke der Beurteilung durch Experten offenzulegen. Darüber hinaus gestand man den Allierten zu, die Reichsbahn, Zölle und Verbrauchssteuern als Pfand in Beschlag zu nehmen.44 Vom Abbruch der Ruhrbesetzung war hier nicht mehr die Rede, auch wurde keine Gesamtsumme genannt, die die Alliierten hätte provozieren können. Für Verhandlungen war es aber zu spät; ähnlich wie 1918 vermochte wieder einmal eine Reichsführung nicht zu erkennen, wann sie verloren hatte und wann es Sinn hatte, Angebote zu machen. Das Kabinett Cuno sah in der nationalen Welle die Legitimation ihrer Politik und weigerte sich, Verhandlungsvorschläge der deutschen Wirtschaft zu unterstützen. Trotz einiger Andeutungen englischer Diplomaten bezüglich der Unvermeidbarkeit der bedingungslosen Aufgabe des passiven Widerstandes hielt man halsstarrig an ihm fest und führte die Republik in ihre schwerste Existenzkrise seit ihrer Gründung. Arbeitslosigkeit, Hunger und soziale Not führten zu inneren Auseinandersetzungen und drohten der jungen Demokratie die Basis zu entziehen. Der Verfall der Währung und die immer bedrohlicher werdende Lebensmittelversorgung der Bevölkerung wurde dem Kabinett Cuno zur Last gelegt und führte dazu, daß sich der Burgfriede der Parteien nach und nach auflöste. Im August 1923 stellte die SPD die Forderung an Cuno, er solle zurücktreten. Cuno nahm, ermattet wie schon sein Vorgänger Wirth, das Rücktrittsgesuch an und legte sein Amt am 13. August nieder.
Stresemann und der Abbruch des Ruhrkampfes
Das bestenfalls hölzern agierende Kabinett Cunos gab sich selber zu einem Zeitpunkt auf, als ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont auftauchte: Am 11.8.1923 hatte Lord Curzon die Besetzung des Ruhrgebietes für illegal erklärt. Nie zuvor hatte sich England derart deutlich von Frankreichs Politik distanziert. In seiner Note forderte Curzon die Einsetzung einer unabhängigen Sachverständigenkommission zur Festsetzung der Reparationsschuld. Auch dies war eine deutliche Absage an Frankreich.
Für Poincaré war die Niederlage Cunos die Niederlage des passiven Widerstands, er war kurz vor seinem Ziel, der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands.
Cunos Nachfolger wurde der Vorsitzende der DVP, Gustav Stresemann. Als er das Amt des Reichskanzlers antrat, wußte Stresemann um die Notwendigkeit des Abbruchs des Widerstandes, dennoch kämpfte er bis in den September 1923 hinein um die Modalitäten. Die Curzon - Note hatte mit ihrer Verurteilung des französischen Vorgehens einen Hoffnungsschimmer erzeugt - England hatte erkannt, daß die Hyperinflation in Deutschland nicht ohne Folgen für die eigene, exportorientierte Wirtschaft sein konnte. Es war dies der endgültige, weil offizielle, Bruch der Entente. Frankreich war, von seinen östlichen Verbündeten einmal abgesehen, isoliert. Doch der Hoffnungsschimmer dauerte, sofern er sich auf Frankreichs Rückzug bezog, nicht lange an: Am 20 August 1923 erneuerte Paris in seiner Antwortnote die Forderung nach Rhein- und Ruhrgebiet als territorialen Pfändern. Wer, wie in diesem Fall Frankreich, so kurz vor dem Ziel steht, der gibt nicht auf. Hagen Schulze resümmiert: ,,Es zeigte sich jetzt, was ein politischer Streik gegen einen entschlossenen Gegner vermag, der die Gewehre besitzt und zum Schießen bereit ist: nichts."45 Die Finanzierung des Widerstands trieb die deutsche Staatskasse in den Bankrott46, die Staatsverschuldung wuchs ins Unermeßliche, die Hyperinflation rief besonders den Mittelstand auf den Plan, da er durch den Wertverfall seiner Sparguthaben am härtesten getroffen wurde.
Das Reich fand sich in seiner bis dato schlimmsten Krise: Die Ruhrbesetzung und der mit ihr verbundene Widerstand führten zu Versorgungsengpässen bei Kohle und Lebensmitteln. Deutsche Großgrundbesitzer und Bauern horteten angesichts der Inflation und in Hoffnung auf eine Währungsreform ihre Erzeugnisse. Der Ruhrkonflikt, der zunächst auf dem Rücken der Ruhrbevölkerung ausgetragen wurde, wurde nun für die gesamte deutsche Bevölkerung spürbar. Eine Fortsetzung des bereits bröckelnden Widerstands wäre angesichts der bevorstehenden Hungersnot unverantwortlich gewesen.
Der Abbruch des Widerstands brachte aber andere Probleme mit sich. Einerseits war er Wasser auf die Mühlen der antidemokratisch - antirepublikanischen Propaganda, die jeder Reichsregierung mindestens Schwäche, wenn nicht sogar willentliche ,,Erfüllungspolitik" (bei Verkennung ihres Zwecks) und somit Demontage vorwarfen. Die Mitwirkung der SPD an der Regierung Stresemann provozierte die politische Rechte und bereitete ihre Sündenbockrolle für die Niederlage im Ruhrkonflikt vor.
Andererseits kam der Abbruch einer bedingungslosen Kapitulation gleich, bei der nicht nur die Sorge um die Abtretung des Rheinlands an Frankreich eine Rolle spielte. Es ging um die Verteidigung der Ausübung einer eigenständigen Politik und um die Wahrung einer künftigen Großmachtrolle.
Aus diesen Gründen bemühte sich Stresemann um eben jene Bedingungen, die einen Abbruch innenpolitisch vertretbar und verantwortbar machen konnten.
In einem Gespräch mit dem belgischen Gesandten della Faille am 16.9.1923 zählte Stresemann zu seinen Konzessionen ,,[...] 1. die Rückkehr der vertriebenen Beamten und Arbeiter innerhalb einer angemessenen Frist, 2. eine allgemeine Amnestie und 3. eine Reduktion der Okkupationstruppen."47
Die Curzon - Note und die völlige Zurückhaltung der USA hatten ihn ermutigt, auf eine aktivere englische Politik und auf eine französische Verhandlungsbereitschaft zu hoffen . Doch der Note folgten keine Taten.48
Stresemann bemühte sich sechs lange Wochen um eine englische Vermittlung und um eine französische Verhandlungsbereitschaft. Als am 19. September 1923 der englische Premierminister Baldwin bei seinem Besuch in Paris Poincaré konsultierte, um die durch die Curzon - Note entstandenen Eindrücke zu revidieren, war der Beweis erbracht, daß man auf englische Unterstützung nicht hoffen konnte: ,,Nach einer Begegnung zwischen Poincaré und dem neuen, seit Ende Mai amtierenden konservativen Premierminister Baldwin in Paris verlautete aus der dortigen Botschaft Großbritanniens, in keiner Frage gebe es zwischen den beiden Ländern grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten."49 Poincarés Unnachgiebigkeit50 tat ihr Übriges: Am 26. September 1923 beendete Stresemann, ohne etwas zur Milderung der Umstände erreicht zu haben, offiziell den passiven Widerstand. Die Beamten und Unternehmer wurden angewiesen, den Anordnungen der Besatzungsmächte Folge zu leisten und zu kooperieren. Deutsche Arbeiter wurden nach eingehender Prüfung ihrer politischen Haltung durch die französische Polizei wieder eingestellt.
Konsequenzen des Abbruchs
a) Innenpolitik
Nicht nur die deutsche Öffentlichkeit begriff dies als die zweite schwere Niederlage des Reichs, die zweite bedingungslose Kapitulation.
,,Das deutsche Volk fordern wir auf, in den bevorstehenden Zeiten härtester seelischer Prüfung und materieller Not treu zusammenzustehen. Nur so werden wir alle Absichten auf Zertrümmerung des Reiches zunichte machen, nur so werden wir der Nation Ehre und Leben erhalten, nur so ihr die Freiheit wiedergewinnen, die unser unveräußerliches Recht ist!"51 Stresemanns Aufruf zum Abbruch des passiven Widerstandes deutete bereits die bevorstehenden innenpolitischen Probleme an.
Die ,,Zertrümmerung des Reiches" spielt auf die erstarkenden separatistischen Bewegungen im Rheinland an, die von Frankreich nicht nur gern gesehen, sondern ,,wahrscheinlich von der Besatzungsmacht unterstützt wurden, [...]"52 Bariéty sieht in der wirtschaftlichen und sozialen Not der Bevölkerung den Auslöser für diesen Verlust des nationalen Gewissens.53 Obwohl die Separatisten nur auf einen geringen Rückhalt in der Bevölkerung setzen konnten, bestand doch der Anlaß zur Befürchtung, die wachsende Not und Unzufriedenheit mit der Regierung könne dieser Bewegung zuträglich sein: ,,Die Separatisten unternahmen seit dem 21. Oktober in verschiedenen Orten, darunter Aachen, Trier, Koblenz, Bonn und Wiesbaden, Versuche, eine ,,Rheinische Republik" auszurufen, und konnten sich dabei überall des aktiven Schutzes der französischen und belgischen Behörden erfreuen."54
Neben den separatistischen Aktionen bedrohten weitere Umsturzversuche den nationalen Zusammenhalt: In Bayern war noch am Tage des Abbruchs der Ausnahmezustand verhängt und die Exekutive dem Regierungspräsidenten von Kahr übertragen worden. Von Kahrs antirepublikanisch-nationale Gesinnung war der Reichsregierung bekannt. Aus Sorge vor einer Kette von Umsturzversuchen, die dem bayrischen Beispiel hätten folgen können, verhängte sie nun ihrerseits einen Ausnahmezustand über das Reich. Die bayrische Regierung genoß aufgrund ihres lauten Protestes gegen Versailles flächendeckende Sympathien im Reich. Selbst Teile seiner eigenen Partei versagten Stresemann die Unterstützung, man lehnte die Große Koalition, nicht zuletzt wegen der Teilnahme der SPD, rundweg ab. Am Beispiel Bayerns läßt sich der Ernst der innenpolitischen Bedrohung ablesen; im Moment der Krise offenbart sich der Opportunismus der politischen Extremen, denen alles recht ist, um ihre Macht auf Kosten der staatstragenden Mitte zu vergrößern: In den Kreisen um von Kahr sprach man vom ,,Marsch nach Berlin", von dem man sich die Erpressung bayrischer Sonderrechte und somit die Stärkung eigener Interessen. Im Schatten von Kahrs agierte bereits Adolf Hitler, für den ,,[...] Bayern das Sprungbrett (war), um sich der Zentralgewalt zu bemächtigen."55
Am Abend des 8. November 1923 gab Hitler seine Trittbrettfahrerrolle auf und inszenierte im Münchner Bürgerbräukeller einen Putsch. Die dort anwesenden Anhänger von Kahrs wurden regelrecht überfallen und sollten sich unter vorgehaltener Waffe zu Hitlers ,,Nationalen Revolution" bekennen. Die Mitglieder der bayrischen Regierung wurden kurzerhand verhaftet, jedoch noch in derselben Nacht von Ludendorff, der von Hitler zum Oberbefehlshaber der Nationalarmee ernannt worden war, wieder freigelassen. Hier wird der Einfluß der alten Kräfte deutlich, die die neue Republik nicht anerkennen und daher zerstören wollten. Interessant ist außerdem, daß Stresemann, einst selber Annexionist und Anhänger Ludendorffs, sein ehemaliges Vorbild nun zum Gegner hatte.
Dem Dilettantismus des Putsches ist es zu verdanken, daß Hitler bereits am 11. November 1923 von der bayrischen Landespolizei verhaftet und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt werden konnte.
Hitler hatte die deutschnationale Fraktion um von Kahr für seine eigenen Ziele benutzen wollen und durch seine Niederlage nicht nur sich selbst, sondern auch seinen ,,Wirt", dessen er sich parasitär bediente, entscheidend geschwächt, denn von Kahrs Autorität und Ansehen waren durch diesen Zwischenfall stark angekratzt worden. Somit hatte Hitler unfreiwillig zur Entschärfung des Konfliktes Bayerns mit dem Reich beigetragen, dessen historische Bedeutung Erdmann darin sieht, ,,[...] daß zum ersten Mal das Verhältnis von bürgerlich- konservativem und revolutionärem Nationalismus auf die Probe gestellt wurde."56
Die Reichsregierung hatte am 26. September ihrerseits den Ausnahmezustand über das gesamte Reich verhängt; auf Hochverrat, Brandstiftung, Sprengstoffanschläge und Beschädigung von Eisenbahnanlagen stand die Todesstrafe. Die Exekutive wurde dem Reichswehrminister übertragen, der sie wiederum an die Militärbefehlshaber delegierte. Obwohl dies aus demokratischer Sicht moralisch bedenklich war, denn große Teile der Reichswehr waren nur halbherzig loyal zur Reichsregierung, hatte Stresemann keine andere Wahl, als auf die alten Mächte zurückzugreifen, wenn er das Reich gegen die äußerste Linke bzw. Rechte verteidigen wollte.
Die Beispiele Sachsen und Thüringens zeigen das: Seit dem 10. bzw. 16. Oktober koalierten hier erstmalig Sozialdemokraten mit Kommunisten. Es hatte sich eine bewaffnete linke Einheitsfront gebildet, die die Gefahr eines kommunistischen Aufstands herauf beschwor. Aus diesem Grund verbot am 13. Oktober der sächsische Wehrkreisbefehlshaber die Proletarischen Hundertschaften und stellte die sächsische Polizei unter die Befehlsgewalt der Reichswehr. Für WInkler bedeutet das: ,,Der sächsischen Regierung war damit ihr einziges wirkliches Machtinstrument entzogen und eine Reichsexekution gegen Sachsen, ohne daß sie formell beschlossen worden wäre, bereits an ihr Ziel gelangt."57
Die KPD Sachsens schmiedete Pläne für einen ,,deutschen Oktober", Stresemann wurde als Handlanger des Ruhrkapitals beschimpft. Doch der Generalstreik, der als Antwort auf den Ausnahmezustand gedacht war, erhielt auf der Arbeiterkonferenz in Chemnitz keine Zustimmung, die SPD wahrte ihre Loyalität zur Reichsregierung und drohte mit dem Auszug. Dennoch kam es zu einem Reichswehreinmarsch in Sachsen, ohne daß das Kabinett Stresemann einen ausdrücklichen Befehl dazu gegeben hätte. Erst Ende Oktober 1923 setzte Stresemann eine Reichsexekution gegen Sachsen durch, er hatte Ebert von der Notwendigkeit der Absetzung der sächsischen Regierung überzeugen können. Mit dieser politischen Maßnahme konnte Stresemann der Reichswehr den Wind aus den Segeln nehmen, die dabei war, zu einem innenpolitischen Machtfaktor aufzusteigen. Dennoch sollte die Regierung Stresemann über eben diese Ereignisse stürzen: Teile der SPD waren über den gewaltsamen Eingriff in die sächsische Politik - auch und gerade im Vergleich zum Vorgehen gegen Bayern - verärgert. Sachsens Regierung war abgesetzt, doch von Kahr durfte weiterregieren. Diese Ungerechtigkeit aus sozialdemokratischer Sicht nahm die SPD zum Anlaß, ein Mißtrauensvotum zu stellen, ohne Stresemann wirklich stürzen zu wollen.58 Die DNVP, die hingegen ein ernsthaftes Interesse daran hegte, nutzte die Chance der Stunde und beteiligte sich an diesem Antrag. Stresemann nahm ihn an und verlor. Den Vertretern der SPD, die dieses veranlaßt haben, muß man einen mangelnden politischen Weitblick vorwerfen, verursacht durch verletzte Eitelkeit oder durch eine übereilte emotionale Reaktion. Eberts Äußerung, gerichtet an seine Parteifreunde, unterstreicht das und bekommt geradezu prophetischen Charakter: ,,Was euch veranlaßt, den Kanzler zu stürzen, ist in sechs Wochen vergessen, aber die Folgen eurer Dummheit werdet ihr noch zehn Jahre lang spüren."59
b) Außenpolitik
Der Abbruch des Widerstands brachte also zunächst einmal keine Vorteile, sondern nur innenpolitische Konflikte und Krisen, zumal das wirtschaftliche Elend im Ruhrgebiet zunahm. Die zwei Millionen Arbeitslosen, die bisher eine Lohnausfallentschädigung erhalten hatten, mußten sich jetzt mit der wesentlich niedrigeren Erwerbslosenunterstützung begnügen, in einer Zeit, in der die Kaufkraft der Mark bereits ins Bodenlose gefallen war. Dennoch brachte die Beendigung des Widerstands Deutschland in eine bessere Ausgangsposition gegenüber England und den USA. Deutschland hatte seine Schuldigkeit getan und konnte sich nun auf den Versailler Vertrag berufen, wobei man mit einem Auge auf englisch-amerikanische Unterstützung schielte: ,,Von da an konnte die einer Kapitulation gleichkommende bedingungslose Aufgabe des Widerstands - auf weniger ließ sich die französische Regierung nicht ein - sogar ein diplomatisches Druckmittel für die Deutschen werden, um die anderen Mächte zur Eile anzutreiben."60
Frankreich war zwar formal als Sieger aus dem Ruhrkampf hervorgegangen, doch es hatte sich zunehmend in die Isolation begeben, denn die ,,[...] Alliierten verhielten sich bestenfalls skeptisch-abwartend, die angelsächsischen Mächte traten den französischen Plänen entgegen."61 Gerade England hatte ein Interesse an einem in sich gefestigtem Deutschland, denn das Reich war ein international bedeutsamer Handelspartner, dessen wirtschaftliches Potential weder zusammenbrechen noch in französische Hände gelangen durfte. Das war die einzige Trumpfkarte, die Stresemann zunächst ausspielen konnte- die englische Sorge um eine wirtschaftliche Hegemonialstellung Frankreichs: ,,Die britische Regierung fürchtete die Folgen einer derartigen deutsch-französischen Wirtschaftsverbindung und war im Grunde bereits entschlossen, die Reparationsverpflichtungen im Sinne einer Verringerung zu revidieren."62 Stresemanns vorrangiges Ziel war es nun, England und die USA auf den Plan zu bringen, ohne allerdings eine Spaltung der Alliierten zu bewirken, denn England konnte nur dann auf Frankreich Einfluß nehmen, solange eine Verständigungsbasis bestand. Sein Ziel war, Kooperationsbereitschaft zu signalisieren und über eine interalliierte Verständigung eine Revision von Versailles herbeizuführen.
Gerade aus englischer Sicht drängte die Zeit, es bestand Handlungsbedarf, denn nach Beendigung des Ruhrkampfes stand eine Neuordnung der Machtverhältnisse in Europa auf dem Spiel (Frankreichs Politik bzgl. der Separatistenaufstände war ein zusätzlicher Ansporn für eine englische Initiative). Man wollte Frankreich nicht das Feld alleine überlassen, doch es fehlten die Mittel zum direkten Eingriff - für eine Initiative zur Regelung der Reparationsfrage, die nun verschärft im Mittelpunkt stand, war England selbst zu schwach. Frankreichs starre Weigerung gegenüber Verhandlungsangeboten ließen Lloyd George und Curzon Kontakt mit den USA aufnehmen. Man bezog sich auf den Hughes-Plan von 1922 und wollte die Reparationsfrage durch ein internationales, unabhängiges Expertengremium prüfen lassen. Poincaré hatte sich noch Mitte Oktober 1923 geweigert, eine solche Kommission anzuerkennen, doch am 25. Oktober stimmte er ihr zu. Frankreich wurde mehr und mehr in die Isolation und Defensive gedrängt63, so daß Poincaré Konzessionen machen mußte, wollte er auf internationaler Ebene mitreden. England hatte bereits signalisiert, daß ein Zusammenbruch Deutschlands das Ende des Versailler Vertrags bedeuten würde. Zudem wurde Poincaré mit einem Angebot der Amerikaner förmlich gelockt, wie bei Winkler nachzulesen ist: ,,Am 23. Oktober hatte ihm [Poincaré] Außenminister Hughes zu erkennen gegeben, daß Amerika eine französische Beteiligung an der interalliierten Expertenkommission honorieren würde. Die USA erklärten sich erstmals bereit, die Diskussion der Reparationsfrage mit dem interalliierten Schuldenproblem zu verbinden. Frankreich durfte also erwarten, daß es durch eine gewisse Konzilianz gegenüber seinem Schuldner Deutschland seine eigene Position als Schuldner der USA verbessern würde."64 Hughes Angebot war das Resultat des Drucks aus amerikanischen Wirtschaftskreisen, die ihn auf die negativen Auswirkungen der französischen Rhein- und Ruhrpolitik für amerikanische Wirtschaftsinteressen aufmerksam gemacht hatten.65 Eine aktive amerikanische Europapolitik hatte es nämlich seit der (Nicht-) Unterzeichnung des Versailler Vertrags nicht gegeben, man hatte sich weitgehend zurückgezogen und verharrte in einer abwartenden Haltung, während in Europa der Kalte Krieg herrschte, dessen nicht unwesentlicher Faktor das Problem der Tilgung amerikanischer Kredite war.
Damit nun Frankreichs Zustimmung zur Bildung einer Sachverständigenkommission nicht zum Gesichtsverlust für Poincaré wurde, berief man auf seinen Wunsch hin ein zweites Komitee ein, welches die deutschen Auslandsguthaben zu untersuchen hatte. Ersterem Gremium, welches sich mit Reparationsfrage auseinandersetzte, maß man aber eine wesentlich größere Bedeutung bei. Sein Vorsitzender war der amerikanische Bankier Charles G. Dawes.
Auf dem Weg zum Dawes-Plan
Die deutsche Ausgangsposition schien sich nach und nach zu verbessern: Im Dezember 1923 gab es einen Regierungswechsel in London, erstmalig stellte die Labour Party mit Ramsay MacDonald einen Regierungschef. Gerade aus den Reihen der Labour-Party hatte es die heftigsten Kritiken zur französischen Außenpolitik gegeben, für Deutschland war dies ein Zeichen der Hoffnung auf baldige englische Unterstützung. Auch die bilateralen Beziehungen zu den USA wurden gerade in der Ära Stresemann verstärkt gepflegt, man war einerseits auf amerikanische Kredite angewiesen, andererseits war die Kreditfrage und der Wiederaufbau des deutschen Marktes eine Möglichkeit für die USA, sich wieder an der europäischen Politik zu beteiligen, was für Deutschland zunächst nur förderlich sein konnte. Doch es galt auch, sich für eine amerikanische Unterstützung zu empfehlen: Der desolate Zustand der Währung, die Inflation, sie boten Deutschland nicht gerade als Investitionsziel an. Um den guten Willen zu demonstrieren, wurde am 15. November 1923 die Rentenmark eingeführt, deren Wert durch Schuldverschreibungen zu Lasten der Industrie und Landwirtschaft gedeckt wurde. Das Umtauschverhältnis betrug 1 Rentenmark zu 1 Billion Papiermark, wodurch die Währung ihren Vorkriegsstand erreichte. Es war ein notwendiges Entgegenkommen ihren zukünftigen Kreditgebern gegenüber, was die Reichsregierung hier praktizierte, sorgte diese Maßnahme doch für ein neues Vertrauen in die deutsche Zahlungswilligkeit. Der Regierung Stresemann war es gelungen, der Inflation ein Ende zu setzen und somit den Grundstein für den wirtschaftlichen Wiederaufbau zu legen, worüber sich die innenpolitische Situation entspannen sollte.
Der November des Jahres 1923 setzte also einen Schlußstrich unter einige innenpolitische Probleme: der passive Widerstand war beendet, der rheinische Separatismus weitestgehend gebannt, der ,,deutsche Oktober" verhindert, der monarchistische Umsturzversuch Kahrs, sowie der nationalsozialistische Putsch Hitlers vereitelt und eine Sanierung der Währung in die Wege geleitet worden.
Um die neue Währung zu stützen, mußten aber die Auslandszahlungen verringert und die wirtschaftliche Ausbeutung des Ruhrgebiets durch französische Hand begrenzt werden. Die Zeit drängte, denn Frankreich schien sein Ziel erreicht zu haben: ,,Frankreich beherrschte nun nicht nur das Rheinland, sondern die gesamte westdeutsche Wirtschaft, insbesondere die Kohleindustrie."66 Die westdeutsche Wirtschaft hatte nachgegeben und Verträge mit der MICUM abgeschlossen, ein Warnsignal für England und die USA, daß sich der Zustand an Rhein und Ruhr zugunsten Frankreichs konsolidierte. Die Reichsregierung versuchte auf ihre Art und Weise dem entgegenzuwirken: Mitte Dezember 1923 trat man in Verhandlungen mit Paris und Brüssel ein, um Regelungen für das besetzte Gebiet zu erkämpfen, die dieses nicht weiter überfremden lassen sollten. Hinter diesem direkten Handeln verbarg sich aber wieder einmal auch die Absicht, Kooperationsbereitschaft zu demonstrieren. So unterließ man es auch nicht, England über den jeweiligen Stand der Verhandlungen zu informieren, um einerseits die eigene Glaubwürdigkeit zu unterstreichen und andererseits Englands Einsatz zu erwirken.
Im Januar 1924 trat in Berlin ein Sachverständigengremium, bestehend aus englischen und amerikanische Bankiers, unter der Leitung von Charles G. Dawes zusammen. Sein Ziel war die Überprüfung der wirtschaftlichen Situation und der Zahlungsfähigkeit Deutschlands. Schulze skizziert den Tenor des am 9.April ausgegebenen Gutachtens kurz: ,,Deutschland müsse zahlen, aber es müsse dazu auch imstande sein."67 Diese Quintessenz deutet bereits den Inhalt des als ,,Dawes-Plan" bekannten Werks an: Zur Gesundung der deutschen Wirtschaft wurde eine internationale Anleihe von 800 Millionen Goldmark in Aussicht gestellt, mit Hilfe derer eine neue Notenbank geschaffen und die Währung stablisiert werden sollte. Für die deutschen Reparationszahlungen wurde zwar keine Gesamtsumme genannt, sie wurden jedoch zunächst auf eine Milliarde, für die folgenden fünf Jahre auf bis zu 2,5 Milliarden jährlich festgesetzt. Als Zahlungsgarantie diente die Reichsbahn, die in ein alliierter Kontrolle unterstelltem Unternehmen umgewandelt wurde. Darüber hinaus wurden Zölle und Verbrauchssteuern verpfändet, sowie die Industrie mit einer verzinslichen Hypothek in Höhe von 5 Milliarden Mark belastet.
So tief die Einschnitte in die deutsche Souveränität auch waren - die Kernidee des Dawes- Plans war, den wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands als Teil des Wiederaufbaus Europas zu betrachten. Der Dawes-Plan sah die wirtschaftliche Einheit Deutschlands vor, Frankreich hatte also seine Truppen aus dem Ruhrgebiet zurückzuziehen. Eines der Hauptziele deutscher Revisionspolitik schien nah. Die Ruhrinvasion hatte auch Frankreich an seine finanziellen Grenzen gebracht. Um den Wertverlust des Francs aufzufangen, bemühte man sich - wieder einmal - um amerikanische Kredite: ,,Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hatte sich die Ruhrbesetzung als Fiasko erwiesen, die Kosten überstiegen die Gewinne bei weitem. Um ihre Währung zu retten, baten die Franzosen Wall Street um Hilfe. Die amerikanischen Bankiers halfen auch, aber um die Unabhängigkeit der französischen Europapolitik war es geschehen."68
Der Dawes-Plan war noch nicht ratifiziert, doch ähnlich wie schon zuvor in England gab es auch in Frankreich einen Regierungswechsel, von dem sich die deutsche Seite mehr Entgegenkommen erhoffen konnte: Am 11. Mai 1924 gewann ein linke Parteienkoalition die französischen Kammerwahlen, Poincaré war gestürzt. In der Bevölkerung war der Unmut über Frankreichs zunehmende Isolierung und wachsende Inflation gestiegen. Der Sozialist Edouard Herriot, der nun neuer Ministerpräsident wurde, zeichnete sich gar in seiner Regierungserklärung als Bewunderer der deutschen Geisteskultur aus. Dennoch versuchte eben jener Herriot im August 1924 auf der Londoner Konferenz, die über die Annahme des Dawes-Plans zu entscheiden hatte, das Thema der Ruhrbesetzung auszuklammern.
Die Teilnahme an der Londoner Konferenz war bereits ein Zugeständnis an England und die USA; die Finanzkrise erforderte ein Entgegenkommen, man war auf amerikanische Kredite angewiesen. Schritt für Schritt weichte die französische Position auf.
Frankreich forderte für die Annahme des Dawes-Plans die Zusicherung der wirtschaftlichen Kontrolle des Ruhrgebietes bis zur vollständigen Zahlung aller Reparationen. Doch dieses war allen anderen Beteiligten ein Dorn im Auge, denn solange das industrielle Herz Deutschlands für Frankreich schlug, blieben amerikanische Kredite und somit der wirtschaftliche Wiederaufbau Europas fern. Die Situation erforderte auf allen Seiten äußerstes diplomatisches Geschick: Die Regierungswechsel in England und besonders in Frankreich ermöglichten einerseits den Beginn einer Verständigungspolitik. Andererseits jedoch bereitete der aufblühende Nationalismus in Deutschland - bei den Wahlen am 4.5.1924 hatten die Parteien der Weimarer Koalition große Verluste erlitten - den Alliierten Sorgen. Sowohl Stresemann, als auch Herriot standen innenpolitisch unter Druck, ihnen wurde die Preisgabe nationaler Ziele vorgeworfen. In beiden Staaten waren die Feindbilder zu präsent, eine Verständigungspolitik hatte es aufgrund der Emotionalisierung schwer: ,,Weitere französische Forderungen nach Sicherungen vorab erhielten ihre Brisanz durch den innenpolitischen Druck, nichts aufzugeben. Das entsprach der zum Teil erregten Opposition in Deutschland, die keine Zugeständnisse erlauben wollte. Stresemann mußte Anfang Juli 1924 alles aufbieten, den inneren Konsenz zu wahren, Herriot zu beschwören, die grundlegenden ersten Ansätze der Verständigungspolitik nicht zu vernichten, und die Grenzen des deutschen Entgegenkommens abstecken."69
Die Londoner Konferenz tagte vom 16.7. bis zum 16.8. 1924, in den letzten zehn Tagen war auch die deutsche Delegation, vertreten durch Stresemann, Marx, Luther und Schubert, an ihr beteiligt. Mit Hilfe des Drucks amerikanischer Bankiers gelang es, die Franzosen zum Rückzug aus dem Ruhrgebiet zu bewegen. Frankreich mußte gar auf politische Sicherheitsgarantien verzichten, jeglicher Zugriff auf die deutsche Industrie wurde unterbunden. Frankreich und Belgien willigten ein, das Ruhrgebiet binnen Jahresfrist zu räumen, was angesichts der deutschen Forderung nach sofortiger Räumung zwar ein Kompromiß war, der aber durch Herriots Geste, des sofortigen Abzugs aller Truppen aus Dortmund und Offenburg, für Deutschland erträglich gemacht wurde. Wie weit Frankreich in die Defensive gedrängt schien, zeigt der Umstand, daß Reichskanzler Marx, um einen ,,diplomatischen Eklat"70 zu vermeiden, auf eine Anprangerung des Kriegsschuldartikels verzichtete. Einfach ausgedrückt heißt dies, daß Versailles ad acta gelegt war! Mit der Ratifizierung des Dawes-Plans auf der Londoner Konferenz war die Nachkriegszeit beendet. Deutschlands Teilnahme in diesem Gremium war einer der entscheidenden Schritte zur politischen Wiedereingliederung und Gleichberechtigung. Die Nichtfestlegung der Reparationshöhe barg zwar oberflächlich betrachtet noch eine Gefahr für die deutsche Position, doch der Umstand, daß amerikanische Kredite zur wirtschaftlichen Starthilfe nach Deutschland flossen, sollte das Fundament für die ,,Goldenen Zwanziger" legen, wie die Zeit zwischen 1924 und 1929 heute genannt wird.
Fazit
Der Ruhrkampf war quasi eine Fortsetzung des ersten Weltkriegs mit anderen Mitteln. Dieser ,,Kalte Krieg", der oft zu einem heißen Krieg zu eskalieren drohte, fand seinen direkten Ursprung im Versailler Vertrag; ein Regelwerk, das erstmals in der Kriegsgeschichte nicht nur Sieger und Besiegte, sondern auch Opfer und Täter benannte. Mit Hilfe der moralischen Bezichtigung im Kriegsschuldparagraphen sollten Forderungen in bisher nie dagewesener Höhe an das unterlegene Deutschland durchgesetzt werden, insofern ist Versailles Ausdruck französischer Sicherheitsbestrebungen gegenüber Deutschland, dem Nachbarn, der durch seine expandierende Stahlindustrie und seinem Bevölkerungswachstum zur Bedrohung geworden war. Dennoch blieb Versailles sowohl inhaltlich, als auch -und erst recht- in seiner Umsetzung hinter den ursprünglichen französischen Erwartungen zurück. Es war von Anfang an ein Kompromiß, der durch die Zusicherung amerikanischer Garantien zustande gekommen war. Als diese dann ausblieben, begann für Frankreich der Kampf um die Durchführung des Vertragswerks, speziell um die Reparationen.
Der amerikanische Senat hatte die Ratifizierung abgelehnt, weil er sich nicht mit dem Versailler Vertrag identifizieren konnte.71 Man hatte erkannt, daß weder Frankreich, noch Deutschland friedensfähig waren, der aufblühende Nationalismus und die politischen Morde in Deutschland sollten diesen Eindruck später untermauern. Dabei war die Nichtfestsetzung der Reparationssumme einer der Hauptauslöser für die Ressentiments beider Staaten. Die Gegensätzlichkeit deutscher und französischer Interessen konnte sich an ihr entzünden und bot somit ein enormes Konfliktpotential.
Frankreich traf der amerikanische Rückzug hart, denn mit ihm verlor es nicht nur seine Sicherheitsgarantien, es bedeutete auch, daß es die finanzielle Frage nun weitgehend alleine lösen mußte. Die Höhe der Reparationszahlungen war nicht festgelegt worden, man hatte gehofft, deutsche Reparationsschulden mit französischen Kriegsschulden verknüpfen zu können. Nun sollte der Druck der Schuldenlast an Deutschland weitergegeben werden, es begann die Zeit der Reparationskonferenzen, und mit ihr der Lauf gegen die Zeit: Schon auf der Konferenz von Spa begann die erste Teilrevision von Versailles; England setzte aus Sorge um eigene Kohleexporte die deutschen Verpflichtungen bezüglich der Kohlelieferungen um 43 Prozent herab. Mit Recht läßt sich also das Ende einer französisch-englischen Politik bereits auf das Jahr 1920 datieren.
Bariéty zeigt auf, daß Frankreich aus dem Ersten Weltkrieg besonders geschwächt hervorgegangen war72: Abgesehen davon, daß es aufgrund der Kriegsschauplatzrolle die höchsten materiellen Verluste zu verzeichnen hatte, fielen auch die menschlichen Verluste schwer ins Gewicht, denn es hatte ein Jahrhundert des Geburtenrückgangs in Frankreich gegeben. Daher war das ,,[...] unterschiedliche demographische Potential [...] eines der grundlegenden Elemente der französisch-deutschen Frage in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen."73 Auch wirtschaftlich stand Frankreich schwächer als Deutschland da; der Aufschwung deutscher Stahlindustrie seit Anfang des 20. Jahrhunderts war zwar durch den Versailler Vertrag gebremst, doch sein Vorsprung nicht annulliert worden. 1922 verfügte Deutschland wieder über ein ähnlich leistungsfähiges Industriepotential wie 1913; d.h., die deutsche Schwerindustrie nahm wieder die führende Rolle in Europa ein. Frankreich hingegen benötigte zur Nutzung seiner hinzugewonnenen lothringischen Eisenhütten Koks- und Kohlelieferungen aus dem Ruhrgebiet. Bariéty zeigt die Konsequenzen dieser Problematik bereits auf, wenn er fragt: ,,Sollte es sich die Kohle mit aufgepflanzten Bajonetten von der Ruhr holen?"74
Die sich immer weiter verschlechternde Lage führte den glühenden Patrioten und traumatisierten Deutschlandgegner Poincaré schon Ende 1922 dazu, die Kraftprobe mit Deutschland zu wagen, um das in immer weitere Ferne rückende Versailles zu retten, womit er es letzten Endes aufs Spiel setzte. Im Ruhrkampf selbst verausgabten sich die Kontrahenten bis ans Ende ihrer Kräfte, wobei weder England, noch die USA schlichtend tätig wurden. Frankreich ,,gewann" den Konflikt, Deutschland war in die Knie gezwungen worden, doch von Frankreich als einem Sieger zu sprechen, träfe nicht den wahren Kern. Die Finanzmisere und die von Frankreich abgewandte anglo-amerikanische Politik zwangen Poincaré zur Duldung eines internationalen Expertengremiums, welches später den Dawes-Plan entwickeln sollte.
Für Winkler steht fest: ,,Der Verlierer der neuen, in London besiegelten Ordnung war Frankreich."75 Wenn man ausschließlich den Dawes-Plan zur Grundlage dieser Aussage macht, ist das richtig. Die Ziele der Ruhrinvasion sind aus französischer Sicht nicht erreicht worden; im Gegenteil: Das ,,Ruhrabenteuer" hat Frankreich in den Bankrott und in die Abhängigkeit getrieben, Versailles war zu großen Teilen revidiert. Was für Frankreich ein Rückschritt war, war für Deutschland ein Schritt nach vorn; es war ebenso von amerikanischer Politik und amerikanischen Krediten abhängig, doch es hatte die Isolation abstreifen können.
Dennoch kann weder Frankreich, noch Deutschland als Sieger des Ruhrkampfs bezeichnet werden. Schon der Erste Weltkrieg hatte nur einen wahren Gewinner: Die USA. Sie hatten den Krieg mit Krediten an England und Frankreich finanziert und hatten finanziell und politisch von ihrem Engagement profitiert. Amerikas Kapital und Europas Schuldnerrolle hatten den US-amerikanischen Einfluß vergrößert; ein Wiederaufbau Europas war ohne amerikanische Kredite undenkbar geworden. Frankreich hatte sich im Zuge der Ruhrinvasion weiter verschuldet, die USA schauten zu, wie die Lage eskalierte. Erst, als beide Kontrahenten mehr oder weniger ruiniert waren, begannen sich amerikanische Bankiers wieder für Europa zu interessieren.
Der Dawes-Plan, der den wirtschaftlichen Wiederaufbau einleiten sollte, war durchaus auch ein Ausdruck und Instrument amerikanischer Finanzinteressen: Deutschland war schon vor dem Krieg ein wichtiger Handelspartner und Absatzmarkt der USA gewesen, den es nun wiederherzustellen galt. Zudem drohte im Osten der Bolschewismus, und es schien (nicht zuletzt durch Rapallo), daß man sich beeilen müsse, diesen Absatzmarkt in den kapitalistischen Westen zu integrieren. Deutschlands geopolitische Mittellage spielte, wie bereits in der Einleitung erwähnt, wieder einmal eine entscheidende Rolle. Schon Reichskanzler Wirth hatte diese Karte beim Rapallo-Abkommen gespielt.
Über den wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands sollten die Reparationszahlungen an Frankreich wieder in Gang und damit die allmähliche Tilgung französischer Schuldenlast ermöglicht werden. Der Dawes-Plan sah nämlich keine Neuregelung französischer Schulden vor, was ein weiteres Indiz für den Vorrang amerikanischer finanzieller Interessen ist, der bei der Bewertung des Dawes-Plans im speziellen und der amerikanischen Initiative während und nach dem Ersten Weltkrieg im allgemeinen zu berücksichtigen ist.
Literaturverzeichnis
Baumgart, Constanze: Stresemann und England (Diss.); Köln, Weimar, Wien, 1996
Bergmann, Carl: Der Weg der Reparationen; Frankfurt am Main , 1926
Bernhard, Henry (Hrsg.): Gustav Stresemann. Vermächtnis. Bd.1, Berlin 1932
Denk-Helmold, Marianne: Die Reaktion der Reichsregierung Cuno auf die Besetzung des Ruhrgebietes durch französische und belgische Truppen 1923 im Spiegel der Presse (Diss.), Köln, 1988
Dohrmann, Bernd: Die englische Europapolitik in der Wirtschaftskrise 1921-1923. Zur Interdependenz von Wirtschaftsinteressen und Außenpolitik (in: Studien zur modernen Geschichte, Bd. 24) München, Wien, 1980
Erdmann, Karl Dietrich: Die Weimarer Republik; in: Gebhardt: Handbuch der deutschen Geschichte, Bd.19; Stuttgart, 199311
Erdmann, Karl Dietrich: Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg, Suttgart 1966
Kolb, Eberhard: Die Weimarar Republik (in: Oldenbourg, Grundriß der Geschichte, Bd.16) München2 1988
Krüger, Peter: Die Außenpolitik der Republik von Weimar; Darmstadt, 1985
Krüger, Peter: Versailles. Deutsche Außenpolitik zwischen Revisionssicherung und Friedenssicherung, München 1986
Küppers, Heinrich: Joseph Wirth: Parlamentarier, Minister und Kanzler der Weimarer Republik, Stuttgart, 1997
Michalka, Wolfgang und Niedhart, Gottfried (Hrsg.): Die ungeliebte Republik.
Dokumentation zur Innen - und Außenpolitik Weimars 1918 - 1933; München, 19843 Mommsen; Hans: Die verspielte Freiheit. Der Weg der Republik von Weimar in den Untergang 1918 bis 1933 (in: Propyläen Geschichte Deutschlands, Bd. 8), Berlin 1989
Niedhart, Gottfried: Deutsche Geschichte 1918 - 1933. Politik in der Weimarer Republik und der Sieg der Rechten. Stuttgart, Berlin, Köln 1994
Poidevin, Raymond / Bariéty, Jacques: Frankreich und Deutschland. Die Geschichte ihrer Beziehungen 1815 - 1975; München 1982
Rovan, Joseph: Geschichte der Deutschen. Von ihren Ursprüngen bis heute, München, Wien, 1995
Schulze, Hagen: Weimar, Deutschland 1917 - 1933, Berlin, 1994
Schwabe, Klaus (Hrsg): Die Ruhrkrise. Wendepunkt der internationalen Beziehungen nach dem Ersten Weltkrieg; Paderborn, 19862
Wentzcke, Paul: Ruhrkampf, 2 Bände, Berlin 1930/32
Winkler, Heinrich August: Weimar 1918 - 1933; München, 1993
Zimmermann, Ludwig: Frankreichs Ruhrpolitik. Von Versailles bis zum Dawesplan. Göttingen, Zürich, Frankfurt 1971
Ich versichere, daß ich die schriftliche Hausarbeit - einschließlich beigefügter Zeichnungen, Kartenskizzen und Darstellungen - selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, habe ich in jedem Fall unter Angabe der Quelle deutlich als Entlehnung kenntlich gemacht.
8. April 1998
[...]
1 Schulze, S.146
2 Erdmann: Weimar, S.225
3 Schulze hebt dazu hervor: ,,Man wird Ludendorff zugute halten müssen, daß er, wenn auch sehr spät, doch immerhin zur Einsicht gelangte; im Vergleich zur deutschen Führung im Zweiten Weltkrieg , die sich erst geschlagen gab, als Deutschland total zerstampft war, war Ludendorff doch ein Funken politischer Vernunft geblieben." Schulze, S.148
4 Anm.: Diese Politik legte in revanchistisch gesinnten Kreisen den Grundstein für die ,,Dolchstoßlegende".
5 Die Bestimmung, daß die Bevölkerung Ostoberschlesiens abstimmen durfte, wurde erst im endgültigen Entwurf der Friedensbedingungen verankert. Siehe hierzu: Schulze, S.197
6 Brockdorff-Rantzau wehrte den Vorwurf der deutschen Alleinschuld am 7.5.1919 ab: ,,Es wird von uns verlangt, daß wir uns als die allein Schuldigen am Kriege bekennen; ein solches Bekenntnis wäre in meinem Munde eine Lüge. Wir sind fern davon, jede Verantwortung dafür [...] abzuwälzen [...], aber wir bestreiten nachdrücklich, daß Deutschland, dessen Volk überzeugt war, einen Verteidigungskrieg zu führen, allein mit der Schuld belastet ist." Michalka/Niedhart, S.123
7 Schulze hebt hier den Aspekt der Moral als rechtfertigende Komponente hervor: ,,Die alliierten Staatsmänner brauchten diesen Artikel, um die Schwere der Deutschland aufgebürdeten Lasten vor sich selbst und ihren Nationen zu begründen." Schulze, S.195
8 Michalka/Niedhart, S.139
9 Rovan, S.526
10 Winkler, S.93f
11 Dieser Verdacht sollte sich später bestätigen: Das Kabinett Wirth bediente hemmungslos die Notenbank, um die Inflation noch zu beschleunigen und Frankreich zu einem Einlenken zu bewegen. Siehe hierzu: Küppers, S.95 ff
12 siehe: Krüger: Außenpolitik, S.124
13 Schulze hierzu: ,,Das war nicht nur Heroismus; man wußte, daß die französische und die britische Regierung sich uneins waren, und setzte auf amerikanische Vermittlung. Doch aus Washington kam lediglich eine unverbindliche Verurteilung der französischen Pressionen, und die britische Regierung, die einen Mittelweg zwischen den deutschen und französichen Wünschen zu verfolgen suchte, scheiterte am französischen Starrsinn." Schulze, S.228
14 Schulze, S.228-229: ,,[...]die jährlichen Zahlungen hätten etwa 7 Prozent des deutschen Volkseinkommens ausgemacht, was nach Meinung des bedeutendsten Nationalökonomen auf alliierter Seite, des Wirtschaftstheoretikers John Maynard Keynes, die Möglichkeiten der deutschen Volkswirtschaft um ein Dreifaches überstieg."
15 siehe: Winkler, S.147
16 Ein weiterer, wesentlicher Grund für die Annahme des Ultimatums war die Schlesienfrage. Eine Abstimmung hatte am 20.3.1921 eine 60:40 Mehrheit für den Verbleib Oberschlesiens bei Deutschland ergeben, doch Frankreich wollte es dem Bündnispartner Polen übertragen. Zudem versuchte Polen, sich über Aufstände des Gebietes zu bemächtigen. Unter englischer Duldung durfte eine deutsche Gegenwehr intervenieren. Auch aus diesem Grunde wurde das Ultimatum angenommen; man wollte England nicht brüskieren. Siehe: Erdmann: Weimar, S.147f
17 Erdmann: Weimar, S.149
18 Winkler, S. 161, zitiert in diesem Zusammenhang die ,,Oletzkoer Zeitung": ,,Ein Mann, der wie Erzberger wohl die Hauptschuld am Unglück unseres Vaterlandes hatte, mußte, solange er am Leben war, eine stete Gefahr für Deutschland bleiben.[...]Haß müssen wir säen! Und wie wir unsere Feinde von außen hassen lernen, so müssen wir auch die inneren Feinde Deutschlands mit unserem Haß und Verachtung strafen. Vermittlungen sind unmöglich, nur durch Extreme kann Deutschland wieder das werden, was es vor dem Krieg war." Zitat lt.Winkler in: Klaus Epstein: M. Erzberger und das Dilemma der deutschen Demokratie, Berlin 1962, S.428ff
19 Die Morde an Liebknecht und Luxemburg seien hier deswegen nur nebenbei bemerkt, weil sie als Spartakisten nicht zum Repräsentantenkreis der Reichsregierung gehörten, wenngleich natürlich auch diese Verbrechen die gespannte innenpolitische Situation widerspiegeln.
20 siehe: Winkler, S.169ff
21 Daß dies nicht der Fall war, zeigt ein Treffen zwischen Poincaré und Wirth im Januar 1928, bei dem Poincaré sich über die militärische Interaktion gut informiert zeigte. Siehe: Küppers, S204f
22 Krüger, S.167
23 siehe: ebd., S.178f
24 Link, in: Schwabe, S.42
25 Die Balfour-Note sorgte auch für Zwistigkeiten zwischen England und den USA, die sich durch die -plakative- Schuldeneintreibungspolitik an den Pranger gestellt fühlten. Siehe:ebd, S.43
26 Schulze, S.249f
27 siehe: Schwabe, S.14
28 ebd, S.18
29 Schwabe, S.12
30 siehe: Schwabe, S.18
31 Doch auch der deutschen Seite bereitete der Rückzug Sorgen: ,,Reichskanzler Cuno zeigte sich dem US-Botschafter Houghton gegenüber ängstlich, daß die letzten US-Truppen aus dem Rheinland abgezogen würden.[...] Cunos Abschiedsschreiben an den Kommandeur der US- Truppen, General Allen, drückte die deutsche Enttäuschung über diesen Schritt der USA aus." Denk-Helmold, S.20
32 Zitat in: Schulze, S.252
33 Die Besatzer waren davon ausgegangen, daß ein Widerstand der Arbeiter eher den Erfolg des Unternehmens verhindern könne als ein Widerstand der Unternehmer, deren Einlenken man durch Korruption erzielen zu können glaubte. Daher richteten sich die ersten Strafmaßnahmen vorrangig gegen Unternehmer. Siehe hierzu: Pabst in: Först, S.33f.
34 siehe: Pabst, Klaus in: Först, S.20
35 Pabst in: Först, S.23f
36 Zitat in: Winkler, S. 195
37 Dieser ,,Nationalbolschewismus" muß allerdings auch vor dem Hintergrund des Wählerfangs gesehen werden.
38 Pabst in: Först, S.30
39 Zitat in: Pabst: Der Ruhrkampf, in Först, S.35
40 sieh hierzu: Denk-Helmold, S.15
41 Denk-Helmold, S.20
42 Pabst in: Först, S.39f
43 siehe hierzu: Bariéty in: Schwabe, S.16
44 Dieses Konzept sollte später Teil des Dawes-Planes sein.
45 Schulze, S.259
46 Die Kosten beliefen sich Anfang September 1923 auf tägliche 40 Millionen, Ende
September auf wöchentliche 3500 Billionen Reichsmark. Siehe: Michalka/Niedhart, S.116
47 Baumgart, S.128
48 Hier muß allerdings berücksichtigt werden, daß England sehr wohl Kohle, und zwar auch auf Kreditbasis, nach Deutschland exportierte - insofern profitierte England aus dem passiven Widerstand. Siehe: Krüger, S.198
49 Winkler, S. 209
50 siehe Pabst in Först, S.46: ,,Weil man in Paris wußte, daß den Deutschen das Wasser bis zum Halse stand, war der französische Ministerpräsident Poincaré nicht bereit, zu einem Zeitpunkt, zu dem sich ein erfolg seiner Ruhraktion abzuzeichnen begann, freiwillig auf das Errungene zu verzichten."
51 Michalka/Niedhart, S.117
52 Poidevin/Bariéty, S.335
53 ebd., S.335
54 Winkler, S. 233
55 Winkler, S.233
56 Erdmann:Weimar, S.191
57 Winkler, S.224
58 siehe Erdmann: Weimar, S.194
59 Bernhard, S.245
60 Krüger, S.203
61 ebd, S.219
62 Poidevin/Bariéty, S.328f
63 Krüger, S.222
64 Winkler, S.233
65 siehe: Krüger, Außenpolitik, S.226-227
66 Krüger: Außenpolitik, S.232
67 Schulze, S.274
68 Schulze, S.275
69 Krüger: Außenpolitik, S.242
70 Winkler, S.264
71 siehe: Bariéty: Frankreich und Deutschland, S.311
72 siehe: Bariéty in: Frankreich und Deutschland, S.314 ff
73 ebd., S.315
74 ebd., S.315
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ruhrkampf 1923 und worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine schriftliche Hausarbeit von Ingo Meyer über den Ruhrkampf im Jahr 1923. Es untersucht die Ursachen, den Verlauf und die Folgen dieses Konflikts zwischen Deutschland und Frankreich, der durch die französische Besetzung des Ruhrgebiets ausgelöst wurde. Die Arbeit analysiert die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte des Ruhrkampfes und seine Bedeutung für die Weimarer Republik.
Welche Rolle spielte der Versailler Vertrag im Ruhrkampf?
Der Versailler Vertrag wird als eine der Hauptursachen des Ruhrkampfes genannt. Die darin festgelegten Reparationsforderungen, Gebietsabtretungen und militärischen Beschränkungen belasteten die deutsche Wirtschaft und führten zu Spannungen mit den Siegermächten, insbesondere Frankreich. Der Kriegsschuldparagraph (§231) wird als besonders demütigend und revanchistisch angesehen, der zur Destabilisierung der Weimarer Republik beitrug.
Was war der passive Widerstand und wie äußerte er sich?
Der passive Widerstand war eine Form des zivilen Ungehorsams, mit dem die deutsche Bevölkerung im Ruhrgebiet auf die französische Besetzung reagierte. Er umfasste die Weigerung, Anordnungen der Besatzungsmächte zu befolgen, Streiks, Sabotageakte und die Unterstützung der Bevölkerung durch die Reichsregierung. Es gab auch einen aktiven Widerstand.
Welche Motive hatte Frankreich für die Besetzung des Ruhrgebiets?
Frankreichs Motive waren vielfältig. Einerseits wollte man die Reparationsforderungen durchsetzen und die deutsche Wirtschaft schwächen. Andererseits spielten Sicherheitsbedenken eine Rolle, da Frankreich die deutsche Schwerindustrie als Bedrohung ansah. Die innenpolitische Lage in Frankreich und der Druck der Gläubigernationen (insbesondere der USA) trugen ebenfalls zur Entscheidung für die Besetzung bei.
Was waren die Folgen des Ruhrkampfes für Deutschland?
Die Folgen für Deutschland waren verheerend. Die Wirtschaft brach zusammen, die Inflation erreichte astronomische Ausmaße, und die soziale Not wuchs. Politische Unruhen, Separatismus und Putschversuche destabilisierten die Weimarer Republik zusätzlich. Der Ruhrkampf führte letztlich zur Aufgabe des passiven Widerstands und zur Akzeptanz des Dawes-Plans.
Was war der Dawes-Plan und wie beendete er den Ruhrkampf?
Der Dawes-Plan war ein von einem internationalen Expertengremium entwickelter Plan zur Regelung der deutschen Reparationszahlungen. Er sah eine Senkung der jährlichen Zahlungen vor, ermöglichte eine internationale Anleihe zur Stabilisierung der deutschen Wirtschaft und sah den Abzug der französischen Truppen aus dem Ruhrgebiet vor. Der Dawes-Plan beendete zwar den direkten Konflikt, bedeutete aber auch eine Einschränkung der deutschen Souveränität.
Welche Rolle spielten England und die USA im Ruhrkampf?
England und die USA verhielten sich zunächst abwartend und kritisierten die französische Politik. Insbesondere England sah die französische Besetzung des Ruhrgebiets kritisch, da es eine wirtschaftliche Hegemonie Frankreichs befürchtete. Letztendlich drängten England und die USA auf eine internationale Lösung der Reparationsfrage und trugen zur Entwicklung des Dawes-Plans bei.
Wer waren die Hauptakteure im Ruhrkampf?
Zu den Hauptakteuren gehörten der deutsche Reichskanzler Wilhelm Cuno, der französische Ministerpräsident Raymond Poincaré, der deutsche Reichskanzler Gustav Stresemann, der französische Ministerpräsident Edouard Herriot und der amerikanische Bankier Charles G. Dawes.
- Quote paper
- Ingo Meyer (Author), 1998, Der Ruhrkampf 1923, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97571