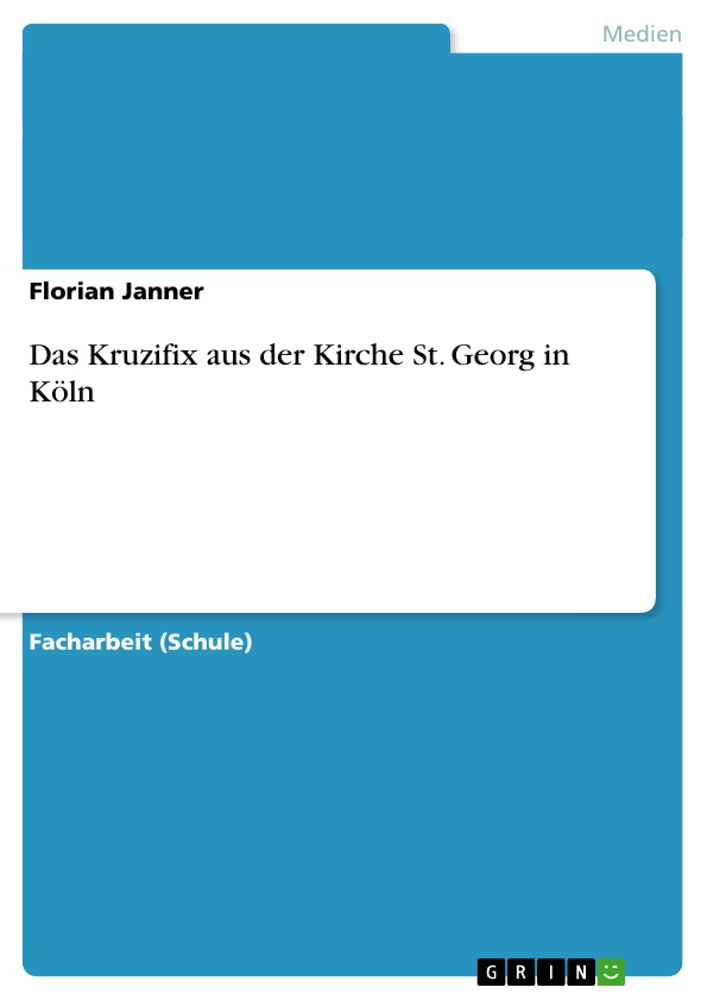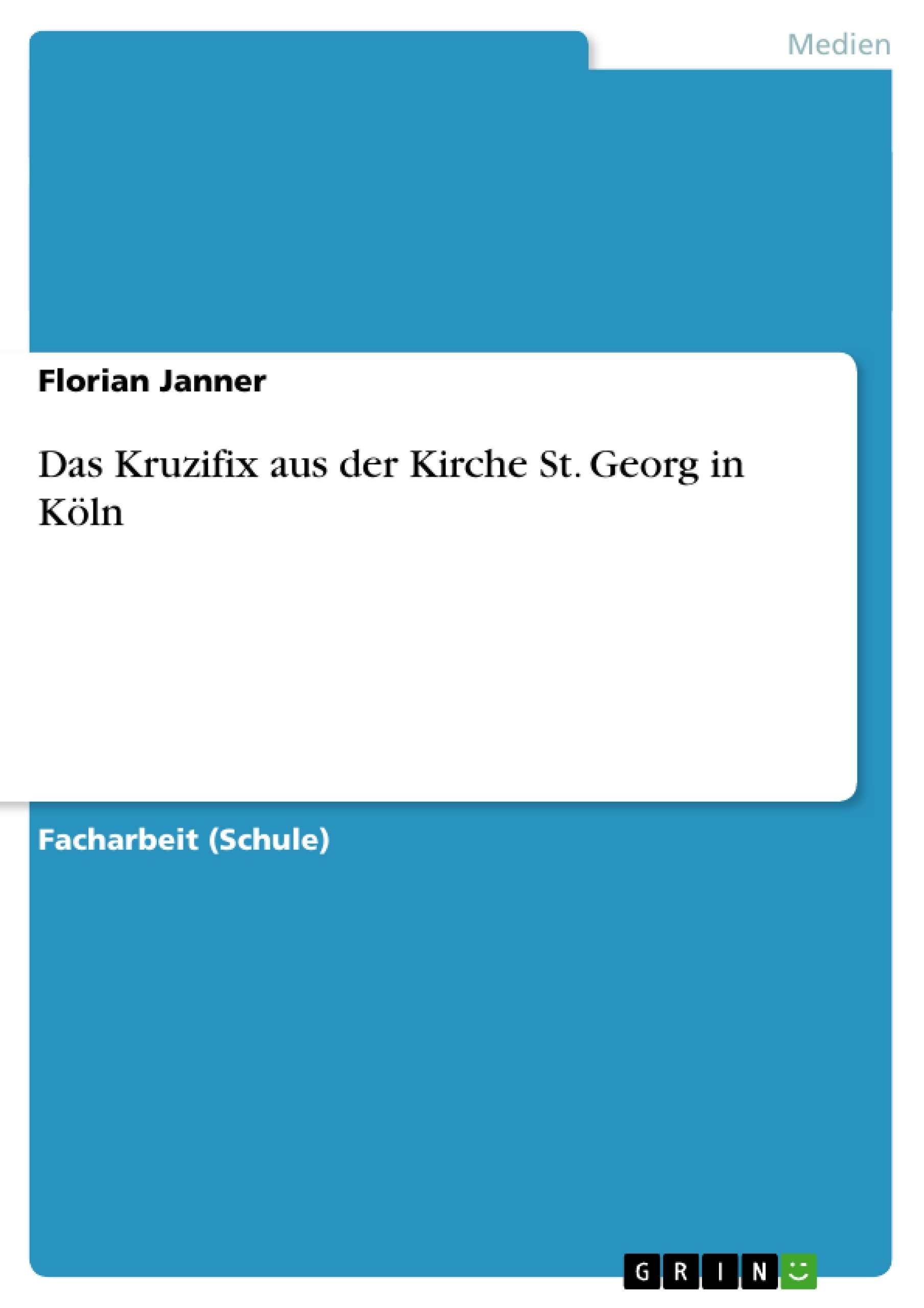Köln, 1921: In den Tiefen der Krypta von St. Georg schlummert ein Geheimnis, ein stummer Zeuge mittelalterlicher Frömmigkeit und künstlerischer Meisterschaft. Der Torso eines einst monumentalen Kruzifixes, gefertigt aus der warmen Patina des Nussbaumholzes, wird entdeckt – ein Fund, der Kunsthistoriker und Gläubige gleichermaßen in seinen Bann zieht. Dieses fragmentarische Meisterwerk romanischer Skulptur, das Kruzifix aus St. Georg, birgt eine Geschichte von Schmerz, Hingabe und dem unerbittlichen Lauf der Zeit. Obwohl Arme und Füße fehlen, die Farbfassung längst verblichen ist, spricht die expressive Kraft des Torso eine deutliche Sprache. Der nach links gewölbte Körper, der sich wie ein Kreisbogen dem Betrachter entgegenneigt, vermittelt einen Eindruck von Bewegung und innerer Zerrissenheit. Der Kopf, dessen Züge von tiefen Falten gezeichnet sind, scheint gepeinigt und doch von einer unerschütterlichen Würde erfüllt. Die Frage, ob die Augen geschlossen sind und den Tod verkörpern oder halb geöffnet den Kampf widerspiegeln, bleibt unbeantwortet und lässt Raum für Interpretation. Die detaillierte Ausarbeitung des Hauptes kontrastiert mit der Kargheit des Oberkörpers und dem strengen Faltenwurf des Lendentuches, wodurch eine Spannung zwischen Bewegung und Starre entsteht. Dieses Werk, heute im Kölner Schnütgen Museum beheimatet, fasziniert durch seine Gegensätze und die Vielschichtigkeit seiner Aussage. Es ist ein Schlüssel zur romanischen Kunst am Rhein, ein Zeugnis des Glaubens und der handwerklichen Kunstfertigkeit des 11. Jahrhunderts. Tauchen Sie ein in die Welt der romanischen Skulptur, entdecken Sie die Symbolik des Kruzifixes und lassen Sie sich von der Ausdruckskraft dieses einzigartigen Kunstwerks berühren. Erfahren Sie mehr über die kunsthistorische Bedeutung, die ikonografischen Details und die spirituelle Tiefe dieses außergewöhnlichen Zeugnisses mittelalterlicher Kunst, ein Muss für jeden Kunstliebhaber, der die verborgenen Schätze der Romanik entdecken möchte. Die vorliegende Abhandlung widmet sich einer detaillierten Analyse des Kruzifixes, beleuchtet seine kunsthistorische Einordnung und interpretiert die subtilen Botschaften, die in der Holzskulptur verborgen liegen.
Autor: Florian Janner
Das Kruzifix aus St. Georg in Köln
I. Einleitung
1921 wird in der Krypta der Kirche St.Georg in Köln der 190 cm hohe1 Torso einer Christusfigur entdeckt2. Das überlebensgroße Werk, eine Schnitzerei aus Nußbaumholz3, war einmal Teil eines Kruzifixes und ist heute in desolatem Zustand: es fehlen nicht nur die Arme und Füße der von Wurmlöchern durchsetzten Christusfigur; auch die Fassung, die ursprüngliche Bemalung des Bildwerkes also, ist verlorengegangen4 - und nicht zuletzt fehlt auch das Kreuz. Am Rest des linken Oberarmes ist noch zu erkennen, daß die Arme ursprünglich schräg nach oben gestreckt waren, die Figur also die Haltung des Gekreuzigten einnimmt.
Es läßt sich nur schätzen, wann genau das heute allgemein als Kruzifix aus St. Georg bekannte Werk entstand. Man vermutet jedoch, daß es aus der zweiten Hälfte des 11.Jh stammt5 und bringt es mit der Weihe der Georgskirche im Jahre 1067 in Verbindung. Seit 1929 befindet sich das Objekt im Kölner Schnütgen-Museum6.
II. Betrachtung
II.1. Der erste Eindruck
Die Figur beschreibt eine große, nach links7 gewölbte Kurve und wirkt so wie ein
Kreisbogen8. Denken wir uns das fehlende Kreuz hinzu, so weicht der Körper deutlich seitwärts von dessen senkrechter Achse ab, was den Eindruck einer Bewegung, eines Ausschwingens der Figur erzeugt. Von vorne gesehen ist der gesamte Körper vom sehr differenziert gestalteten, stark nach vorne geneigten Kopf bis zu den Beinen in diese ausladende Bogenform eingebunden.
II.2. Der Kopf
Zusätzlich zu dieser Seitwärtsbewegung der Figur jedoch entsteht durch das jähe Herausfallen des Kopfes aus der reinen Flächenansicht nach vorne eine weitere Dynamik, die als weitere Raumachsen auch noch Vorne und Hinten miteinbezieht. Der Nacken ist dabei in unnatürlich großem, fast rechtem Winkel stark herausgedehnt, was den Eindruck größter Anspannung erzeugt; er scheint wie mit Gewalt herausgebogen. Der ebenso wie der Hals stark gelängte Kopf sinkt nicht ganz auf die Brust herab sondern bleibt vielmehr starr in der Luft stehen, was noch einmal den Eindruck äußerster Anspannung verstärkt. Der Längung des Kopfes entsprechend kommen bei der Modellierung sowohl des Profils von Nase und Kinn als auch der Gesichtszüge gratige, scharf geschnittene Formen zur Verwendung. So ist der Ausdruck des Gesichts geprägt von tief eingeschnittenen Falten. Die schärfsten und markantesten führen von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln herab. Die von der Nasenwurzel ebenfalls zu den Mundwinkeln reichenden Falten sind zwar länger, dafür aber nicht ganz so tief eingekerbt. Unter den Jochbeinen schließlich befinden sich jeweils zwei bogenförmige, übereinander angeordnete Hängefalten, die an ihren Scheitelpunkten herausstehen. Über den sich hervorwölbenden Jochbeinen scheint sich die Haut zu spannen, was den schon durch die starke Längung des gleichzeitig sehr schmalen Kopfes unterstützten, hageren und ausgemergelten Ausdruck des Gesichtes noch verstärkt. Dessen Länge wird durch die Vertikalität der Falten noch einmal betont, was auch durch die hochgezogenen Stirnbeinbögen noch unterstützt wird. Auch kommt die durch diese Längung von Hals und Kopf angedeutete Anspannung in der Härte und Tiefe der Falten erneut zum Ausdruck. Der Schärfe der Falten entspricht die Gestaltung des Haupthaares, welches in tiefen, streng parallel angelegten Einkerbungen zu beiden Seiten des Mittelscheitels "eng geriefelt in ornamental wirkendem Schwung"9 um die großen, nach vorn geklappten Ohren führt und in jeweils drei Strähnen auf beide Schultern fällt. Ebenso dicht und streng parallel gefurcht wie das Haupthaar sind auch der Lippenbart sowie der Wangen- und Kinnbart dargestellt. Letzterer ist in stilisierte Büschel zusammengefaßt, welche durch bogenförmige, zu beiden Seiten des Kopfes jeweils in Richtung des Kinns sich vorwölbende Einschnitte gekennzeichnet sind.
Es lässt sich nicht genau ausmachen, ob der Gekreuzigte hier in der Anspannung des Todeskampfes dargestellt ist, oder ob seine Züge noch im Tod angespannt sind. Denn ob die Augen nun geschlossen sind oder nicht, läßt sich allein anhand von Abbildungen und ohne dem Original gegenüberzustehen nicht mit letzter Gewißheit sagen. Während sowohl Wesenberg10 als auch Budde11 der Ansicht sind, die Augenlider seien geschlossen, der Gekreuzigte also als Toter dargestellt12, ist man anderswo davon überzeugt, die Augen seien nicht etwa geschlossen sondern noch halb offen13. Tatsächlich erwecken die je nach Abbildung in unterschiedlich starker Intensität wahrnehmbaren Schatten jeweils zwischen oberem und unterem Augenlid den Anschein, die Augen seien noch nicht ganz geschlossen. Die Figur als Ganzes greift also auf unterschiedliche Weisen in verschiedene Raumrichtungen aus: weit, geschwungen und dennoch angespannt zur Seite hin; plötzlich, knapp und von größter Anspannung erfüllt nach vorne. Die den Körper in die Form des Kreisbogens einbindende Seitwärtsbewegung dominiert dabei aufgrund ihrer ausladenden Weite das Werk. Indem das Haupt nun gleichzeitig nach rechts entlang des Kreisbogens und nach vorne geneigt ist und so an beiden Bewegungen teil hat, wird es zum Schnittpunkt dieser Dynamiken unterschiedlichen Charakters, die sich eben auch in der Ausgestaltung der Gesichtszüge widerspiegeln. Dem unvermittelt scharfen, frontalen Abbrechen des Kopfes entsprechen die Schärfe und Härte der Gesichtszüge sowie die scharfgratige Parallelität von Haupt- und Barthaaren; demgegenüber korrespondiert die geschwungene Linienführung des Haupthaares um die Ohren herum mit der Bogenform des Gesamtkörpers. Das Haupt wird so zum Mittelpunkt der Figur, seine detailreiche Ausgestaltung unterstreicht noch einmal seine Bedeutung als Ausdrucksträger. Auffällig ist weiterhin der durch die symmetrische Anlage der Falten unterstützte achsensymmetrische Aufbau des Gesichts, welcher sich im leicht zur rechten Seite des Kopfes verschobenen Mittelscheitel fortsetzt - eine Symmetrie, aus der sich der Kopf als Ganzes allerdings durch sein Abknicken, der Gesamtkörper wiederum durch sein Ausschwingen herausbewegt. Das Gesicht ist also nicht nur der am detailiertesten gestaltete, sondern auch der einzige achsensymmetrisch angelegte Bereich des ganzen Werkes, was ihm im Gesamtzusammenhang zusätzliches Gewicht einräumt.
II.3. Die Haltung
Indem die Kreisbogenform des Körpers den Raum in so großem Radius durchstellt und, von vorne betrachtet, ohne Knick verläuft, wirkt sie zunächst sehr weich. Die Haltung jedoch, die dem Körper durch diese Kurve auferlegt wird, ist höchst unnatürlich und angespannt. Ursache sind die wie aufeinandergesetzte Blöcke wirkenden Bereiche von Oberkörper und Lendentuch, die der kreisbogenförmigen Bewegung der Figur entgegenstehen. Der Körper erscheint wie "von fremder Gewalt durchbogen"14 gegen den Widerstand dieser mächtigen, blockhaften Formen. Diese Bewegung erinnert an das Spannen eines Bogens - die aus dieser Bewegung resultierende Haltung wirkt dementsprechend gespannt.
II.3.a. Der Oberkörper
ist dabei im Gegensatz zum Gesicht und zum Lendentuch so gut wie gar nicht in sich gegliedert, seine Oberfläche ist kaum differenziert. Im Bereich des Thorax sind zwar die durch das Anheben der Arme hervortretenden Brustmuskeln deutlich dargestellt, auch ist schwach zu erkennen, wie sich die Oberfläche dem Brustbein entlang sehr leicht einzieht; die restlichen anatomischen Details dagegen, die sich herauswölbenden Rippen zum Beispiel, fehlen. Eigentlich müßte jedoch besonders dieser Bereich des Körpers das bereits an den Jochbeinen zutage tretende Merkmal des sich durch die gespannte Haut drückenden Skelettes aufweisen. Dieses Element fehlt jedoch im Thoraxbereich völlig und es wird deutlich, daß das Werk, was die Einhaltung eines einheitlichen Themas betrifft, nicht konsequent durchgestaltet ist. Dies macht sich als Ungleichgewicht der unterschiedlich behandelten Körperpartien bemerkbar. Zusätzlich zur Neigung des Kopfes ist schließlich im zwischen Thorax und Ansatz des Lendentuches gelegenen Bereich durch die starke Vorwölbung des Bauches eine weitere Bewegung aus der Fläche nach vorne gegeben, während der komplette restliche Körper in der Fläche verbleibt. Verglichen mit dem Herausbrechen des Kopfes handelt es sich hierbei jedoch um eine sehr weiche, geschwungene Bewegung, verwandt mit dem kreisbogenförmigen Ausschwingen der Gesamtfigur. Obwohl sich der Bauch so massiv vorwölbt, ist der Rücken nur minimal durchgedrückt und entfernt sich so, verglichen mit dem Herausfallen des Kopfes, nicht wirklich nach vorne vom Kreuz, so daß das typische Durchhängen und Absinken des Körpers hier nicht wirklich ausgeprägt ist. Die starke Neigung des Kopfes, hinter dem ein Freiraum entsteht, stellt so die einzige Abweichung des Körpers vom Kreuz dar und betont auf diese Weise das Verbleiben des restlichen Körpers in der Fläche - andererseits erhält aber auch die dadurch umso abrupter wirkende Neigung selbst zusätzlichen Nachdruck und der Kopf als besonders wichtiger, da ausdrucksstarker Körperteil wird zusätzlich betont.
Da der Rücken fast gar nicht durchgedrückt ist, scheint der Oberkörper trotz der merklichen Wölbung des Bauches und trotz der Bogenform des Körpers unnatürlich aufrecht, was den Eindruck einer unorganischen Haltung des Gesamtkörpers entscheidend mitprägt. Durch ein schmales, reifförmiges Zingulum15 ist der Oberkörper streng horizontal gegen das Lendentuch abgegrenzt. Insgesamt ist er durch seine festen Umgrenzungen in die unorganische Form eines geometrischen Grundelementes, eines Rechtecks, eingefaßt. Dies unterstützt die Wirkung des kaum gegliederten Oberkörpers als blockhafte Masse, die dem Ausschwingen des Gesamtkörpers entgegensteht. Im Vergleich zu Schärfe und Detailreichtum der Gesichtszüge, beziehungsweise zum scharf geschnittenen Lendentuch wirkt der Oberkörper durch seine kaum gegliederte Oberfläche karger, aber auch viel weicher. Nicht zuletzt scheint er dadurch auch unfertig, das Werk als Ganzes bleibt durch die Überbetonung des Gesichts als Ausdrucksträger bei gleichzeitiger Vernachlässigung anderer Körperpartien im Ungleichgewicht.
II.3.b. Das Lendentuch,
ein Perizoma16 mit Knoten an der rechten Seite der Hüfte, ist durch harte senkrechte Falten gegliedert. In ihrer streng parallelen Anlage gleicht die Faltenstruktur des Lendentuches dem Aufbau der nach dem selben Prinzip gestalteten Haupt- und Barthaare und korrespondiert aufgrund ihrer Starre auch mit der Starre des Nackens. Das Tuch wirkt keineswegs stofflich - vielmehr bildet der Stoff im wahrsten Sinne des Wortes hölzern wirkende Parallelfalten. Diese scheinen wie erstarrt und von der eigenen Masse nach unten gezogen, weswegen das Lendentuch einen insgesamt sehr schweren Eindruck macht. Dadurch, sowie durch seine großen Ausmaße dominiert es die untere Körperpartie. Indem der wie erstarrt wirkende Stoff den Körper völlig steif umgibt, steht er, sehr viel stärker noch als der Oberkörper, in seiner strengen Vertikalität der Bewegung des Körpers aus der Senkrechten entgegen. Im Gegensatz zum Oberkörper, der sich, wenn auch widerstrebend, der Seitwärtsbewegung der Gesamtfigur fügt, bleibt das Lendentuch so völlig statisch und weicht kein Stück von der Senkrechten ab. Es ist, wie schon der Oberkörper, in einen streng rechteckigen, wenn auch an der unteren horizontalen Kante durch den Faltenwurf ausgefransten Umriß eingefaßt und dadurch deutlich vom restlichen Körper abgegrenzt, was seine Unbeweglichkeit noch unterstreicht. Die Unnatürlichkeit der Körperhaltung resultiert so auch aus dieser Immobilität des großen Lendentuches, gegen dessen Masse der Körper mit Gewalt gebogen zu sein scheint.
III. Gesamteindruck
Alles in allem ist die Figur erfüllt von einander entgegengesetzten Kräften: einerseits die weiche Kurve der großen Generalbewegung und die mit ihr korrespondierenden Dynamiken, andererseits das heftige Herausfallen des Kopfes und die dem Charakter dieser Bewegung entsprechenden harten und scharfen Formen; einerseits Bewegung, andererseits Starre; detailreich ausgestaltete Bereiche einerseits, kaum differenzierte Bereiche andererseits. Diese komplexe Struktur in Verbindung mit den vielfältigen Beziehungen und Verwandschaften zwischen den einzelnen Bestandteilen, die sich innerhalb des Werkes ausmachen lassen, machen diese Figur zu einem besonderen Werk.
IV. Literatur
Budde, Rainer. Deutsche Romanische Skulptur. 1050-1250. München 1979.
Legner, Anton. Deutsche Kunst der Romanik. München 1982.
Legner, Anton, Hrsg. Monumenta Annonis. Weltbild und Kunst im Hohen Mittelalter. Köln 1975.
Legner, Anton, Hrsg. Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln. Bd.2. Köln 1985.
Legner, Anton, Hrsg. Rhein und Maas. Kunst und Kultur. 800-1400. Köln 1972.
Wesenberg, Rudolf. Frühe Mittelalterliche Bildwerke. Die Schulen Rheinischer Skulptur und ihre Ausstrahlung. Düsseldorf 1972.
[...]
1 Anton Legner, Hrsg., Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, Köln 1972, S.200.
2 Anton Legner, Deutsche Kunst der Romanik, München 1982, S.53
3 Rhein und Maas, S.200.
4 Anton Legner, Hrsg., Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln, Bd.2, Köln 1985, S.283.
5 ebd.
6 Rhein und Maas, S.200.
7 Von der Figur aus gesehen. Budde spricht von einem Ausschwingen nach Rechts (Rainer Budde, Deutsche Romanische Skulptur 1050-1250, München 1979, S.24.)
8 Wesenberg schreibt irrtümlich, die Figur wirke "wie der Abschnitt eines Kreisbogens" (Rudolf Wesen- berg, Frühe Mittelalterliche Bildwerke. Die Schulen Rheinischer Skulptur und ihre Ausstrahlung, Düsseldorf 1972, S.68.) - ein Kreisbogen ist jedoch bereits ein Aus- oder Abschnitt eines Kreisumfanges.
9 Frühe Mittelalterliche Bildwerke, S.67. Eine Riefe ist eine langgestreckte Vertiefung oder Furche.
10 ebd.
11 Deutsche Romanische Skulptur, S.24.
12 Rhein und Maas, S.200.
13 Ornamenta Ecclesiae, S.284.
14 Hermann Beenken, zitiert in Anton Legner, Hrsg., Monumenta Annonis. Weltbild und Kunst im Hohen Mittel- alter, Köln 1975, S.136.
15 Frühe Mittelalterliche Bildwerke, S.67.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kruzifix aus St. Georg in Köln?
Das Kruzifix aus St. Georg in Köln ist ein überlebensgroßer Torso einer Christusfigur, der 1921 in der Krypta der Kirche St. Georg in Köln entdeckt wurde. Es handelt sich um eine Schnitzerei aus Nussbaumholz und wird auf die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts datiert.
Wann wurde das Kruzifix entdeckt und wo befindet es sich heute?
Das Kruzifix wurde 1921 in der Krypta der Kirche St. Georg in Köln entdeckt. Seit 1929 befindet es sich im Kölner Schnütgen-Museum.
Wie ist der Zustand des Kruzifixes?
Das Kruzifix ist in desolatem Zustand. Es fehlen die Arme und Füße der Christusfigur, die mit Wurmlöchern durchsetzt ist. Auch die ursprüngliche Bemalung (Fassung) ist verlorengegangen, ebenso wie das Kreuz selbst.
Welche Merkmale kennzeichnen den Kopf der Christusfigur?
Der Kopf ist stark nach vorne geneigt und der Nacken ist in einem unnatürlich großen Winkel herausgedehnt, was den Eindruck von Anspannung erzeugt. Die Gesichtszüge sind geprägt von tief eingeschnittenen Falten, und die Modellierung des Profils von Nase und Kinn ist scharf geschnitten. Das Haupthaar und der Bart sind in tiefen, parallel angelegten Einkerbungen dargestellt.
Was ist besonders an der Haltung der Christusfigur?
Die Figur beschreibt eine große, nach links gewölbte Kurve und wirkt wie ein Kreisbogen. Der Oberkörper und das Lendentuch wirken wie aufeinandergesetzte Blöcke, die der Bewegung entgegenstehen. Die Haltung wirkt unnatürlich und angespannt.
Wie ist der Oberkörper der Christusfigur gestaltet?
Im Gegensatz zum Gesicht und zum Lendentuch ist der Oberkörper kaum gegliedert und seine Oberfläche ist kaum differenziert. Anatomische Details wie herauswölbende Rippen fehlen. Der Oberkörper ist durch ein Zingulum streng horizontal gegen das Lendentuch abgegrenzt.
Wie ist das Lendentuch (Perizoma) gestaltet?
Das Lendentuch ist durch harte, senkrechte Falten gegliedert, die in ihrer streng parallelen Anlage dem Aufbau der Haupt- und Barthaare ähneln. Das Tuch wirkt nicht stofflich, sondern eher wie erstarrtes Holz. Es dominiert die untere Körperpartie und steht in seiner strengen Vertikalität der Bewegung des Körpers entgegen.
Welchen Gesamteindruck vermittelt die Figur?
Die Figur ist erfüllt von einander entgegengesetzten Kräften: Bewegung und Starre, weiche Kurven und harte Formen, detailreiche und kaum differenzierte Bereiche. Diese komplexe Struktur macht das Kruzifix aus St. Georg zu einem besonderen Werk.
Welche Literatur wird im Text zitiert?
Folgende Literatur wird zitiert:
- Budde, Rainer. Deutsche Romanische Skulptur. 1050-1250. München 1979.
- Legner, Anton. Deutsche Kunst der Romanik. München 1982.
- Legner, Anton, Hrsg. Monumenta Annonis. Weltbild und Kunst im Hohen Mittelalter. Köln 1975.
- Legner, Anton, Hrsg. Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln. Bd.2. Köln 1985.
- Legner, Anton, Hrsg. Rhein und Maas. Kunst und Kultur. 800-1400. Köln 1972.
- Wesenberg, Rudolf. Frühe Mittelalterliche Bildwerke. Die Schulen Rheinischer Skulptur und ihre Ausstrahlung. Düsseldorf 1972.
- Arbeit zitieren
- Florian Janner (Autor:in), 1999, Das Kruzifix aus der Kirche St. Georg in Köln, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97565