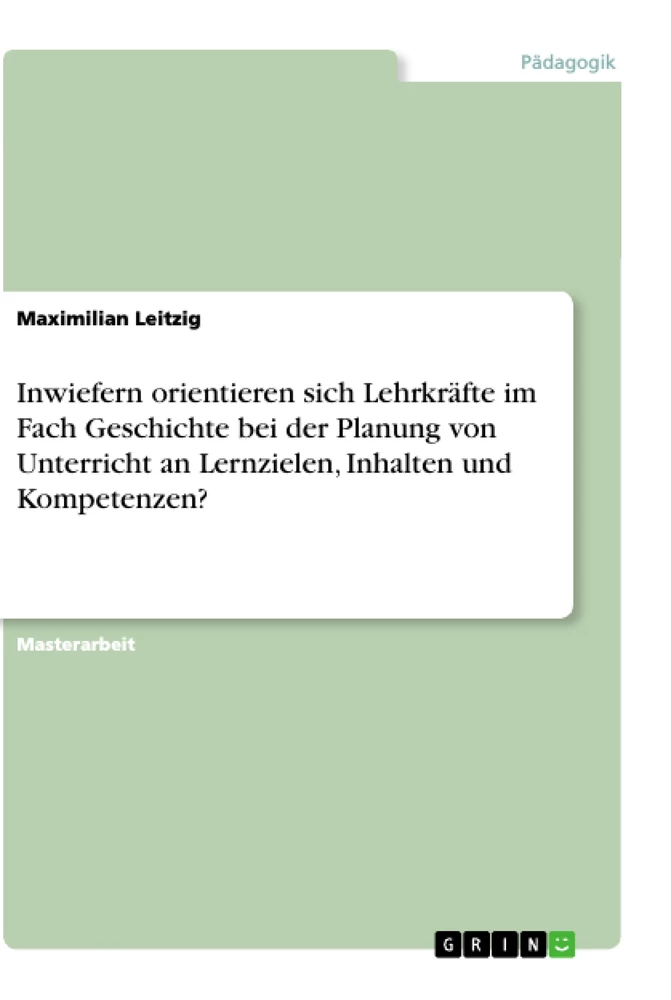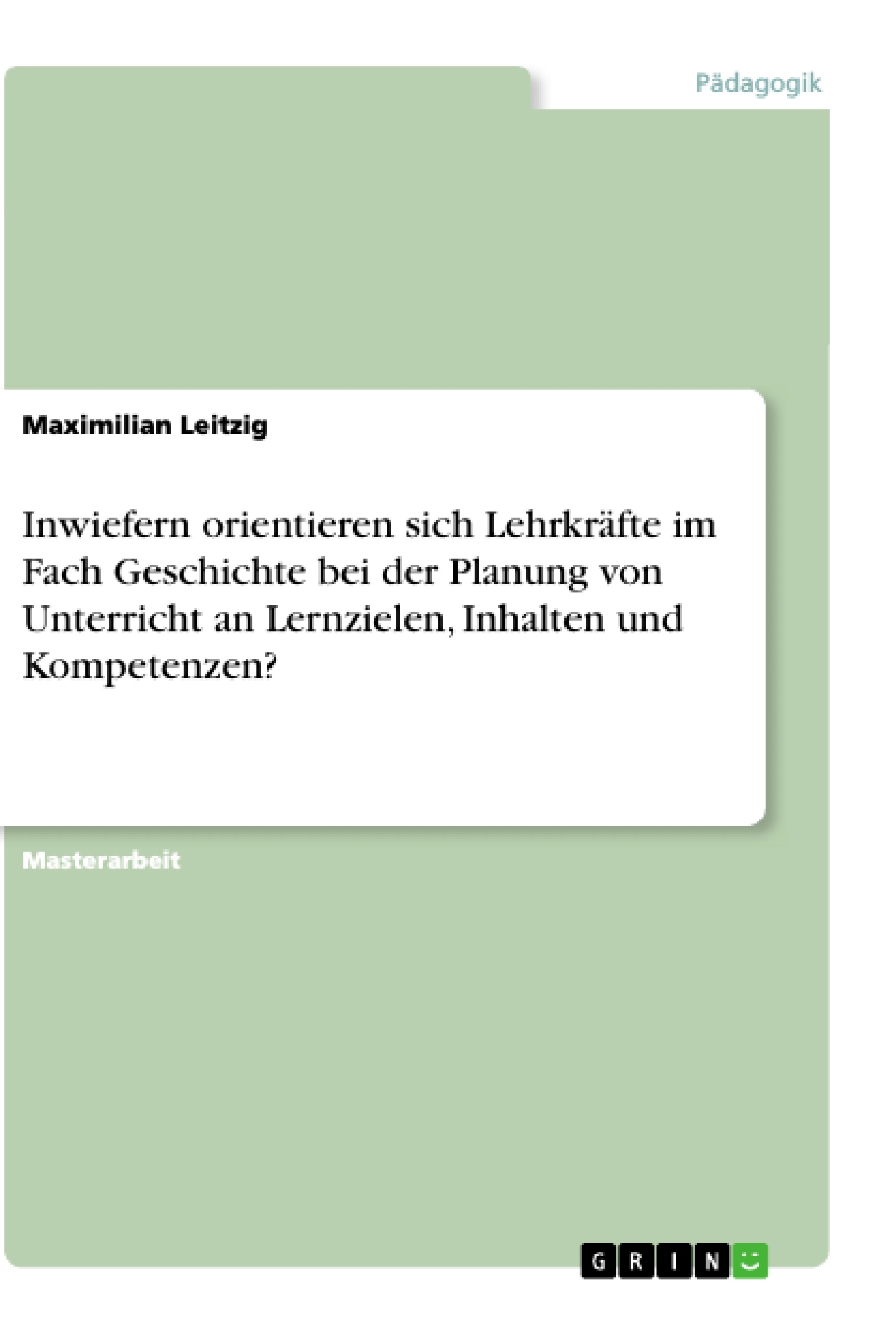In Rahmen der Masterarbeit, welche in der Fachrichtung Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg verfasst wird, soll untersucht werden, inwieweit sich Lehrkräfte im Fach Geschichte an Lernziele, vorgegebene Inhalte und Kompetenzen orientieren, wenn sie Ihren Unterricht planen.
Die Arbeit gliedert sich in einen Theorieteil, welcher die didaktischen Theorien der Lernzielorientierung nach Christine Möller, des bildungstheoretischen Ansatzes nach Wolfgang Klafki sowie die derzeit vorherrschende Kompetenzorientierung reflektiert und Auszüge der jeweils aktuellen Bildungspläne darstellt. Im empirischen Teil soll mithilfe einer qualitativen Untersuchung im Rahmen von Interviews, welche mit zehn Lehrkräften der Sekundarstufe I geführt wurden, deren Transkripte sowie der anschließenden Kategorisierung nach Mayring und einer qualitativen Inhaltsanalyse auf die Forschungsfragen eingegangen und versucht werden diese zu beantworten.
Die Ergebnissen können eine wesentliche Relevanz für die Forschung innerhalb der Erziehungswissenschaft haben, welche sich mit der Unterrichtsplanung, der Sichtweise von Lehrkräften auf die Bildungspläne sowie den aktuellen Umgang mit der Kompetenzorientierung beschäftigt.
Lehr-und Bildungspläne gelten als Grundlage für die Planung von Unterricht im schulischen Kontext. Diese Pläne werden seit Jahrzehnten anhand verschiedener didaktischer Ansätze und Theorien ausgerichtet und haben ihren Schwerpunkt entweder auf der Vermittlung von Lernzielen, Inhalten oder seit dem Bildungsplan aus dem Jahr 2004 auf Kompetenzen. Für Lehrkräfte ist dieser Wechsel der Lehr-und Bildungspläne oftmals mit Umstrukturierungen und Umstellungen verbunden. Nicht nur an Schulen, sondern auch an Hochschulen und universitären Einrichtungen veränderte sich die Vermittlung der didaktischen Theorien, Ansichten zum Lehren und Lernen sowie zur Unterrichtskultur. Hierbei stellt sich die Frage, nach welchen Prinzipien Lehrkräfte der Sekundarstufe I in der schulischen Praxis vorgehen und an welchen Ansätzen sie sich bei der Planung von Unterricht orientieren. Ebenfalls ist interessant zu betrachten, inwieweit Lehrkräfte sich noch mit didaktischen Theorien auseinandersetzen und diese als Planungsgrundlage für den schulischen Unterricht nutzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- A: Theoretischer Teil
- 1. Die Nutzung von Lernzielen in den 1970er und 1980er Jahren
- 1.1 Die Einführung der Lernziele im schulischen Kontext
- 1.2 Die Lernzielorientierung in den Bildungsplänen der 1970er und 1980er Jahre
- 1.3 Korrespondierende Didaktik: Die lernzielorientierte Didaktik nach Christine Möller
- 1.4 Korrespondierende Didaktik: Die Curriculumstheorie nach Robinsohn
- 1.5 Die Nutzung von Lernzielen in der Kontroverse
- 2. Von der Nutzung der Lernziele zur „Inhaltsorientierung“ in den Bildungsplänen der 1990er Jahre
- 2.1 Einführung der „Inhaltsorientierung“
- 2.2 Der inhaltsorientierte Lehrplan der 1990er Jahre
- 2.3 Korrespondierende Didaktik: Die bildungstheoretische Didaktik nach Wolfgang Klafki
- 2.3.1 Unterrichtsplanung nach Klafkis Modell
- 2.4 Die „Inhaltsorientierung“ in der Kontroverse
- 3. Von der „Inhaltsorientierung“ zur Kompetenzorientierung
- 3.1 Der „PISA-Schock“ und seine Folgen
- 3.2 Die Einführung der Bildungsstandards
- 3.2.1 Bezugspunkte der Standards
- 3.2.2 Merkmale guter Bildungsstandards
- 3.2.3 Die Sicht der KMK
- 3.3 Zur aktuellen Nutzung des Begriffs „Kompetenz“
- 3.4 Kompetenzorientierung im schulischen Unterricht
- 3.5 Die Kompetenzen im aktuellen Bildungsplan aus dem Jahr 2016
- 3.6 Die Kompetenzorientierung in der Kontroverse
- B: Empirischer Teil
- 4. Forschungsstand und aktuelle Befunde
- 5. Forschungsmethodische Entscheidungen
- 5.1 Zielsetzung der Studie und Forschungsfragen
- 5.2 Wahl des methodischen Verfahrens und Untersuchungsdesign
- 5.3 Theoretische Konzeption der Studie
- 5.4 Beschreibung der erhobenen Daten und Stichprobe
- 6. Datenerhebung
- 6.1 Methode Interview
- 6.1.1 Das halbstrukturierte Leitfaden-Interview
- 7. Verfahren der Datenaufbereitung und -auswertung
- 7.1 Beschreibung der Ergebnisse und interpretative Einordnung
- 7.2 Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht, wie Geschichtslehrkräfte der Sekundarstufe I bei der Unterrichtsplanung Lernziele, Inhalte und Kompetenzen berücksichtigen. Die Arbeit analysiert den Wandel didaktischer Ansätze von der Lernzielorientierung über die Inhaltsorientierung hin zur Kompetenzorientierung und deren Auswirkungen auf die Praxis. Sie beleuchtet die Relevanz verschiedener didaktischer Theorien (Möller, Klafki) für die Unterrichtsplanung.
- Wandel didaktischer Ansätze in der Geschichtsdidaktik
- Einfluss von Lernzielen, Inhalten und Kompetenzen auf die Unterrichtsplanung
- Relevanz der Theorien von Möller und Klafki für die aktuelle Praxis
- Analyse der Kompetenzorientierung im Geschichtsunterricht
- Empirische Untersuchung der Praxis von Geschichtslehrkräften
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung beleuchtet die Unsicherheiten von angehenden Lehrkräften bezüglich der Gewichtung von Lernzielen, Inhalten und Kompetenzen bei der Unterrichtsplanung. Sie führt in die Forschungsfrage ein, die sich mit der Orientierung von erfahrenen Geschichtslehrkräften an diesen Aspekten beschäftigt und den Einfluss von Lehr- und Bildungsplänen auf die Praxis untersucht. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der didaktischen Theorien und deren praktische Anwendung im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I.
1. Die Nutzung von Lernzielen in den 1970er und 1980er Jahren: Dieses Kapitel beschreibt die Einführung und die Rolle von Lernzielen im schulischen Kontext der 1970er und 1980er Jahre. Es analysiert die lernzielorientierte Didaktik nach Christine Möller und die Curriculumstheorie nach Robinsohn, und setzt diese in den Kontext der damaligen Bildungspläne. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der Kontroverse um die ausschließliche Lernzielorientierung.
2. Von der Nutzung der Lernziele zur „Inhaltsorientierung“ in den Bildungsplänen der 1990er Jahre: Dieses Kapitel untersucht den Wandel von der Lernzielorientierung hin zur „Inhaltsorientierung“ in den Bildungsplänen der 1990er Jahre. Es analysiert den inhaltsorientierten Lehrplan und die bildungstheoretische Didaktik nach Wolfgang Klafki, inklusive seiner Konzeption der Unterrichtsplanung. Die Kontroversen um den inhaltsorientierten Ansatz werden ebenfalls beleuchtet.
3. Von der „Inhaltsorientierung“ zur Kompetenzorientierung: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung von der Inhaltsorientierung zur Kompetenzorientierung, ausgelöst durch den „PISA-Schock“. Es analysiert die Einführung von Bildungsstandards, deren Merkmale und die Position der Kultusministerkonferenz (KMK). Die aktuelle Nutzung des Kompetenzbegriffs, seine Umsetzung im Unterricht und die Kontroversen um die Kompetenzorientierung werden detailliert untersucht, mit besonderem Fokus auf den Bildungsplan von 2016.
Schlüsselwörter
Unterrichtsplanung, Geschichtsdidaktik, Lernziele, Inhalte, Kompetenzen, Lernzielorientierung, Inhaltsorientierung, Kompetenzorientierung, Christine Möller, Wolfgang Klafki, Bildungsstandards, Bildungsplan 2016, Sekundarstufe I, Qualitative Forschung, Interview, Qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Unterrichtsplanung im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht, wie Geschichtslehrkräfte der Sekundarstufe I bei der Unterrichtsplanung Lernziele, Inhalte und Kompetenzen berücksichtigen. Sie analysiert den Wandel didaktischer Ansätze von der Lernzielorientierung über die Inhaltsorientierung hin zur Kompetenzorientierung und deren Auswirkungen auf die Praxis.
Welche didaktischen Theorien werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Relevanz verschiedener didaktischer Theorien, insbesondere die lernzielorientierte Didaktik nach Christine Möller und die bildungstheoretische Didaktik nach Wolfgang Klafki, für die Unterrichtsplanung.
Welche Zeiträume werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Wandel der didaktischen Ansätze über verschiedene Zeiträume: die Lernzielorientierung der 1970er und 1980er Jahre, die Inhaltsorientierung der 1990er Jahre und die Kompetenzorientierung ab dem „PISA-Schock“ bis zum Bildungsplan 2016.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil analysiert die Entwicklung didaktischer Ansätze. Der empirische Teil beinhaltet eine Studie zur Praxis von Geschichtslehrkräften, deren Methodik (halbstrukturierte Interviews) und die Auswertung der Ergebnisse.
Welche Forschungsmethoden wurden angewendet?
Im empirischen Teil der Arbeit wurde eine qualitative Forschungsmethode verwendet: halbstrukturierte Leitfadeninterviews mit Geschichtslehrkräften. Die Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
Welche Aspekte der Unterrichtsplanung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Lernzielen, Inhalten und Kompetenzen auf die Unterrichtsplanung im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I und wie Lehrkräfte diese Aspekte in ihrer Praxis berücksichtigen.
Welche Rolle spielen Bildungsstandards und der Bildungsplan 2016?
Die Arbeit analysiert die Einführung von Bildungsstandards nach dem „PISA-Schock“ und deren Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung. Der Bildungsplan 2016 wird als aktueller Bezugspunkt für die Kompetenzorientierung untersucht.
Welche Kontroversen werden thematisiert?
Die Arbeit beleuchtet die Kontroversen um die ausschließliche Lernzielorientierung, den inhaltsorientierten Ansatz und die Kompetenzorientierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Unterrichtsplanung, Geschichtsdidaktik, Lernziele, Inhalte, Kompetenzen, Lernzielorientierung, Inhaltsorientierung, Kompetenzorientierung, Christine Möller, Wolfgang Klafki, Bildungsstandards, Bildungsplan 2016, Sekundarstufe I, Qualitative Forschung, Interview, Qualitative Inhaltsanalyse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Geschichtslehrkräfte der Sekundarstufe I bei der Unterrichtsplanung Lernziele, Inhalte und Kompetenzen berücksichtigen und analysiert den Wandel didaktischer Ansätze und deren Auswirkungen auf die Praxis.
- Arbeit zitieren
- Maximilian Leitzig (Autor:in), 2020, Inwiefern orientieren sich Lehrkräfte im Fach Geschichte bei der Planung von Unterricht an Lernzielen, Inhalten und Kompetenzen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/975649