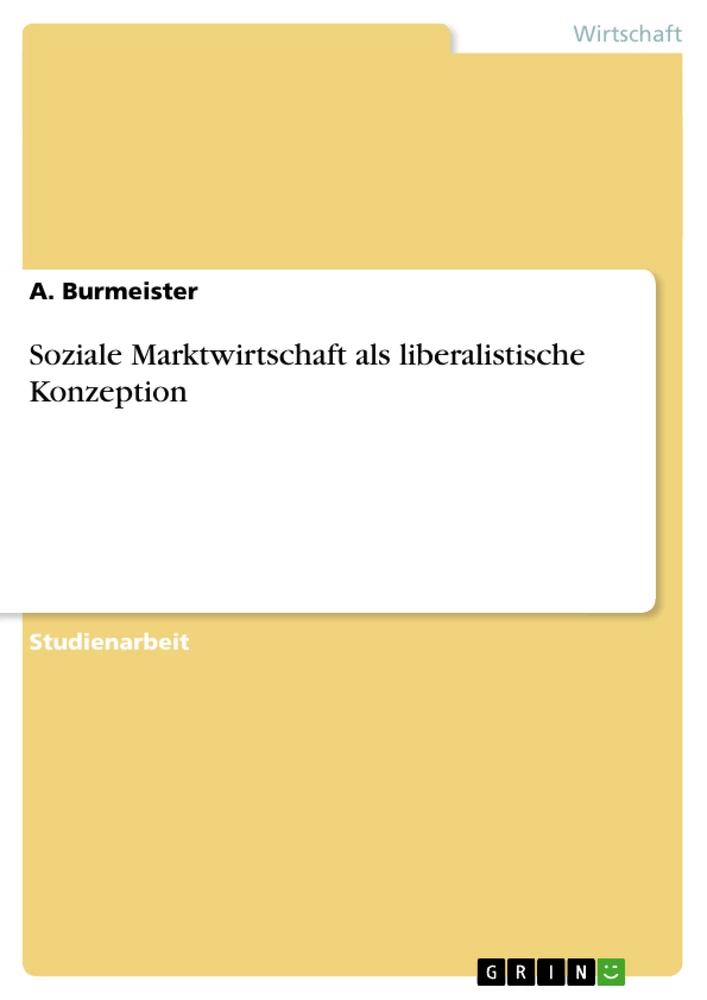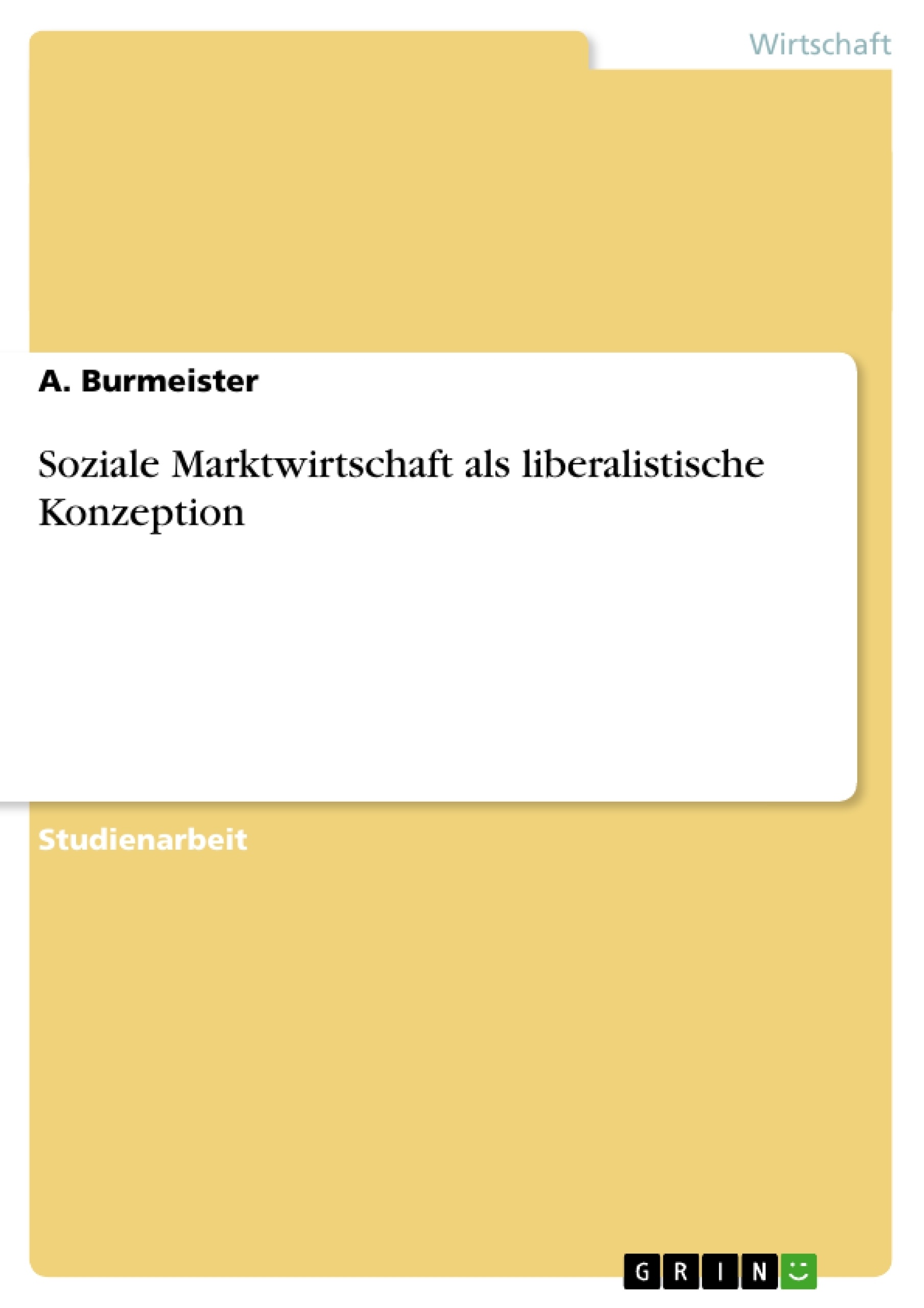Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Entstehung der Sozialen Marktwirtschaft
2.1. Das historisch-politische Umfeld
2.1.1 Diskreditierung der Planwirtschaft
2.1.2 Genesis der Sozialen Marktwirtschaft
2.2 Die Grundelemente der Sozialen Marktwirtschaft
3. Schlußbetrachtung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die `Soziale Marktwirtschaft´ wird heute von vielen als die bedeutendste Errungenschaft der Nachkriegszeit in Deutschland betrachtet. Sie wird allerdings sehr unterschiedlich eingeordnet. W. Karrte schreibt z.B., daß die Idee der Marktwirtschaft (die er im übrigen Ludwig Erhard zuschreibt1 ) es Deutschland leicht gemacht habe, dem Sozialismus zu widerstehen und das Land gleichzeitig vor dem Kapitalismus bewahrt habe.2 F.A. von Hayek hingegen lehnte das Konzept der sozialen Marktwirtschaft ab. Er bezeichnete das Wort `sozial´ als `Wieselwort´, das der Marktwirtschaft ihren Wortsinn raube3. Es ist zu vermuten, daß er diesen begrifflichen Dissens zwischen `Marktwirtschaft´ und `Sozial´ (-politik) auch inhaltlich verstanden sehen wollte. Deutlich wird, daß hinter dem Begriff Soziale Marktwirtschaft unterschiedlichste Konzepte und Inhalte verstanden werden. ,,Im politischen Sprachgebrauch ist der Begriff zu einer Formel geworden, mit der man Zustimmung zum status quo signalisiert, sie ist symbolisch hoch besetzt und inhaltlich fast völlig leer."4 Sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeberverbände, sowohl die CDU als auch die SPD wähnen sich als die Erben der Begründer der Sozialen Marktwirtschaft.
Heute wird tatsächlich gefragt, ob das derzeitige Wirtschaftssystem in Deutschland noch dem - damals - gewollten Konzept entspricht. H.O. Henkel meint, es sei im Laufe der Jahrzehnte Schritt für Schritt davon abgewichen worden. Er verweist auf die hohe Staatsquote und stellt fest, daß Deutschland verstärkt wieder Zuflucht zu defensiven Strategien suche, um wirtschaftlicher Krisen Herr zu werden.5 T. Bentz erkennt hingegen schon in den frühen Jahren eine Umkehrung des Modells. Das originäre Konzept `Überwindung des Wohlfahrtstaates durch Marktwirtschaft und Privateigentum´ sei als `Marktwirtschaft plus Wohlfahrtstaat´ falsch verstanden worden, statt bei steigendem Wohlstand weniger Staatsfürsorge zu bieten, hätten Sozialpolitiker nur daran gedacht, daß man sich nun ja mehr Sozialleistungen erlauben könne.6 D. h., es besteht offenbar ein starker Dissens in der Frage, ob der Schwerpunkt der Sozialen Marktwirtschaft mehr auf dem Sozialen oder der (liberalen) Marktwirtschaft liegt.
Aufgabenstellung dieser Arbeit ist es nachzuweisen, daß das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft (zumindest bei seiner Entwicklung und Ingangsetzung) ein liberalistisches war. Um dies zu zeigen, wird in dieser Arbeit zunächst geschildert, in welcher historischen, politischen und auch wirtschaftlicher Situation die Soziale Marktwirtschaft erdacht und eingeführt wurde. Dabei wird besonders auf die Ziele, die ihre Erfinder mit ihrer Verwirklichung verfolgten eingegangen. Im folgenden wird die geistige Entstehungsgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft eingegangen. Im wesentlichen wird dabei auf A. Müller-Armack bezug genommen. Eine Darstellung der wichtigsten Elemente des schließlich eingeführten Modells soll die praktischen Folgen des theoretischen Konzeptes auf dem Markt und in der Politik zeigen. Abschließend wird anhand des Erarbeiteten zusammenfassend dargestellt, daß die Soziale Marktwirtschaft tatsächlich nur ein liberal oder liberalistisch inspiriertes Modell gewesen sein kann.
2. Die Entstehung der Sozialen Marktwirtschaft
Der Begriff Soziale Marktwirtschaft wurde erstmals von Müller-Armack verwendet,7 er bezeichnete ein von ihm entwickeltes Modell zur Wirtschaftsordnung, in dem verschiedene soziale Elemente integriert waren. Die Bezeichnung setzte sich schnell durch, vor allem aufgrund seiner Verwendung durch Ludwig Erhard, als plakatives Schlagwort in der politischen Diskussion.
Der Hintergrund der Sozialen Marktwirtschaft war der Wunsch nach der Schaffung eines sogenannten `Dritten Weges´ zwischen dem Manchesterkapitalismus und der Planwirtschaft. Welche Argumente gegen diese beiden Reinformen der Wirtschaftslehre sprachen, wird hier noch erläutert. Wolfgang Kartte bezeichnet das Ergebnis denn auch als ,,...sozial gebändigte Marktwirtschaft Sie ist der Versuch, den Sozialdarwinismus der reinen Marktwirtschaft zu vermeiden, ohne die Vorteile der Marktsteuerung zu verlieren."8
2.1. Das historisch-politische Umfeld
Für das deutsche Wirtschaftssystem schlug mit dem Ende der Hitler-Diktatur und ihrer Kriegswirtschaft die Stunde Null. Der Zusammenbruch der Nahrungsversorgung, die Zerstörung der Wohn- und Infrastruktur, die Flüchtlingsproblematik und teilweise Zerstörung der deutschen Industrie9 machten die schnelle Neuplanung einer adequaten Wirtschaftsordnung notwendig. Der Verzicht der Alliierten auf die Verwirklichung von Plänen wie dem Morgenthau-Plan machte auch politisch den Weg für Alternativen frei. A. Müller-Armack formulierte das Dilemma. ,,Wir stehen gegenwärtig vor der Alternative, zwischen der Lenkungswirtschaft und der Marktwirtschaft zu wählen. In dieser Alternative liegt das wirtschaftspolitische Problem unserer Gegenwart."10
2.1.1 Diskreditierung der Planwirtschaft
In Europa war bis in die 40er-Jahre hinein ordnungspolitisch eine Haltung vorherrschend, die unterstellte, daß die marktwirtschaftliche Ordnung während der großen Wirtschaftskrisen in den 30er Jahren zusammengebrochen sei. Es bedürfe einer relativ starken Lenkung der Wirtschaft durch den Staat, um die in der Vergangenheit erlebten Nachteile der Marktwirtschaft zu vermeiden. In vielen Staaten gab es daher mehr oder minder restriktive Auflagen für die Wirtschaft. Vor allem die Vermeidung von Massen-Arbeitslosigkeit und die Garantie der Existenz (z.B. durch festgesetzte Preise) ließen die Lenkungswirtschaft in einem günstigen Licht erscheinen und stärkten sie ideologisch.
Die Planwirtschaft, in der Literatur auch als Wirtschaftslenkung bezeichnet, ist ,,...historisch gesehen, als Antithese zur liberalen Marktordnung entstanden."11 Das Unterbinden des marktwirtschaftlichen Austausches von Gütern erfolgt hier durch eine zentrale Lenkung. Die Ziele dieser Wirtschaftsordnung sind letztlich dieselben wie die aller anderen Modelle, u.a. die gemeinnützige Ausrichtung, die Vollbeschäftigung und die Nahrungssicherung.12
Die Kriegswirtschaft vor und während des Krieges 1939-1945 führte zu einer besonders starken Lenkung, sie führte Bewirtschaftung fast aller Konsum- und Investitionsgüter. Nach Müller-Armack stellt diese totale Bewirtschaftung den natürlichen Endpunkt der Wirtschaftslenkung dar. ,,Es gehört zur inneren Logik der Wirtschaftslenkung, auf alle Schwierigkeiten die ihr begegnen, und auf alle Anpassungen, die ihr abgefordert werden, mit einer immer kräftigeren Herauslösung der Wirtschaft aus dem Marktprozeß zu antworten."13
Eine ernsthafte Analyse der Lenkungswirtschaft begann - zumindest in Deutschland - erst in den Kriegsjahren bzw. unmittelbar nach dem Krieg. Dabei wurden verschiedene, gravierende Probleme festgestellt.
Zum einen war die Lenkungswirtschaft weniger für den Konsumenten, als für den Staat selbst vorteilhaft. Die Planwirtschaft versuchte, über das in der Marktwirtschaft mögliche hinaus, die Wirtschaft für den Staat einzusetzen. Preisstopps dienten primär dazu, den Staat vor der Einengung seiner Kaufmöglichkeiten zu schützen.14
Zum anderen trug die dem Lenkungssystem zugewiesene Rolle als Unterstützer der Konsumenten nicht. Die Verfügung des Staates über Preise, Mengen und Güter beraubte die Konsumenten ihrer Wahlfreiheit. ,,Die Ausschaltung der marktwirtschaftlichen Ordnung schafft unweigerlich eine Situation, in der die Produktion die eigentliche Richtung des
Bedarfs gar nicht mehr kennt.15 " Insgesamt sanken die Konsummöglichkeiten, da ja der Staat mehr konsumierte. Auch die Argumentation, daß ja der Konsument Nutznießer des Staatskonsums und seiner Investitionen sei, wurde nicht nachvollzogen. Zum einen trat in allen Staatsgebilden auch Staatsverschwendung auf, zum anderen konnte eben nicht der Konsument selbst über den Grad seiner Ersparnis- und Kapitalbildung entscheiden.16
Für Betriebe und Unternehmer fiel die Bilanz ebenfalls negativ aus. Zwar wurden u.a. Kosten (Lohnstopp) und Umsätze (Preisstopp) fixiert, allerdings blieb die Versorgung mit Vorprodukten oder Rohstoffen unsicher. Der Regulator der Knappheit, der freie Preis fehlte. Es waren Kontingentierungen zu erwarten. Eine Veränderungen der mengenmäßigen Disposition konnte nicht mehr über den Preis erfolgen, sie war aufgrund des zugeteilten Arbeits- und Rohstoffkontingentes auch schwer denkbar. Wichtige Handlungsfreiheiten waren dem Unternehmer so genommen.17
Eine Verbesserung der Situation der Beschäftigten konnte nicht festgestellt werden. Die - unstreitige - Übernachfrage nach Arbeitskräften, die Vermeidung von Massenarbeitslosigkeit, wurde letztlich durch eine künstlich herbeigeführte Senkung der Arbeitsbewertung herbeigeführt,18 deren äußeres Zeichen der Lohnstopp war. Das bedeutete für die große Mehrheit der Beschäftigten einen Kaufkraftverlust, wenn ihr ein Anteil am Konjunkturanstieg versagt blieb. Darüber hinaus unterlagen sie schnell der Arbeitsplatzzuweisung, denn die Tendenz der Betriebe, sich gegenseitig Arbeitskräfte abzuziehen (das Arbeitsangebot steigt ja nicht mit den festgesetzten Löhnen) konnte nur dadurch Einhalt geboten werden.
In Anbetracht der vielfältigen, drängenden Probleme der Nachkriegszeit war die Ansicht, daß nur die Planwirtschaft diese lösen könne, weit verbreitet. Die Bereitstellung der nötigsten Güter und Dienste konnte angeblich nur über die Lenkung sichergestellt werden. Die Gegner dieser Einstellung hingegen zogen aufgrund der o.g. Feststellungen ein anderes Fazit. Sie waren der Ansicht, ,,...daß diese Überlegenheit der zentral gelenkten Wirtschaft, ... keinesfalls gegeben ist."19 Sie wiesen auf die Leistungen der Marktwirtschaft hin, die bisher viel zu selten diskutiert wurden. So hätte sie gerade nach dem ersten Weltkrieg eine immense Aufbauleistung vollbracht. Die direkten Kriegsschäden seien schnell beseitigt, die Versorgungslage spürbar verbessert worden.
Ferner sei es unlogisch, für die große Aufgabe der Anpassung und Umstellung der Kriegswirtschaft auf die Aufgaben des Friedens, eine Wirtschaftsordnung zu wählen, die grundsätzlich auf starre Bindungen und gerade nicht auf Anpassung setze.20 Im Übrigen wurde darauf verwiesen, daß durch die ökonomischen Zwangsmaßnahmen die persönliche
Freiheit des Einzelnen stark reduziert würde, dieser Eingriff sei mit einem liberalen Freiheitsbegriff kaum zu verbinden.
Die Lösung für eine künftige Wirtschaftsordnung konnte für ihre Gegner nicht die Planwirtschaft sein. Eine Rückkehr zur alten Marktwirtschaft war für viele Anhänger dieses Modells aber auch nicht denkbar. Trotz ihrer Schwächen jedoch, ,,...als ökonomisches und soziales Organisationsmittel erweist sich diese Ordnung [der Marktwirtschaft] der Wirtschaftslenkung durchaus als überlegen."21 Für die Zukunft gut geeignet erschien ein Wirtschaftssystem, daß die wesentlichen ökonomischen Elemente der Marktwirtschaft mit zeitgemäßen und sinnvollen Ergänzungen verband.
2.1.2 Genesis der Sozialen Marktwirtschaft
Die Entstehung der Sozialen Marktwirtschaft ist ohne die grundlegenden ökonomischen Arbeiten vor allem der klassischen Liberalen nicht denkbar. Adam Smiths `Wohlstand der Nationen´ gilt dabei als eigentlicher Beginn der Ökonomie als Wissenschaft.22 Er legte den Grundstein für liberale Wirtschaftsvorstellungen. Prinzip ist bei ihm wie den anderen klassischen Liberalen dabei eine Arbeitsteilung zwischen Staat und Wirtschaft. ,,Der Staat hat danach also durchaus wichtige und notwendige Funktionen zu übernehmen, die Wirtschaft aber übernimmt die Aufgaben, die von ihr besser als vom Staat gelöst werden können."23 Die Notwendigkeit eines ggf. auch starken Staates wurde also anerkannt. Unterschiedliche Interpretationen gab es beim Ausmaß der staatlichen Beteiligung.
John Stuart Mill erweiterte als einer der ersten die Einflußsphäre des Staates. Er fordert staatliche Betätigung in den Bereichen Bildung, Forschung, Konfliktlösung, Eigentumsschutz und Sozialpolitik, tritt für Aktivitäten des Staates zur Herbeiführung von Chancengleichheit ein und wünscht die Bildung von Gewerkschaften.24 Grundsätzlich sieht er den Staat dort gefordert, wo es daß allgemeine Interesse, jenes von hilflosen Gesellschaftsmitgliedern oder das für zukünftige Generationen erfordern. Allerdings nur dann, wenn niemand anderes, dies tun kann oder möchte.25
In der Praxis wurde das soziale Moment der Klassiker allerdings kaum wahrgenommen. Der sogenannte Wirtschaftsliberalismus oder auch Kapitalismus zeigten schnell soziale Schieflagen. Der Staat verstand das `Laissez-faire-Prinzip´ als Aufforderung zum Rückzug aus den Wirtschaftsabläufen, er spielte nur eine Nachtwächterrolle. In der Folge unterstützen
viele Ökonomen Korrekturen am ausgeübten Liberalismus. Impulse gingen in Deutschland gegen 1875 sowohl vom von Ökonomen begründeten `Verein für Socialpolitik´ als auch der christlichen Soziallehre aus.26 Die Ökonomen jener Zeit (z.B. Wagner, Schmoller und Brentano) behielten die liberalen Grundideen bei. Sie sahen jedoch in der Sozialen Frage eine neue Herausforderung.
Mittlerweile lagen mit den ersten Erfahrungen auch erste Untersuchungen vor, die Veränderungen am Modell der liberalen Wirtschaftsordnung anregten. Die damals entstehende Historische Schule begann erstmals mit einem systematisch-historischen Vergleich unterschiedlicher Wirtschaftsstile, aus denen Schlußfolgerungen gezogen werden konnten.
Die Zäsur des Ersten Weltkrieges stellte Deutschland zum ersten Mal vor die Frage des zukünftigen Wirtschaftssystems. Die Berücksichtigung von sozialen Elementen war in der Ökonomie noch nicht sehr weit diskutiert und verbreitet. ,,Gleichwohl gab es im Kern schon die Frage: kollektivistische versus marktwirtschaftliche (individualistische) Lösung "27 Die Entscheidung für die Marktwirtschaft fiel ohne Klarheit über die wesentlichen Inhalte der Wirtschaftsordnung. In der Folge wechselten sich die Rezepte der Regierungen ab, ausgelöst meist durch Krisen. Diese Zeit wurde später auch als `systemloser Interventionismus´ bezeichnet.
Wie weiter oben bereits geschildert überwogen zunächst die positiven Eindrücke und Erfolge der Marktwirtschaft. Die Inflation, die Währungsreform und die Weltwirtschaftskrise mit ihren Folgen erschütterte dann aber zunehmend den Glauben an die Kraft der liberalen Wirtschaftsordnung.
In dieser - für die Marktwirtschaft - wenig erfolgreichen Zeit, gelangen der Ökonomie grundlegende Arbeiten. Die Grundfragen und Grundlagen der freien Marktwirtschaft sowie der staatlichen Eingriffe wurden präziser herausgearbeitet und untersucht. Besonders zu erwähnen sind hier Ludwig von Mises `Kritik des Interventionismus´ und Wilhelm Röpkes `Staatsinterventionismus´.
Auch im Ausland traten ähnliche Probleme mit der Akzeptanz der vorhandenen Wirtschaftsordnungen auf. Vor allem die Arbeiten John Maynard Keynes müssen auch als theoretische Aufarbeitung der Weltwirtschaftskrise verstanden werden.28 Aufgrund der neuen Forschungen und Theorien ,,...war jedenfalls der ideengeschichtliche Ansatz gegeben für eine neue liberale Wirtschaftspolitik, die sowohl die Grenzen des Staates als auch des Marktes deutlicher ziehen konnte."29
Die Periode des Nationalsozialismus, vor allem die Zeit der Kriegswirtschaft war, wie beschrieben, eine Zeit der straffen Lenkung. Trotzdem ging die Forschung der deutschen Ökonomen - wenn auch inoffiziell oder vom Ausland aus - weiter. So waren wichtige Wegbereiter der deutschen Ökonomie z.T. in die Türkei emigriert (z.B. Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow und Fritz Neumark), andere organisierten sich in kleinen Gruppen, die sich abweichend von der offiziellen Wissenschaft mit Fragen einer anderen wirtschaftlichen Ordnung befaßten. Sie setzten, bis auf wenige Ausnahmen, auf die Preisbildung am Markt.
Hier gab es u.a. einen Kreis um Carl Goerdeler, der ,,...am Ideal eines freien Welthandels [fest-]hielt, ganz ricardianisch im Sinne einer Optimierung der nationalen und weltweiten
Wohlfahrt."30 Die Arbeit dieser Gruppe wurde durch ihre frühe Entdeckung allerdings beendet, bevor eine Einigung über die Frage staatlicher Interventionen erzielt werden konnte.
Der sogenannte Kreisauer Kreis (Mitglieder waren u.a. Eugen Gerstenmaier, Horst von Einsiedel und Günter Schmölders) hatte ein stark vom Christentum geprägtes Bild von Staat und Wirtschaft. Die Wirtschaft sollte der Gemeinschaft und dem Einzelnen zu dienen. der Staat hatte Verteilungsgerechtigkeit zu garantieren. Allerdings sollten alle ordnungspolitischen Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt ihrer Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft überprüft werden.31 Ziel war ein `geordneter Leistungswettbewerb´, der allerdings umfangreiche staatliche Aktivitäten auf dem Markt (u.a. Sozialisierung der Grundstoffindustrien und Existenz eines öffentlich bewirtschafteten Sektors) vorsah.32
Für den Freiburger Kreis (Mitglieder waren u.a. Walter Eucken, Adolf Lampe, Constantin von Dietze und Franz Böhm) dominierten die wirtschaftlichen Vorteile der Marktwirtschaft. Die Mängel der Lenkungswirtschaft erkannten sie in der Uneffizienz in Allokation und Distribution. Trotzdem sollte eine bessere Verteilungsgerechtigkeit erreicht werden. Ihr Konzept war letztlich eine primär marktliche Wirtschaftsordnung,33 Konkurrenz und damit Wettbewerb sollte das Steuerinstrument dieser Ordnung sein, der Staat ,,...brauchte ... nur für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsordnung zu sorgen."34 Auch aktiv sollte der Markt von staatlicher Seite belebt werden. Hilfen beim Marktzutritt und eine mittelstandsfreundliche Politik waren durchaus erwünscht. Das Konzept dieser Gruppe nahm wesentliche Elemente der Sozialen Marktwirtschaft vorweg. ,,`Sozial´ war ihr ständiges Bestreben zum Schutz der schwächeren Marktseite, und `Marktwirtschaft´ war sie deswegen, weil die Steuerung durch flexible Preise soweit wie möglich zum Tragen kommen sollte."35
In der Nachkriegszeit wird die Frage nach der zukünftigen Ordnung akut. Alfred Müller Armack zieht für die marktwirtschaftlich orientierten in Deutschland das Fazit. ,,Der Weg ... kann nur über die Wiedererrichtung einer echten Marktwirtschaft gehen. Von der liberalen Marktwirtschaft des 19. Jahrhunderts, ... muß sich diese heutige Marktwirtschaft durch ihr soziales Ziel unterscheiden."36
Am 2. März 1948 wurde Ludwig Erhard zum Direktor für Wirtschaft in der Verwaltung der Bizone. Er hatte früher bereits als Mitarbeiter im Forschungsinstitut der deutschen Industrie Kontakte u.a. zur Gruppe um Goerdeler gehabt. 1943 schrieb er eine Denkschrift, die deutliche Ähnlichkeit mit den Vorstellungen der Freiburger Schule zeigte. In dieser Arbeit lehnte er Planwirtschaft und Verstaatlichung ab und stellte die Bedeutung von Währungsordnung und Wettbewerbssicherung an die zentrale Stelle einer zukünftigen Wirtschaftsordnung.37 Diese Vorstellungen behielt er bei, allerdings stand er als Anhänger einer marktwirtschaftlichen Konzeption bei den Besatzungsmächten recht allein. ,,Von den Alliierten hatte er [Erhard] ... nur die Amerikaner auf seiner Seite. In Großbritannien regierte gerade Labour, und Frankreich hatte sich seit 1946 der `Planification´ verschrieben."38 Trotzdem schlug er bereits kurze Zeit später dem von den Alliierten eingesetzten Wirtschaftsrat die Wiederherstellung des Preismechanismus und die Förderung des Wettbewerbs vor. Unterstützt wurde er dabei von einem Gutachten des wissenschaftlichen Beirates, zu dem u.a. die `Freiburger´ Böhm, Eucken und Lampe gehörten. Der Anfang war gemacht.
Nach und nach wurden jetzt die Gesetze und Verordnungen erlassen, die die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland ausmachen sollten.
2.2 Die Grundelemente der Sozialen Marktwirtschaft
Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft ist die Marktwirtschaft. Der Konsument, der durch seinen Konsum dem Markt die bestimmenden Signale erteilt, zwingt die Anbieter auf seine Wünsche (hinsichtlich Qualität, Sortiment und Preis) einzugehen. Alfred Müller-Armack nennt dies `echte Marktdemokratie´39 . Auch wenn schon die höhere Produktivität der Marktwirtschaft ein starkes soziales Element ist, sollen unterschiedliche Maßnahmen die soziale Sicherheit gewährleisten.40
So muß der Staat die Sicherung des Wettbewerbs ,,als bewußte Aufgabe öffentlicher Wirtschaftspolitik auffassen."41 Die Wettbewerbspolitik hat dabei sowohl äußere Einflusse wie die Währungssicherheit (Kaufkraftstabilität und Geldwertstabilität) sowie auch Tendenzen der Marktteilnehmer zur Marktausschaltung zu regulieren (Verhinderung von Kartellbildung).
So hat die Wettbewerbsordnung zu gewährleisten, daß das Erwerbsstreben der einzelnen in die dem Gemeinwohl erforderliche Richtung gelenkt wird.
Der Staat hilft mittels eines marktwirtschaftlich orientierten Einkommensausgleiches, unbefriedigende Einkommens- und Besitzstrukturen zu überwinden. Dies geschieht durch Besteuerung, Bezuschussung und Beihilfen für sozial Bedürftige. Die Einkommen werden jedoch durch Tarifvereinbarungen auf freier Grundlage vereinbart.
Zur Belebung der Konjunktur ist eine aktive Beschäftigungspolitik zu betreiben. Den Beschäftigten soll so in wirtschaftlichen Krisensituationen Sicherheit gegen werden. Neben finanz- und kreditpolitischen Aktivitäten sind auch staatliche Investitionen möglich.
Die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen sorgt für mehr soziale Aufstiegschancen und eine sozialere Betriebsstruktur. Zudem soll den Beschäftigten durch soziale Betriebsordnungen ein soziales Mitbestimmungsrecht im Unternehmen eingeräumt werden.
Weitere Bereiche staatlichen Handelns sind neben dem Ausbau der Sozialversicherung die Stärkung des genossenschaftlichen und sozialen Wohnungsbaus, die Siedlungspolitik und Städtebauplanung.
Obwohl das deutsche Grundgesetz keine Wirtschaftsordnung implizit vorschreibt, finden sich hier wesentliche Elemente der Sozialen Marktwirtschaft. Das Recht auf freie wirtschaftliche Betätigung, Gleichheit vor dem Gesetz, Vertrags- und Koalitionsfreiheit (auch für Gewerkschaften, Recht auf Streik und Aussperrung, freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl und die Gewährleistung des Privateigentums bei sozialer Verpflichtung. Auch in den abgeleiteten Gesetzen findet sich diese Spur. Zu nennen sind u.a. das Tarifvertragsgesetz von 1949, das Betriebsverfassungsgesetz von 1952, das Rentenreformgesetz von 1957, das Gesetz über die Deutsche Bundesbank von 1957 und jenes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.42
3. Schlußbetrachtung
Jedes theoretische Modell unterliegt im Zeitablauf Veränderungen. Das gilt auch für den Bereich der Wirtschaftsordnungen. Die - zumindest inhaltliche, manchmal auch personelle - Linie von den klassischen Liberalen über die Ordo-Liberalen der Freiburger Schule hin zu Ludwig Erhard und vor allem Alfred Müller-Armack ist in der vorliegenden Arbeit deutlich geworden.
Die Frage ist, was den Unterschied zwischen einer liberalen und einer Sozialen Marktwirtschaft ausmacht. Alfred Müller-Armack definierte seine Vorstellung der Sozialen Marktwirtschaft als ,,...keine sich selbst überlassene, liberale Marktwirtschaft, sondern eine bewußt gesteuerte, und zwar sozial gesteuerte Marktwirtschaft."43 Er weist häufiger auf die Mängel der `altliberalen´ Marktwirtschaft hin.44 Gleichzeitig betont er die Unverzichtbarkeit der marktwirtschaftlichen Ordnung.
Der Garant für eine langfristig erfolgreiche Wirtschaft und Wachstum ist die Marktwirtschaft. ,,Sozial wird diese Marktwirtschaft ... erst dadurch, daß sich im Produktionsprozeß ergebende `funktionale´ Einkommensverteilungen durch Sozialpolitik in die gesellschaftlich gewünschte `personelle Einkommensverteilung´ umgewandelt werden soll."45 Das grundsätzliche `freie Spiel der Kräfte´ auf dem Markt bleibt dabei, bis auf die erwähnten Ausnahmen, ja weitgehend ungestört.
Die überwiegende Meinung der Forschung sieht das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft als mehr oder weniger genaue praktische Durchführung des theoretischen ordo-liberalen Modells einer Wirtschaftsordnung, die Übereinstimmungen sind deutlich.46
Auch eine Bezugnahme auf den klassischen Liberalismusbegriff zeigt, daß die nun vorgenommene Verbindung zwischen Sozialstaat und Wirtschaft nicht neu ist. Wie bereits erwähnt, haben auch die Klassiker ihre Theorien nicht abstrakt erdacht. Ihre Absicht war, den Wohlstand zu mehren, und explizit sicher auch, diesen - wie auch immer - `gerecht´ zu verteilen. Insofern stellt der Entwurf der Sozialen Marktwirtschaft nur eine notwendige Korrektur am falsch verstandenen `laissez- faire´ des 19. Jahrhunderts dar. Diese Anpassung verhalf dem Liberalismus vermutlich auch zu seinem politischen Überleben in Europa. Die Einführung einer rein wirtschaftsliberalen Konzeption erschien nach 1945 nicht durchsetzbar, sie ist es heute auch nicht.
Literaturverzeichnis
BENTZ, Thomas: Ordnungspolitik light - oder Deutschlands verwässerte Marktwirtschaft, in: Ermrich, Roland (Hrsg.): 100 Jahre Ludwig Erhard - Das Buch zur Sozialen Marktwirtschaft, Düsseldorf 1997, S. 124-131
BLUM, Reinhard: Soziale Marktwirtschaft, Wirtschaftspolitik zwischen Neoliberalismus und Ordoliberalismus, Tübingen 1969
HASELBACH, Dieter: Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft, Baden-Baden 1991
HENKEL, Hans-Olaf: Die Soziale Marktwirtschaft - Hat das Konzept Ludwig Erhards eine Zukunft?, in: Ermrich, Roland (Hrsg.):100 Jahre Ludwig Erhard - Das Buch zur Sozialen Marktwirtschaft, Düsseldorf 1997, S. 68-73
KARTTE, Wolfgang: Soziale Marktwirtschaft heute, in: Ermrich, Roland (Hrsg.):100 Jahre Ludwig Erhard - Das Buch zur Sozialen Marktwirtschaft, Düsseldorf 1997, S. 138-149
MILL, John Stuart: Principles of Political Economy, erstveröffentlicht 1848, Fairfield 1976
MÜLLER, Elmar: Widerstand und Wirtschaftsordnung,- Die wirtschaftspolitischen Konzepte der Widerstandsbewegung gegen das NS-Regime und ihr Einfluß auf die soziale Marktwirtschaft, Frankfurt am Main 1988
MÜLLER-ARMACK, Alfred: Die Wirtschaftsordnung, sozial Gesehen, in: Müller-Armack, Alfred: Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern und Stuttgart 1975, S. 73-89
MÜLLER-ARMACK, Alfred: Vorschläge zur Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft, in: Müller-Armack, Alfred: Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern und Stuttgart 1975, S. 91-107
MÜLLER-ARMACK, Alfred: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Hamburg 1947
PIPER, Nikolaus: Der Mythos der Tat, in: Ermrich, Roland (Hrsg.): 100 Jahre Ludwig Erhard
- Das Buch zur Sozialen Marktwirtschaft, Düsseldorf 1997, S. 150-160
SCHLECHT, Otto: Grundlagen und Perspektiven der Sozialen Marktwirtschaft, Tübingen 1990
[...]
1 Vgl. Wolfgang Kartte: Soziale Marktwirtschaft heute, in: Roland Ermrich (Hrsg.):100 Jahre Ludwig Erhard - Das Buch zur Sozialen Marktwirtschaft, Düsseldorf 1997, S. 138-149, hier
S. 139
2 Vgl. ebenda
3 Vgl. Nikolaus Piper: Der Mythos der Tat, in: Roland Ermrich (Hrsg.): 100 Jahre Ludwig Erhard - Das Buch zur Sozialen Marktwirtschaft, Düsseldorf 1997, S. 150-160, hier S. 57
4 Dieter Haselbach: Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft, Baden-Baden 1991, S. 9-10
5 Vgl. Hans-Olaf Henkel: Die Soziale Marktwirtschaft - Hat das Konzept Ludwig Erhards
eine Zukunft?, in: Roland Ermrich (Hrsg.): 100 Jahre Ludwig Erhard - Das Buch zur Sozialen Marktwirtschaft, Düsseldorf 1997, S. 68-73, hier S. 69
6 Vgl. Thomas Bentz: Ordnungspolitik light - oder Deutschlands verwässerte
Marktwirtschaft, in: Roland Ermrich (Hrsg.): 100 Jahre Ludwig Erhard - Das Buch zur Sozialen Marktwirtschaft, Düsseldorf 1997, S. 124-131, hier S. 127
7 Vgl. Alfred Müller-Armack: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Hamburg 1947
8 Wolfgang Kartte: Soziale Marktwirtschaft heute, a.a.O., S. 140
9 Das Ausmaß der Zerstörung der (west-) deutschen Industrie und ihr Stand ist umstritten. D. Haselbach spricht im Gegensatz zu den Liberalisten von einer `nicht so gravierenden´ Beschädigung, der Modernisierungsgrad sei, als Folge der Kriegswirtschaft, sogar sehr hoch gewesen. Andere Aussagen qualifiziert er als neoliberale Propaganda. Vgl. Dieter Haselbach: Autoritärer Sozialismus und Soziale Marktwirtschaft, a.a.O., S. 10
10 Alfred Müller-Armack: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, S. 59
11 Alfred Müller-Armack: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, S. 14
12 Vgl. ebenda, S. 15
13 Ebenda, S. 16
14 Vgl. ebenda, S. 18-19
15 Ebenda, S. 21
16 Vgl. ebenda, S. 20
17 Vgl. ebenda, S. 25-26
18 Vgl. ebenda, S. 32
19 Ebenda, S. 55
20 Vgl. ebenda, S. 56
21 Ebenda, S. 57
22 Vgl. Otto Schlecht: Grundlagen und Perspektiven der Sozialen Marktwirtschaft, Tübingen 1990, S. 1
23 Ebenda, S. 2
24 Vgl. John Stuart Mill: Principles of Political Economy, erstveröffentlicht 1848, Fairfield 1976
25 Vgl. Ebenda, S. 977
26 Vgl. Otto Schlecht: Grundlagen und Perspektiven der Sozialen Marktwirtschaft, S. 4
27 Ebenda, S. 6
28 Vgl. ebenda, S. 7-8
29 Ebenda, S. 8
30 Elmar Müller: Widerstand und Wirtschaftsordnung,- Die wirtschaftspolitischen Konzepte der Widerstandsbewegung gegen das NS-Regime und ihr Einfluß auf die soziale Marktwirtschaft, Frankfurt am Main 1988, S. 80
31 Vgl. ebenda, S. 91-92
32 Vgl. ebenda, S. 101
33 Vgl. ebenda, S. 117
34 Ebenda, S. 121
35 Ebenda, S. 127
36 Alfred Müller-Armack: Die Wirtschaftsordnung, sozial Gesehen, in: Alfred Müller- Armack: Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern und Stuttgart 1975, S. 73-89, hier S. 83
37 Vgl. Elmar Müller: Widerstand und Wirtschaftsordnung, S. 149
38 Wolfgang Kartte: Soziale Marktwirtschaft heute, a.a.O., S. 139
39 Vgl. Alfred Müller-Armack: Vorschläge zur Verwirklichung der Sozialen Marktwirtschaft, in: Alfred Müller-Armack: Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern und Stuttgart 1975, S. 91-107, hier S. 99,
40 Vgl. ebenda, S. 99-100
41 Alfred Müller-Armack: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, S. 96
42 Vgl. Otto Schlecht: Grundlagen und Perspektiven der Sozialen Marktwirtschaft, S. 18
43 Alfred Müller-Armack: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, S. 88
44 Vgl. Alfred Müller-Armack: Stil und Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft, in: Alfred Müller-Armack: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, Freiburg i.Br. 1966, S. 231-242, hier S. 234
45 Reinhard Blum: Soziale Marktwirtschaft, Tübingen 1969, S. 96
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text behandelt die Entstehung und die Grundelemente der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Er untersucht, ob das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft ein liberalistisches Konzept war.
Wer sind die Hauptakteure, die in der Entstehung der Sozialen Marktwirtschaft eine Rolle spielten?
Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack werden als zentrale Figuren genannt. Ebenso werden die Arbeiten von Adam Smith, John Stuart Mill, Wilhelm Röpke und Walter Eucken erwähnt.
Was waren die wichtigsten Ziele bei der Einführung der Sozialen Marktwirtschaft?
Das Hauptziel war die Schaffung eines "Dritten Weges" zwischen dem Manchesterkapitalismus und der Planwirtschaft. Es ging darum, die Vorteile der Marktwirtschaft (wie Effizienz und Wettbewerb) mit sozialen Elementen (wie sozialer Sicherheit und Einkommensausgleich) zu verbinden.
Welche Kritik gab es an der Planwirtschaft, die zur Entwicklung der Sozialen Marktwirtschaft führte?
Die Planwirtschaft wurde als ineffizient, bürokratisch und einschränkend für die persönliche Freiheit kritisiert. Sie führte zu Versorgungsengpässen, mangelnder Wahlfreiheit für Konsumenten und eingeschränkten Handlungsspielräumen für Unternehmer.
Was sind die Grundelemente der Sozialen Marktwirtschaft?
Zu den Grundelementen gehören: Wettbewerbspolitik, ein marktwirtschaftlich orientierter Einkommensausgleich, aktive Beschäftigungspolitik, die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen und der Ausbau der Sozialversicherung.
Welche Rolle spielt der Staat in der Sozialen Marktwirtschaft?
Der Staat hat die Aufgabe, den Wettbewerb zu sichern, unbefriedigende Einkommens- und Besitzstrukturen auszugleichen, die Konjunktur zu beleben, kleine und mittlere Unternehmen zu fördern und soziale Sicherheit zu gewährleisten.
Inwiefern ist die Soziale Marktwirtschaft mit dem Liberalismus verbunden?
Der Text argumentiert, dass die Soziale Marktwirtschaft in ihrer ursprünglichen Form stark von liberalistischen Ideen beeinflusst war. Sie stellt eine Korrektur des "laissez-faire" des 19. Jahrhunderts dar, wobei der Staat eine aktivere Rolle bei der Gestaltung des sozialen Rahmens spielt, ohne die grundlegenden Prinzipien der Marktwirtschaft aufzugeben.
Welche Gesetze in Deutschland spiegeln die Elemente der Sozialen Marktwirtschaft wider?
Zu den Gesetzen, die die Elemente der Sozialen Marktwirtschaft widerspiegeln, gehören unter anderem das Tarifvertragsgesetz von 1949, das Betriebsverfassungsgesetz von 1952, das Rentenreformgesetz von 1957 und das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen.
- Citar trabajo
- A. Burmeister (Autor), 2000, Soziale Marktwirtschaft als liberalistische Konzeption, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97538