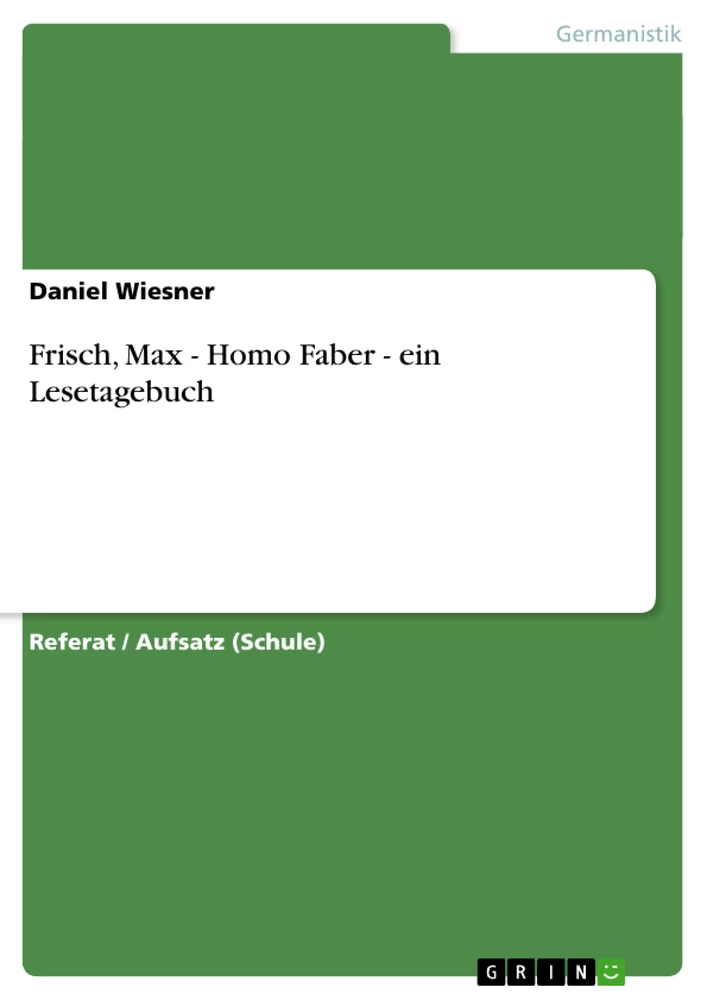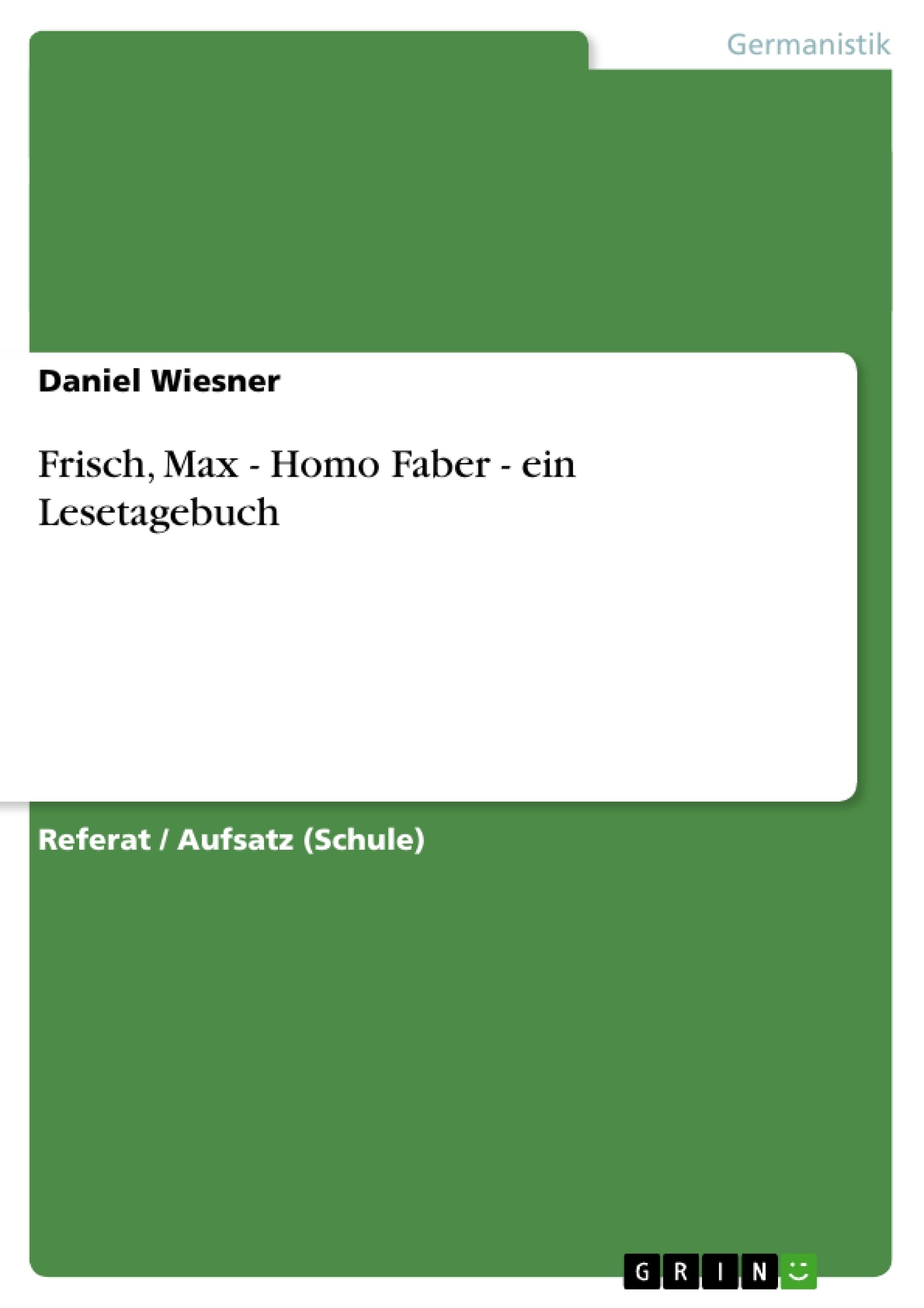Frisch, Max (1911-1991), Schweizer Schriftsteller. Mit Friedrich Dürrenmatt gehört er zu den wichtigsten Vertretern der schweizerischen Literatur der Nachkriegszeit. Zentrale Themen seines zeitkritischen Werkes sind Selbstentfremdung und das Ringen um Identität in einer ebenso entfremdeten Welt.
Frisch wurde am 15. Mai 1911 in Zürich geboren, wo er auch Architektur studierte. Danach arbeitete er als Journalist (seit 1931 freier Mitarbeiter der Neuen Zürcher Zeitung) und Architekt. Nach ausgedehnten Reisen durch Europa, Amerika und Mexiko (1951/52), die er in späteren Werken verarbeitete, lebte er nach Auflösung seines Architekturbüros 1955 als freier Schriftsteller, u. a. in Männedorf, Roman, Berzona (Tessin), Berlin und New York. 1968 heiratete Frisch in zweiter Ehe Marianne Oelers (Scheidung 1979). Er starb am 4. April 1991 in Zürich. 1980 wurde die Max-Frisch-Stiftung gegründet, ein Jahr später das Max-Frisch- Archiv der ETH Zürich. Frisch erhielt zahlreiche Literaturpreise, darunter den Conrad- Ferdinand-Meyer-Preis (1939), den Rockefeller Grant for Drama (1951), den Wilhelm-Raabe- Preis (1954), den Georg-Büchner-Preis (1958), den Literaturpreis der Stadt Jerusalem (1965) und den Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (1976).
Zu Frischs frühen Dramen zählt Die Chinesische Mauer (1946, Neufassungen 1955 und 1972), eine experimentelle Farce, in der in Anlehnung an Bertolt Brechts Technik des Verfremdungseffekts antike und moderne Schauplätze und Charaktere vermischt werden. Das folgende Schauspiel, Als der Krieg zu Ende war (1949), greift eine wahre Begebenheit aus dem Berlin der Nachkriegsjahre auf und kreist um das Thema der Schuld aus der Perspektive des Ehebruches und des Völkermordes. Sein wohl bekanntestes Stück Andorra (1961), in dem die Figur des Andri durch Antizipation der Verurteilung seiner Umgebung scheitert, knüpft an die genannte Thematik mit einer tragischen Parabel auf die Folgen des Antisemitismus an, während die Farce Biedermann und die Brandstifter (1958) anhand einer absurden Einquartierungssituation die Anpassungsmentalität des satten Bürgertums und seine Anfälligkeit für autoritäre Herrschaftsformen bloßlegt.
Max Frisch - Homo Faber - Ein Lesetagebuch...
Frisch, Max (1911-1991), Schweizer Schriftsteller. Mit Friedrich Dürrenmatt gehört er zu den wichtigsten Vertretern der schweizerischen Literatur der Nachkriegszeit. Zentrale Themen seines zeitkritischen Werkes sind Selbstentfremdung und das Ringen um Identität in einer ebenso entfremdeten Welt.
Frisch wurde am 15. Mai 1911 in Zürich geboren, wo er auch Architektur studierte. Danach arbeitete er als Journalist (seit 1931 freier Mitarbeiter der Neuen Zürcher Zeitung) und Architekt. Nach ausgedehnten Reisen durch Europa, Amerika und Mexiko (1951/52), die er in späteren Werken verarbeitete, lebte er nach Auflösung seines Architekturbüros 1955 als freier Schriftsteller, u. a. in Männedorf, Roman, Berzona (Tessin), Berlin und New York. 1968 heiratete Frisch in zweiter Ehe Marianne Oelers (Scheidung 1979). Er starb am 4. April 1991 in Zürich. 1980 wurde die Max-Frisch-Stiftung gegründet, ein Jahr später das Max-Frisch- Archiv der ETH Zürich. Frisch erhielt zahlreiche Literaturpreise, darunter den Conrad- Ferdinand-Meyer-Preis (1939), den Rockefeller Grant for Drama (1951), den Wilhelm-Raabe- Preis (1954), den Georg-Büchner-Preis (1958), den Literaturpreis der Stadt Jerusalem (1965) und den Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (1976).
Werk
Zu Frischs frühen Dramen zählt Die Chinesische Mauer (1946, Neufassungen 1955 und
1972), eine experimentelle Farce, in der in Anlehnung an Bertolt Brechts Technik des
Verfremdungseffekts antike und moderne Schauplätze und Charaktere vermischt werden. Das folgende Schauspiel, Als der Krieg zu Ende war (1949), greift eine wahre Begebenheit aus dem Berlin der Nachkriegsjahre auf und kreist um das Thema der Schuld aus der Perspektive des Ehebruches und des Völkermordes. Sein wohl bekanntestes Stück Andorra (1961), in dem die Figur des Andri durch Antizipation der Verurteilung seiner Umgebung scheitert, knüpft an die genannte Thematik mit einer tragischen Parabel auf die Folgen des Antisemitismus an, während die Farce Biedermann und die Brandstifter (1958) anhand einer absurden Einquartierungssituation die Anpassungsmentalität des satten Bürgertums und seine Anfälligkeit für autoritäre Herrschaftsformen bloßlegt. Ähnlich wie Dürrenmatt zeigt Frisch seine Akteure meist im Spannungsfeld von Identität und gesellschaftlichem Rollenspiel, so in seiner Parodie des Don-Juan-Stoffes Don Juan oder die Liebe zur Geometrie (1953,
Neufassung 1962), wo der Titelheld keineswegs als dynamischer Frauenverführer auftritt,
sondern eher als der vom anderen Geschlecht und den Ereignissen Getriebene erscheint, dem eben diese Rolle vom Schicksal ohne rechten Sinn zugedacht wurde.
Im Mittelpunkt des Romanerstlings Stiller (1954) mit seinem lakonischen Einleitungssatz ,,Ich bin nicht Stiller" steht ebenfalls der Kampf der Titelfigur um ihre Identität. Unter anderen Vorzeichen ist dieses Sujet auch im folgenden Roman Homo Faber präsent (1957, Verfilmung durch Volker Schlöndorff 1990). Hier wird aus der Sicht eines rationalistischen Ingenieurs der Gegensatz von technisch-wissenschaftlichem Weltbild und ,,unlogischen" Schicksalsmächten geschildert und mit der schon in Stiller auftretenden Eheproblematik (die auch das konfliktgeladene Verhältnis zu seiner langjährigen Lebensgefährtin Ingeborg Bachmann widerspiegelt) verbunden. Diese findet sich wiederum sehr ausgeprägt in Mein Name sei Gantenbein (1964), wo ,,die Kluft zwischen Wahn und Welt" durch die zweifelhafte Identität Gantenbeins, die im Titel bereits anklingt, offenbar wird. Diese Doppeldeutigkeit überträgt Frisch in den formalen Aufbau des Romans, indem er permanent verschiedene Textsorten mischt und getroffene Aussagen wieder relativiert. Dieses Mischungsprinzip begegnet wieder in der autobiographischen Erzählung Montauk (1975), die zugleich die Möglichkeiten des Erzählens reflektiert und die Suche nach objektiver Wahrheit als unausweichlichen Fehlschlag auch im eigenen Lebensplan des Autors transparent macht. Seine Erzählung Der Mensch erscheint im Holozän (1979) ist bereits gezeichnet vom Leiden am Verlust der literarischen Schaffenskraft und an der Aussichtslosigkeit eines Strebens nach einer erfüllten menschlichen Existenz angesichts einer gleichgültigen Natur. Blaubart, seine letzte 1982 veröffentlichte Erzählung, nimmt das Motiv des bekannten Märchens von Charles Perrault (und der gleichnamigen Erzählung von Anatole France) auf und führt die kunstvolle Altersprosa fort, hielt aber in der Gesamtanlage nicht mehr das Niveau der Vorgänger. Bemerkenswert vom literarischen und argumentativen Standpunkt sind hingegen Frischs Tagebücher, erschienen unter dem Titel Tagebuch 1946-1949 (1950) und Tagebuch 1966- 1971 (1972).
In ihrer Formfülle sind sie Montauk vergleichbar, spannen allerdings thematisch einen
erheblich weiteren Bogen. Neben der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Literatur präsentiert sich Frisch hier wie anderenorts als scharfsinniger Kritiker des Zeitgeschehens, insbesondere der Schweizer Verhältnisse (Schweiz ohne Heimat?, 1990). Weitere Werke des Autors sind die Romane Jürg Reinhart (1934) und J'adore ce qui me br û le oder Die Schwierigen (1943), die Erzählungen Bin oder Die Reise nach Peking (1945) und Wilhelm Tell für die Schule (1971) sowie die Dramen Nun singen sie wieder (1946), Santa Cruz
(1947), Graf Ö derland (1951, Neufassung 1961), Die große Wut des Philipp Hotz (1958),
Biographie. Ein Spiel (1967, Neufassung 1985) und Triptychon. Drei szenische Bilder (1978). Ein Briefwechsel mit Walter Höllerer kam 1969 heraus.
Technik, Bezeichnung für die Menge aller Artefakte, Verfahren, Fertigkeiten, Hilfsmittel sowie theoretischer Kenntnisse, die in vielfacher und unterschiedlicher Kombination und Variation von Menschen angewandt werden, um die übrige Natur für ihre Zwecke zu verändern und umzugestalten und neuerdings auch den Menschen selbst zu verändern. In einer eingeschränkten Bedeutungsvariante versteht man unter dem Begriff Technik spezielle Anwendungen (Maschinentechnik, Bautechnik), oder es sind handwerkliche bzw. professionelle Fertigkeiten (z. B. Maltechnik, Dribbeltechnik, Spieltechnik, Vortragstechnik) gemeint.
Der Begriff stammt aus dem Französischen (technique) und leitet sich von dem griechischen Wort t é chne ab, was so viel wie Kunstfertigkeit bedeutet. 1751 erschien der erste Band der Encyclop é die ou Dictionaire raisonn é des sciences, des arts et des m é tiers. Im Titel wurde also noch der bis dahin in allen europäischen Sprachen übliche Ausdruck ,,Kunst" benutzt (im Deutschen etwa Kunstrad für Wasserrad, Künstler für Techniker, wobei oft eine Überlagerung mit dem Maschinenbegriff festzustellen ist). In den Auseinandersetzungen um die Herausgabe der schließlich weiteren 34 Bände bis 1781 tauchte der Begriff arts techniques auf, um verallgemeinernd die in großer Zahl in diesem Werk dokumentierten Erzeugungsmethoden der Gewerbe (arts) und Handwerke (m é tiers) zu bezeichnen, die potentiell als angewandte Naturwissenschaften gesehen wurden (science).
Technologie
Neuerdings wird, vor allem von Politikern und Journalisten, auch der neben ,,Technik"
unscharfe Begriff Technologie verwendet (Technologietransfer, Technologiepark, neue
Technologien), um Modernität im Sinne systematischer Anwendung und Neuentwicklung von Technik zu signalisieren. Seitdem der Ökonom und Technologe Johann Beckmann seine Anleitung zur Technologie veröffentlichte (1777), war der Begriff schon einmal im Deutschen (bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts) präsent und bedeutete Gewerbekunde. Im Angloamerikanischen bezeichnet technology die ,,systematische Wissenschaft von den Techniken, Dinge herzustellen oder in Gang zu setzen" (Encyclopaedia Britannica, 1993). Hinter dieser Definition steckt ein von ,,Technik" verschiedenes gedankliches und kulturelles Konzept, das mit dem deutschen Begriff ,,Ingenieurwissenschaft" Überschneidungen
aufweist. Technology bezeichnet, ähnlich wie das französische technologie, nicht nur die
Summe der techniques, sondern gleichzeitig deren Verknüpfung, wissenschaftliche
Überprüfung, Systematisierung, theoretische Durchdringung und Weiterentwicklung, die
Wechselwirkung der techniques, von Theorie und Praxis. Im Deutschen interessieren im
Begriffszusammenhang ,,Technik" dagegen stärker die Beziehungen zwischen dem technisch Handelnden, seinen Zwecken und der Veränderung des Objekts (außermenschliche Natur), wobei der Mensch als der Natur gegenüberstehend gedacht und nicht als Bestandteil der Natur betrachtet wird, aus der er letztendlich hervorging.
Technikphilosophie
Die Komplexität (etwa von Kernkraftwerken, siehe Kernenergie), die Internationalität (z. B. beim Bau einer Ariane-Rakete oder des Airbusses; siehe Europäische Weltraumorganisation; Luftfahrt) und die Vernetzung technischer Systeme (Telekommunikation, Transportwesen, Verkehr) greifen seit der industriellen Revolution und heute stärker den je in die Privatsphäre des Einzelnen und in die wirtschaftlichen Interessenlagen verschiedener Industriezweige ein, so dass Technik, ihre Anwendung und Entwicklung immer stärker unter Rechtfertigungs- und Erklärungsdruck geraten sind.
Die wichtigsten Philosophen der industriellen Revolution, Karl Marx, Max Weber und Émile Durkheim (von denen sich keiner als Technikphilosoph bezeichnet hätte), hatten sich vor allem für die Aspekte der Aneignung der außermenschlichen Natur mittels Technik, der Vergegenständlichung des handelnden Menschen in den Produkten seiner Arbeit, das Eigentum an den technischen Produktionsmitteln und die gesellschaftliche Teilung der Arbeit mit technischen Maßnahmen interessiert. Aus der Totale des Positivismus (an den exakten Naturwissenschaften orientiertes Methodenideal, das die Gültigkeit menschlicher Erfahrungen auf ihre Messbarkeit an überprüfbaren Tatsachen beschränkt), dessen wichtigster Theoretiker, Auguste Comte, glaubte, dass mit ihm endlich ein sicheres, naturwissenschaftlich-technisches Fundament menschlicher und gesellschaftlicher Entwicklung gefunden sei, war es nur ein kurzer Schritt, Technik als Vehikel des ,,Willens zur Macht" auszumachen (siehe Friedrich Nietzsche). Der 1. Weltkrieg, von den Zeitgenossen als erster technischer Krieg der Menschheitsgeschichte bezeichnet, setzte der ungebrochenen Technikeuphorie der Industrialisierung ein Ende. Kritische Fragen nach dem Sinn und den Grenzen von Technik, wie sie etwa Walter Benjamin stellte, wurden sowohl von kommunistischer Seite (wo solche Überlegungen der forcierten Industrialisierung der Sowjetunion und der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft im Weg standen) als auch vor allem aus den
Reihen der sich formierenden konservativ-nationalistischen Bewegungen der
Zwischenkriegszeit verdrängt.
Letzteren galt Technik als identitätsstiftende nationale Kulturleistung und Medium irrationaler völkischer Selbsterlösung (Oswald Spengler), als übermächtiges Seinsgeschick (Martin Heidegger, Gabriele D'Annuzio), als biologisch notwendige Überlebensstrategie des menschlichen Mängelwesens (Arnold Gehlen) oder als überflüssiger Luxus des menschlichen Kulturwesens (José Ortega y Gasset). Wesentliche Kritik an solchen Positionen kam von der Frankfurter Schule, die zum einen die ideologischen Zielsetzungen industriekonservativer und faschistischer Technikphilosophie herausarbeitete (Jürgen Habermas) und verdeutlichte, dass die konkrete Phantasie des Menschen die in der Natur und seiner jeweiligen technischen Tradition angelegten Potentiale je nach den umgebenden gesellschaftlichen Zielsetzungen sehr verschiedenartig ausschöpfen kann (Ernst Bloch).
Mit dem Ende des schwerindustriellen Zeitalters begannen englischsprachige Autoren in den sechziger Jahren erneut die Ziele und Grenzen von Technik aus historischer Perspektive zu hinterfragen (Bertrand Russell, Lewis Mumford, David S. Landes). Das Entstehen der Anti- Atomkraftwerk-Bewegungen in Westeuropa, in denen sich ein neuer Technik-Skeptiszismus offenbarte, löste Mitte der siebziger Jahre eine starke Reaktion der akademischen Philosophie aus (Friedrich Rapp, Walter Zimmerli, Günter Ropohl). Gleichzeitig entstand um die
Nichtgleichgewichts-Thermodynamik und die naturwissenschaftliche Chaostheorie (Ilya Prigogine, Manfred Eigen) herum erstmals eine populärwissenschaftliche Technikphilosophie-Bewegung, die sich über Volkshochschulkurse, alternative Arbeitsgruppen und das Internet ausbreitete.
Verfasst von:
Uwe Burghardt
Schicksal (von altniederländisch schicksel: Anordnung, Geschick), religionsgeschichtlich als Gegenidee zur menschlichen Freiheit bzw. zum Zufall das von höheren Mächten oder von Gott dem Menschen zugedachte Geschick. In der klassischen Philosophie steht das Schicksal als Notwendigkeit für die alles Sein durchwaltende höhere Ordnung oder das Weltgesetz. In der griechischen Mythologie erscheint es u. a. in Ate, Tyche, Moira und Heimarmene personifiziert. Im Christentum tritt an die Stelle des Schicksalbegriffs derjenige der göttlichen Vorsehung. Nach Augustinus schließt die Unterordnung des Menschen unter göttliche Prädestination dennoch ethische Mitverantwortung nicht aus. Bei Friedrich Wilhelm von Schelling vollzieht sich die Offenbarung des Absoluten in einem Dreischritt: als blinde Macht
waltet zunächst das Schicksal; sodann zeigt es sich in der Natur, um sich schließlich als
Vorsehung zu offenbaren.
Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet Schicksal die Gesamtheit ungeplanter und
grundsätzlich nicht vorhersehbarer Ereignisse. Dabei handelt es sich um Ereignisse, die weder als Resultat rationaler Planung noch als Folge eines gesetzmäßigen Kausalablaufs angesehen werden. Kulturhistorisch betrachtet, stellt der Schicksalsglaube ein zentrales Kennzeichen des mythischen Denkens dar; in bestimmten kultischen Religionen ist das Schicksal durch Magie beeinflussbar. Daher steht der Schicksalsbegriff u.a. auch im Gegensatz zum Rationalitätsgedanken. Die Emanzipation vom Glauben an ein blindes Schicksal ist seit der Antike ein wesentlicher Impuls philosophischer Aufklärung.
Verfasst von:
Jörg Hardy
Romantheorie, theoretische Auseinandersetzung mit Inhalt und Form des Romans. Im
eigentlichen Sinn setzt sie im 18. Jahrhundert mit dem Gedanken ein, dass der Roman das Epos abgelöst habe. Den Unterschied zwischen Epos und Roman definierte Friedrich von Blanckenburg in seinem Versuchüber den Roman (1774), der ersten Romantheorie der deutschen Literatur: Ersteres handele vom Bürger als politisch bestimmtem Mitglied eines Staates, Letzterer hingegen vom Menschen in seiner Allgemeinheit. Das Epos habe die öffentlichen, heroischen Begebenheiten dargestellt, der Roman dagegen die äußeren und inneren ,,Privatbegebenheiten". Am Beispiel der Romane Christoph Martin Wielands erläuterte Blanckenburg die gegenüber dem Epos neuen narrativen Strukturen, die so genannte pragmatische Erzählhaltung des Romans erfordere zum einen Anschaulichkeit, zum anderen Erklärung der Vorgänge. Reflektierende Passagen werden somit als fester Bestandteil des Romans begriffen.
In der Romantik entwickelt Friedrich Schlegel im 116. Athenäum-Fragment die
weitreichendste Romantheorie, indem er postulierte, der Roman solle als ,,progressive"
Universalpoesie alle Gattungen der Poesie nebst Philosophie, Rhetorik und Kritik in sich
vereinigen. Roman und Romantheorie werden zur Einheit, die jedoch nur als Idee existiert, da der Roman im Prinzip unabschließbar ist. Jean Paul nahm in seiner Vorschule der Ästhetik (1804) die Theorien der Romantiker - neben Friedrich Schlegel wirkte Novalis innovativ - auf und erklärte den Roman zur zentralen Gattung, in der Innen und Außen sowie Endlichkeit und Unendlichkeit verbunden würden. Das 19. Jahrhundert trug außer geschichtsphilosophischen
Thesen Georg Wilhelm Friedrich Hegels (der Roman als letzte Form der Kunst vor ihrem
Ende), Gustav Freytags auf Harmonie bedachten Romanbegriff sowie Friedrich Theodor Fischers Überlegungen zur Ironie im objektiven Erzählen, zur theoretischen Klärung der Probleme wenig bei. Erst mit Georg Lukács' Theorie des Romans (1920) sind wieder komplexe Fragestellungen zu finden. Lukács setzte das griechische Epos in Beziehung zum Roman, wobei er für das Epos die Einheit von Innen und Außen sowie eine ungebrochene Lebenstotalität postulierte, die im Roman durch das reflektierende Individuum zerstört sei; hier bestehe sie lediglich als ,,Gesinnung zur Totalität". Der neuzeitliche Roman wird definiert als ,,Ausdruck der transzendentalen Obdachlosigkeit der Welt". Im Expressionismus stellte Alfred Döblin den ,,Kinostil" ins Zentrum seiner Überlegungen. Walter Benjamin dachte als erster medientheoretisch über die Gattung nach: Grundbedingung des Epos sei die Mündlichkeit des Vortrags gewesen - der moderne Romancier dagegen ist das in der Schrift vereinsamte Subjekt, das keine Kunde von der Wahrheit des Lebens mehr bringen kann. Auf die Komplexität der Lebensverhältnisse und des Bewusstseins reagierten Robert Musil, Hermann Broch oder Thomas Mann gleichsam auch theoretisch mit ihren Romanen: permanente Reflexionsarbeit (Musil) und Tiefenpsychologie (Broch) im essayistischen Schreiben sowie humane Umfunktionierung des Mythos (Mann) wurden konstitutiv.
Von der Sowjetunion ausgehend, verpflichteten die Länder des Ostens ihre Autoren, mit Hilfe der Theorie des sozialistischen Realismus der Idee des Staatssozialismus zu dienen. Im Westen bestimmten Alain Robbe-Grillet und Michel Butor die Prinzipien des Nouveau roman. Die aktuelle Erzählforschung (u. a. Julia Kristeva) sucht mit Hilfe der Methoden des Strukturalismus, zu systematischen Perspektiven zu finden.
Verfasst von:
Heribert Däschlein
Nouveau roman (französisch: neuer Roman), in Frankreich entstandene experimentelle
Literaturform der fünfziger bis siebziger Jahre, die sich gegen die überlieferten
Erzählstrategien wandte und eine neue, objektive Art des Schreibens propagierte. Zu seinen Vertretern zählen Claude Simon, Robert Pinget, Alain Robbe-Grillet, Maurice Blanchot, Marguerite Duras und Michel Butor. Vorbereitet wurde der Nouveau roman u. a. von Samuel Beckett und Nathalie Sarraute, in deren Werken Aspekte des konventionellen Romans wie stringent-chronologische Erzählführung, individuelle Charakterisierung der Figuren, Subjektivität etc. ausgeschaltet sind und die Vorstellung von Literatur als einer moralischen oder politischen Kraft dekonstruiert wird.
Der Nouveau roman versucht die Welt aus der Sicht einer gleichgültigen Erzählposition zu
schildern, die nur das Sichtbare registriert. Wichtig dabei ist allein die Oberflächlichkeit der Dingwelt, hinter deren Sinn nicht mehr vorgestoßen werden kann. Allenfalls dem Leser bleibt die Auffindung von Bedeutung überlassen. Besonders anschaulich wird dies bei Robbe- Grillet, etwa in seinem Roman Le Voyeur (1955; Der Augenzeuge). In der Bemühung, die etablierte literarische Tradition zu überwinden, spielten die Autoren des Nouveau roman bewusst mit der Erwartungshaltung ihrer Leser.
II. Zitate dir mir besonders gefallen
1. Die schönen Zitate
Seite 42; ,, Einmal wir wollten baden, aber Herbert fand seinen sagenhaften Bach nicht
wieder, und wir gerieten plötzlich zu den Ruinen - trafen wir unseren Künstler bei der Arbeit. In dem Gestein, das einen Tempel vorstellen soll, glühte eine Höllenhitze. Seine einzige Sorge: kein Schweißtropfen auf sein Papier! Er grüßte kaum; wir störten ihn. Seine Arbeit: er spannte Pauspapier über die steinernen Reliefs, um dann stundenlang mit einer schwarzen Kreide darüber hinzustreichen, eine irrsinnige Arbeit, bloß um Kopien herzustellen; er behauptete steif und fest, man könne diese Hieroglyphen und Götterfratzen nicht fotografieren, sonst wären sie sofort tot. Wir ließen ihn. Ich bin kein Kunsthistoriker - Nach einiger Pyramidenkletterei aus purer Langeweile ( die Stufen viel zu steil, gerade das verkehrte Verhältnis zwischen Breite und Höhe, so dass man leicht außer Atem kommt) legte ich mich, ...)" ---- Dieses Zitat bringt das Verhältnis Fabers zur Vergangenheit und Mythologie zum Ausdruck und er versucht immer vom Standpunkt eines Techniker an die Probleme zu gehen.
Seite 87; ,,Auch für mich war nichts Aufreizendes dabei gewesen, und wir gingen weiter zu den großen Schraubenwellen, die ich ihr noch zeigen wollte. Probleme der Torsion, Reibungskoeffizient, Ermüdung des Stahls durch Vibration und so fort, daran dachte ich nur im Stillen, beziehungsweise in einem Lärm, wo man kaum sprechen konnte - erläuterte dem Mädchen lediglich wo wir uns jetzt befinden, nämlich wo die Schraubenwellen aus dem Schiffskörper stoßen, um draußen die Schrauben zu treiben. Man musste brüllen, schätzungsweise acht Meter unter dem Wasserspiegel! Ich wollte mich erkundigen." ---- Ausdruck der technischen Perfektionssucht Fabers und seines Bedürfnisses, allen anderen etwas mitzuteilen. Er sieht die Technik und all ihre Details als seinen Lebensinhalt an.
2. Zitate die sprachlich interessant und gelungen sind
Seite 70, ,,... eine ganze Schlange von Passagieren - vor mir: ein junges Mädchen in
schwarzer Cowboyhose, kaum kleiner als ich, Engländerin oder Skandinavierin, ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, nur ihren blonden oder rötlichen Roßschwanz, der bei jeder Bewegung ihres Kopfes baumelte. Natürlich blickt man sich um ob man jemanden kennt, es hätte ja sein können. Ich hoffte wirklich auf Männertisch. Das Mädchen bemerkte ich bloß, weil ihr Roßschwanz vor meinem Gesicht baumelte, mindestens eine halbe Stunde lang. Ihr Gesicht, wie gesagt, sah ich nicht. Ich versuchte das Gesicht zu erraten. Zum Zeitvertreib; wie man sich zum Zeitvertreib an ein Kreuzworträtsel macht. Übrigens gab es fast keine jungen Leute. Sie trug (ich erinnere mich ganz genau) einen schwarzen Pullover mit Rollkragen, existentialistische, dazu Halskette aus gewöhnlichen Holz, Espadrilles, alles ziemlich billig. Sie rauchte, ein dickes Buch unter dem Arm, und in der hinteren Tasche ihrer Cowboyhose steckte ein grüner Kamm. Ich war einfach durch diese Warterei gezwungen sie zu betrachten; sie musste sehr jung sein: ihr Flaum auf dem Hals, ihre Bewegungen, ihre kleinen Ohren die erröteten, als der Steward einen Spaß machte - sie zuckte nur die Achseln, ob erster oder zweiter Service, war ihr gleichgültig." ---- Hier mischt Faber sein kühles technisches Bemerken von Details, das er auch bei Maschinen anwendet, bereits mit ersten Gefühlsansetzen und Erklärungsversuchen. Obwohl dieses Zitat nur eine Aufzählung ist wirkt es durch gekonnten Schreibweise und Wortwahl doch sehr elegant.
Seite 74, Abschnitt 4 bis Seite 75, Abschnitt 2; ,,Am anderen Morgen ... der Roboter braucht keine Ahnung" ---- Rein technisches Gespräch mit Sabeth, die wiederum der kühlen technischen Beschreibung der Möglichkeiten der Technik Gefühle und Hoffnungen zusetzt, die aber von Faber mit immer mehr technischen Details und zurückgedrängt werden.
3. Zitate die komisch sind
Seite 89; ,,Ich war vollkommen nüchtern, und als Sabeth mich aufsuchte, sagte ich sofort, sie werde sich nur erkälten, Sabeth in ihrem dünnen Abendkleidchen. Ob ich traurig sei, wollte sie wissen. Weil ich nicht tanze. Ich find sie lustig, ihre heutigen Tänze, lustig zum Schauen, diese existentialistische Hopserei, wo jeder für sich allein tanzt, seine eigenen Faxen schwingt, verwickelt in die eigenen Beine, geschüttelt wie von einem Schüttelfrost, etwas epileptisch, aber lustig, sehr temperamentvoll, muß ich sagen, aber ich kann das nicht." ---- Faber macht sich über die Tänze lustig
Seite 100; ,,Als wir über die Place de la Concorde gingen, gehetzt vom Pfiff eine Gendarmen,
gab sie mir ihren Arm. Das hatte ich nicht erwartet. Wir mussten rennen, da der Gendarm bereits seinen weißen Stab hob, eine Meute von Autos startete auf uns los; auf dem Trottoir ,Arm in Arm gerettet, stellte ich fest , dass ich meinen Hut verloren hatte - er lag draußen im braunen Matsch, bereits von einem Pneu zerquetscht. Eh bien! sagte ich und ging Arm in Arm mit dem Mädchen weiter, hutlos wie ein Jüngling im Schneegestöber.
4. Zitate denen ich zustimme
Seite 107; ,,Was wir ablehnen: Natur als Götze! Dann müsste man schon konsequent sein:
dann auch kein Penicillin , keine Blitzableiter, keine Brille, kein DDT, kein Radar und so
weiter. Wir lebten technisch, der Mensch als Beherrscher der Natur, der Mensch als Ingenieur und wer dagegenredet, der soll auch keine Brücke benutzen, die nicht die Natur gebaut hat. Dann müsste man schon konsequent sein und jeden Eingriff ablehnen, das heisst: sterben an jeder Blinddarmentzündung. Weil Schicksal ! Dann auch keine Glühbirne, keinen Motor, keine Atom-Energie, keine Rechenmaschine, keine Narkose - dann los in den Dschungel !" ---
- Die Meinung
Fabers kann ich nur bestätigen und finde das sie richtig ist. Der Mensch hat vieles geschaffen, meist zu seinem Vorteil. Wenn man heute gegen die Technik ist muss man auf alles Verzichten, was nicht aus der Natur kommt. Zum Beispiel nur Wasser aus Flüssen trinken, mit Pfeil und Bogen auf Jagd gehen und sich in Felle hüllen. Ist das eine schöne Vorstellung ?!?
III Problemfragen
Warum hat sich Joachim aufgehängt?
Ist Faber am Ende des Buches gestorben? Was wurde aus Herbert?
Warum dieser Zufall, das Faber seine Tochter auf dem Schiff trifft?
Warum hat Faber nicht schon früher erfahren, dass Sabeth seine Tochter ist? War Faber immer so ein technikversessener Einzelgänger? Warum war seine New Yorker Wohnung weitervermietet?
Was wäre passiert, wenn Faber nicht nach Joachim gesucht hätte und nach Venezuela geflogen wäre?
Hat Hanna Faber je den Tod ihrer Tochter verziehen?
Man erfährt wenig über Fabers Kindheit. Wie verlief sie?
IV Weiterführende Bearbeitung
American Way of Life
- Der Begriff "American Way of Life" steht hier steht hier für das Geschehen welches als Gegensatz zu Griechenland und zur Antike, gesehen werden kann.
- Griechenland gilt als Heimat des Mythos, Nordamerika gehört der Technik · Für Faber ist es die Wahlheimat
- Er ist auch anfangs total von deren Perfektion überzeugt, so dass er Marcels Kritik an der Vermassung und Mechanisierung der amerikanischen Gesellschaft ignoriert, ja sogar als Künstlerquatsch abtut und Marcel aus Unverständnis für dessen Auffassung sogar als Kommunisten verdächtigt.
- Ausgelösst durch sein körperliches und moralisches Versagen beginnt er jedoch, sich von seinem utopischen Bild der American Way of Life Gesellschaft zu trennen · 3mal bricht er von New York zu einer Reise auf, an deren Ende immer der Tod stand
1. Guatemala - Joachim am Strick
2. Europa - Tod Sabeths
3. Guatemala - Kuba - Greichenland - Tod Fabers
- Seine aufkommende und zunehmende Kritik findet man während jedem seiner drei New York Aufenthalte
1. Reduzierung der Abstandshaltung auf Verhältnis zu Ivy, sich wehren gegen ihre Heiratspläne
2. Mitternachtsparty: Faber klagt über die Anonymität und Gleichgültigkeit in der Gesellschaft. (S. 67)
("In eurer Gesellschaft könnte man sterben, sagte ich, man könnte sterben, ohne dass ihr es merkt, von Freundschaft keine Spur, sterben könnte man in eurer Gesellschaft! Schrie ich, und wozu wir überhaupt miteinander reden, schrie ich, wozu denn (...), wozu diese ganze Gesellschaft, wenn einer sterben könnte, ohne dass ihr es merkt.)
3. Wiederholte Darstellung der Anonymität: Faber kann nicht in seine Wohnung, am Telefon sprechen Fremde. Seine enge Perpektive im Bezug auf die amerikanische Welt wird erkennbar, als er die Stadt per Sightseeingboat und Subway neu erkundet. Aber: Auch jetzt ist ihm die Trennung von seiner bisherigen Weltanschauung noch nicht bewußt.
- Vier-Tage-Aufenthalt in Kuba: Endgültige, bewußte Trennung vom American Way of Life. (Dieses Coca-Cola-Volk, dass ich nicht mehr ausstehen kann. | Bleichlinge | Vitaminfresser) · An Dick und Marcel schreibt Faber je einen Brief, in dem er die Erscheinungen des
Amerikanismus beklagt, die ihm zuvor als durchaus akzeptabel erschienen, nun aber mehr als
störend empfunden werden. ( Komfort, die beste Installation der Welt, ready for use, die Welt als amerikanisiert, Vakuum, wo sie hinkommen,alles wird Highway) und (ihre Falsche Gesundheit, ihre falsche Jugendlichkeit, ihre Weiber die nicht zugeben können, dass sie älter werden, ihre Kosmetik noch an der Leiche, überhaupt ihr pornografisches Verhältnis zum Tod). Er empfindet die beiden Briefe jedoch als unsachlich und schickt sie nicht ab.
Zusammenfassung des Buches
Häufig gestellte Fragen zu Max Frisch - Homo Faber - Ein Lesetagebuch
Wer war Max Frisch?
Max Frisch (1911-1991) war ein Schweizer Schriftsteller und Architekt. Zusammen mit Friedrich Dürrenmatt gehört er zu den wichtigsten Vertretern der schweizerischen Literatur der Nachkriegszeit. Zentrale Themen seines Werkes sind Selbstentfremdung und das Ringen um Identität in einer entfremdeten Welt.
Was sind einige von Frischs bekannten Werken?
Zu seinen bekannten Werken gehören: Die Chinesische Mauer, Als der Krieg zu Ende war, Andorra, Biedermann und die Brandstifter, Don Juan oder die Liebe zur Geometrie, Stiller, Homo Faber, Mein Name sei Gantenbein, Montauk, Der Mensch erscheint im Holozän, Blaubart sowie seine Tagebücher.
Was ist der Inhalt des vorliegenden Lesetagebuchs?
Das Lesetagebuch enthält Zitate aus Homo Faber, die dem Verfasser besonders gefallen haben. Diese werden in verschiedene Kategorien eingeteilt: schöne Zitate, sprachlich interessante Zitate, komische Zitate und Zitate, denen der Verfasser zustimmt. Des Weiteren werden Problemfragen zum Inhalt des Romans aufgeworfen und eine weiterführende Bearbeitung des Themas "American Way of Life" vorgenommen. Abschließend wird eine Zusammenfassung des Buches gegeben.
Was sind die zentralen Themen in Homo Faber?
Technik versus Natur, Rationalität versus Schicksal, Entfremdung, Identitätssuche und die Kritik am "American Way of Life" sind wichtige Themen in Homo Faber.
Was bedeutet der Begriff "Technik" in diesem Kontext?
Technik wird definiert als die Menge aller Artefakte, Verfahren, Fertigkeiten, Hilfsmittel sowie theoretischer Kenntnisse, die von Menschen angewandt werden, um die Natur für ihre Zwecke zu verändern und umzugestalten. Der Text geht auch auf die Technikphilosophie ein und beleuchtet die Auseinandersetzung mit Technik im Laufe der Geschichte.
Was wird unter dem Begriff "Schicksal" verstanden?
Schicksal wird als Gegenidee zur menschlichen Freiheit bzw. zum Zufall definiert, als das von höheren Mächten oder Gott dem Menschen zugedachte Geschick. Der Text behandelt die philosophischen und religionsgeschichtlichen Aspekte des Schicksalsbegriffs.
Was ist der Nouveau Roman?
Der Nouveau Roman ist eine experimentelle Literaturform, die in Frankreich in den fünfziger bis siebziger Jahren entstand und sich gegen die überlieferten Erzählstrategien wandte. Vertreter dieser Richtung sind u. a. Claude Simon, Robert Pinget, Alain Robbe-Grillet, Maurice Blanchot und Marguerite Duras. Die Autoren des Nouveau Roman versuchten, die Welt aus der Sicht einer gleichgültigen Erzählposition zu schildern und sich auf die Oberflächlichkeit der Dingwelt zu konzentrieren.
Wie wird der "American Way of Life" in Bezug auf Homo Faber interpretiert?
Der "American Way of Life" wird als Gegensatz zu Griechenland und zur Antike dargestellt, wobei Griechenland als Heimat des Mythos und Nordamerika als Reich der Technik gilt. Faber ist anfangs von der Perfektion der amerikanischen Gesellschaft überzeugt, distanziert sich aber im Laufe der Handlung zunehmend von diesem utopischen Bild.
- Quote paper
- Daniel Wiesner (Author), 1999, Frisch, Max - Homo Faber - ein Lesetagebuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97522