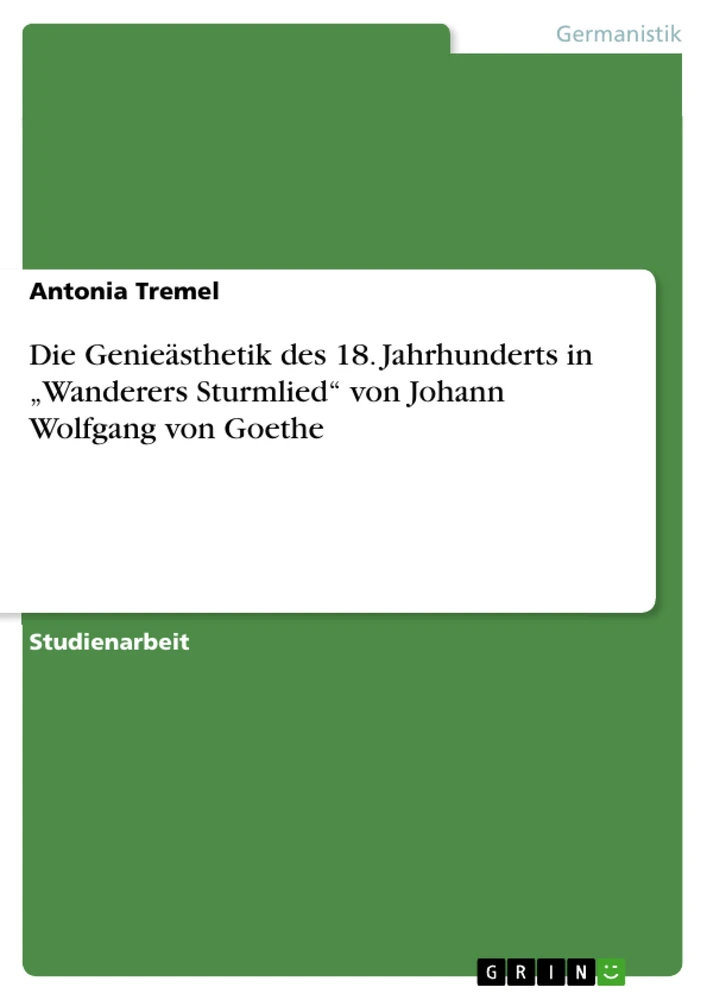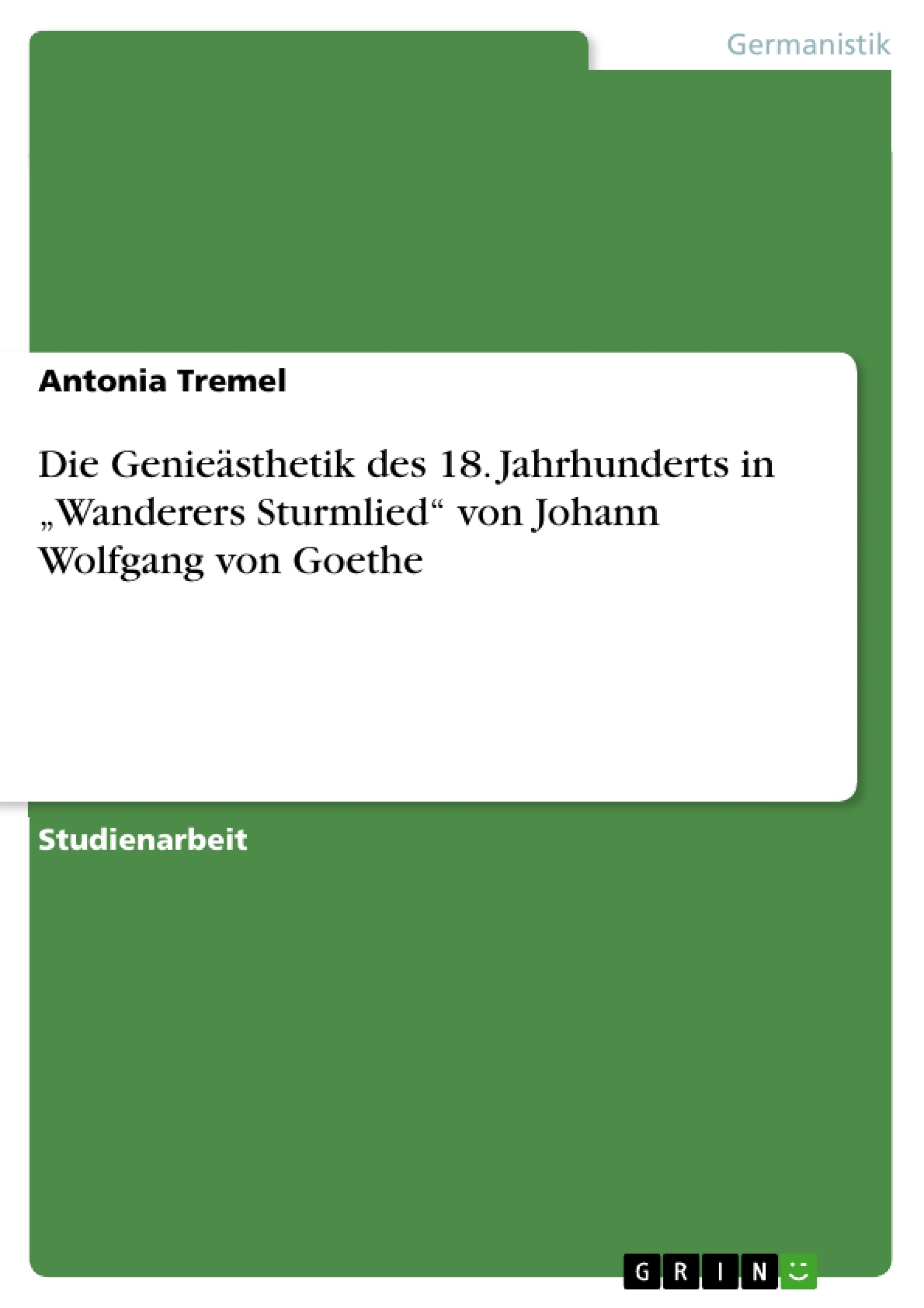Mit der Frage, ob das Sturmlied Goethes den Geist des genialen Erschaffens widerspiegelt und inwiefern die Genieästhetik in seinem Werk verwirklicht wird, soll zunächst allgemein auf die Genieästhetik des 18. Jahrhunderts eingegangen werden, um anschließend die genialistischen Attribute am Gedicht zu prüfen.
Dieses Bild des selbstschöpferischen, auserwählten Menschen wurde im Sturm und Drang das Leitbild einer Epoche, die nach Originalität und Eigenschöpfertum strebte. Die Abwendung vom Schönen und Sittlichen, hin zum Lebendigen und Schaffenden bildete die Grundlage für das Entstehen einer Genieästhetik, dessen Auswirkungen man noch weit über die Epoche des Sturm und Drang hinaus spüren konnte. Das Genie soll nicht durch Regeln poetische Schönheit hervorbringen, sondern durch wahrhaftiges Empfinden die Natur- und Gefühlswelt abbilden. „Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt“ soll sein poetisches Seelenleben sein und keine dichterische Vorgabe sein Handwerk bestimmen. Wegweisend für die Entwicklung der Genieästhetik sind Herder und Hamann, die für Goethes dichterisches Schaffen eine prägende Rolle einnahmen. Als Höhepunkt der Geniezeit stehen Goethes Hymnen, wie solche des Wandrers Sturmlied, welches den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Genieästhetik im 18. Jahrhundert
- Die Bedeutung Pindars in der Genieästhetik
- Der genialistische Wanderer im Sturm
- Historischer Abriss des Gedichtes
- Odenform und Genieästhetik im Sturmlied
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwirklichung der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts in Goethes Sturmlied. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, inwiefern das Gedicht den Geist des genialen Schaffens widerspiegelt und welche genialistischen Attribute es aufweist. Dabei wird der Kontext der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts beleuchtet und die Bedeutung von Pindars Werk als Vorbild für die Stürmer und Dränger untersucht.
- Die Entwicklung der Genieästhetik im 18. Jahrhundert
- Die Bedeutung Pindars als Vorbild für die Genieästhetik
- Die Analyse genialistischer Attribute in Goethes Sturmlied
- Der Einfluss der Odenform auf die Darstellung der Genieästhetik
- Das Verhältnis von Natur, Gefühl und Regelhaftigkeit in der Genieästhetik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Genieästhetik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Verwirklichung genialistischen Schaffens in Goethes Sturmlied. Sie skizziert den historischen Kontext und die Bedeutung des sokratischen Daimonion als Grundlage für das Konzept des Genies. Die Arbeit benennt die Frankfurter Ausgabe von Goethes Werken als Textgrundlage.
Die Genieästhetik im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung der Genieästhetik im Kontext des gesellschaftlichen Wandels des 18. Jahrhunderts. Es beleuchtet die Rolle der Aufklärung, der modernen Naturwissenschaften und emanzipatorischer Bewegungen. Die Autonomie des Individuums und die Abwendung von traditionellen Autoritäten werden als zentrale Aspekte hervorgehoben. Das Kapitel diskutiert die Positionen von Edward Young, der das Genie vom Gelehrten abgrenzt, und Gottsched, der die Notwendigkeit von Gelehrsamkeit betont. Die spinozistische Gleichsetzung Gottes mit der Natur und die damit verbundene Säkularisation werden als wichtige Einflussfaktoren für die Entwicklung der Genieästhetik dargestellt. Das Kapitel beschreibt die Transformation des dichterischen Selbstverständnisses vom heteronomen Dichten hin zu einem Verständnis des Genies als göttliche Begabung. Pindar und Shakespeare werden als Leitfiguren des genialen Dichtens vorgestellt.
Die Bedeutung Pindars in der Genieästhetik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rezeption Pindars im 18. Jahrhundert und seine Bedeutung für die Genieästhetik. Pindar wird als Muster des elementar-naturhaften, genialen Dichters präsentiert, der die zentralen Prinzipien des Sturm und Drang vorwegnahm – die Gegenüberstellung des begnadeten Menschen und des regelgebundenen Gelehrten. Das Kapitel analysiert die Metaphorik in Pindars Epinikien (der große Strom, das Feuer) und zeigt auf, wie diese die Aspekte des Genies – Spontaneität, Regellosigkeit, Neuschöpfung – veranschaulicht. Die Bedeutung von Pindars Selbstbewusstsein und stilistischen Mitteln wird hervorgehoben, wobei das Paradoxon von genialischer Spontaneität und stilistischer Gestaltung betont wird.
Schlüsselwörter
Genieästhetik, Sturm und Drang, Goethe, Sturmlied, Pindar, Originalität, Autonomie, Natur, Gefühl, Regel, Gelehrsamkeit, Shakespeare, Säkularisation, Autonomie des Individuums.
Goethes Sturmlied und die Genieästhetik: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goethes Sturmlied im Kontext der Genieästhetik des 18. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Frage, wie das Gedicht die Ideale des genialischen Schaffens verkörpert und welche spezifischen Merkmale der Genieästhetik es aufweist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Genieästhetik im 18. Jahrhundert, die Bedeutung Pindars als Vorbild für die Stürmer und Dränger, die Analyse genialistischer Attribute in Goethes Sturmlied, den Einfluss der Odenform auf die Darstellung der Genieästhetik und das Verhältnis von Natur, Gefühl und Regelhaftigkeit in diesem Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Genieästhetik des 18. Jahrhunderts, ein Kapitel zur Bedeutung Pindars in der Genieästhetik und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den historischen Kontext vor. Das zweite Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Genieästhetik, während das dritte Kapitel sich auf die Rezeption Pindars und dessen Einfluss auf die Stürmer und Dränger konzentriert.
Welche Rolle spielt Pindar in dieser Arbeit?
Pindar wird als bedeutendes Vorbild für die Stürmer und Dränger und deren Verständnis von Genie gesehen. Seine Werke, insbesondere die Epinikien, werden analysiert, um die zentralen Prinzipien des genialischen Dichtens – Spontaneität, Regellosigkeit und Neuschöpfung – zu veranschaulichen. Die Arbeit untersucht, wie Pindars Stil und seine Metaphorik die Aspekte des Genies in der Genieästhetik repräsentieren.
Wie wird Goethes Sturmlied analysiert?
Die Analyse von Goethes Sturmlied konzentriert sich auf die Identifizierung genialistischer Attribute im Gedicht. Dabei wird der Einfluss der Odenform und das Verhältnis von Natur, Gefühl und Regelhaftigkeit im Gedicht untersucht, um zu zeigen, inwiefern es die Ideale der Genieästhetik verkörpert.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die Frankfurter Ausgabe von Goethes Werken als Textgrundlage. Zusätzlich werden Werke und Theorien zur Genieästhetik des 18. Jahrhunderts herangezogen, um den historischen Kontext und die theoretischen Grundlagen der Analyse zu belegen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Genieästhetik, Sturm und Drang, Goethe, Sturmlied, Pindar, Originalität, Autonomie, Natur, Gefühl, Regel, Gelehrsamkeit, Shakespeare, Säkularisation und Autonomie des Individuums.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für die Literatur des Sturm und Drang, die Genieästhetik des 18. Jahrhunderts und die Werkinterpretation von Goethes Sturmlied interessieren. Sie ist insbesondere für akademische Zwecke konzipiert.
- Quote paper
- Antonia Tremel (Author), 2019, Die Genieästhetik des 18. Jahrhunderts in „Wanderers Sturmlied“ von Johann Wolfgang von Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/975149