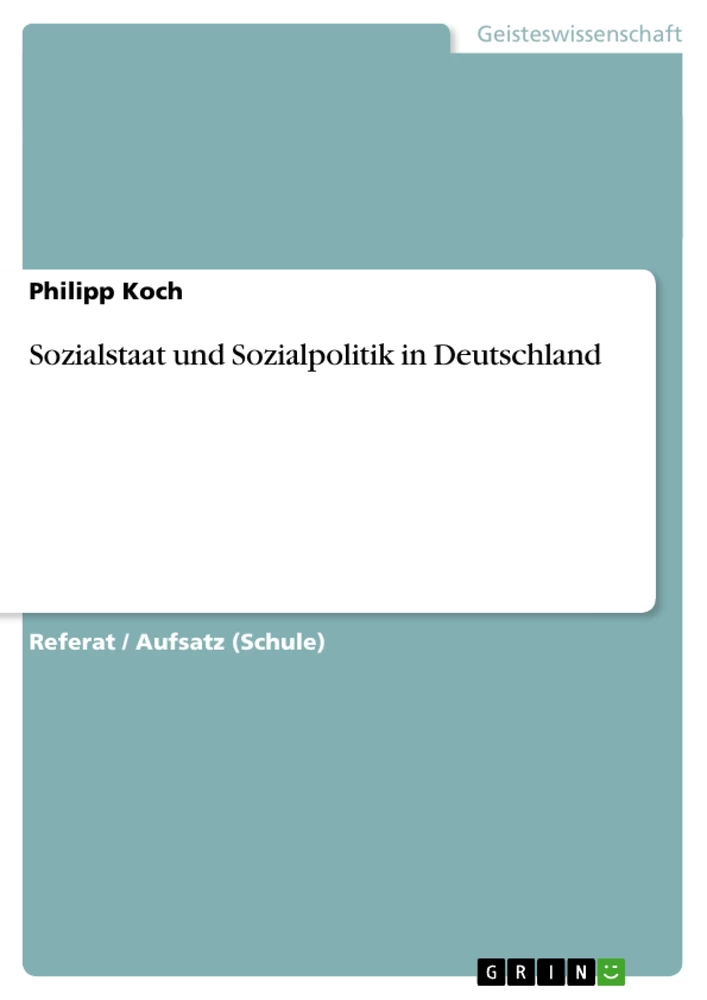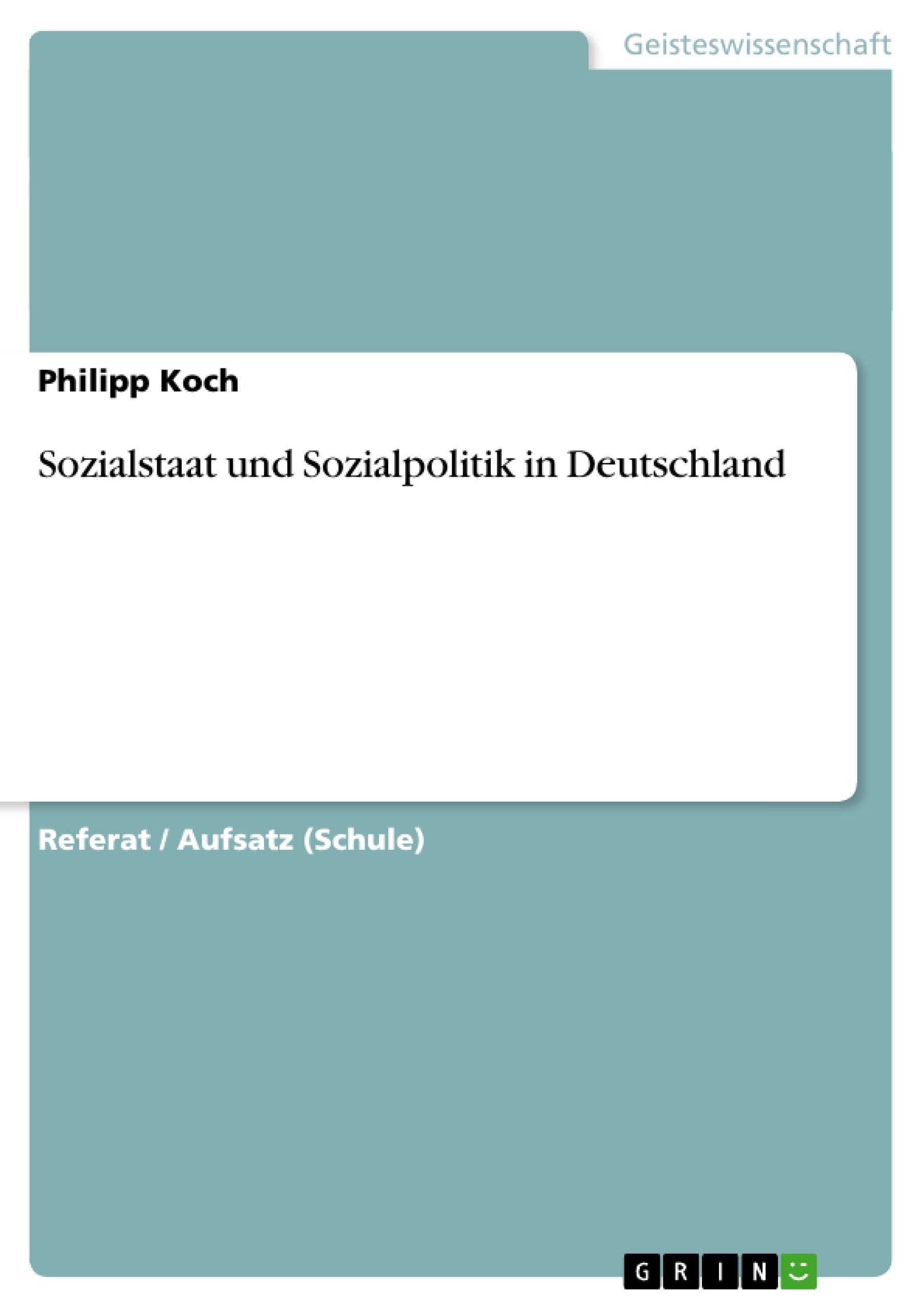12.1 Sozialstaat und Soialpolitik in Deutschland
(1.) Verfassungsrechtliche Grundlagen
Sozialstaatsprinzip: Art.20 / 28 GG = sozialer Ausgleich + soziale Sicherheit soziale Grundwerte: Art.1, 2, 3, 6, 9, 14 und 15
Bestandsgarantie: Art.79 GG = Unantastbarkeit d. Wesensgehaltes eines Grundrechts (Art.1- 20 GG)
soziale Grundwerte:
- Existenzsicherung Schutz der Gesellschaft
- sozialer Ausgleich durch den Staat
- Vollbeschäftigung
- Erhaltung d. Arbeitskraft
ZWAR Antinomie zu rechtsstaatlichen Grundwerten:
- Würde
- Freiheit Schutz d. Gesellschaft
- Gleichheit vor dem Staat
- Eigentum
ABER soziale Sicherung als Voraussetzung für Verwirklichung der Ziele des Rechtsstaates! Ziele d. Sozialstaates: · Verbesserung der Stellung sozial schwacher Personen
- Sicherung der sozialen Lage derjenigen, die es nicht selbst können · annähernd gleiche Förderung des Wohles aller + gleichmäßige Verteilung der Lasten
1.1 Das Menschenbild des GG
Gemeinschaftsgebundenheit d. Individuums àßEigenverantwortung
= Einschränkung seiner Handlungsfreiheit = Sicherung der Persönlichkeit zugunsten der Gemeinschaft = Möglichkeit der Mitgestaltung
Aus Sozialstaatsprinzip + Grundrecht: Würde d. Menschen ergibt sich der Fürsorgeanspruch (Sicherung d. Existenzminimums im Falle einer Bedürftigkeit) sowie d. Anspruch auf Daseinsvorsorge (Gas, Wasser, Strom, Schulwesen, Gesundheitsvorsorge usw.) Außerdem entsteht die Verpflichtung des sozialen Ausgleichs zw. Starken und Schwachen. Enthalten ist aber auch die Zwangsversicherung (als Vorsorge für Krankheit, Alter).
è Liberalismus
Grundwerte: persönliche Freiheit, rechtliche Gleichheit, privates Eigentum
Wurzeln:
John Locke = Naturzustand: der Mensch ist frei; per Gesellschaftsvertrag gewährleistet) Jean-Jacques Rousseau = ,,Volkssouveränität"
à Staat schützt Freiheit + Eigentum
Ziele:
- Staat darf nicht bevormunden, sondern muß freie Selbstentfaltung gewährleisten · Garantie d. pers. Freiheit durch Zuerkennen von gleichen Rechten aller (insb. Privateigentum)
- Schutz dieser Rechte vor Verletzungen von außen + innen (v.a. vor Verletzungen d. Staates selbst)
è Sozialismus
Grundwerte: soziale Gleichheit, Solidarität, Freiheit
Wurzeln:
Jean-Jacques Rousseau = Volkssouveränität, volonté génerale (Gemeinwohl) steht über allem;
Produktion nach Bedürfnissen anstatt nach Profiten
Ziele:
- Nivellierung sozialer Ungleichheit
- neuer Leistungsbegriff: Solidarität
- Freiheit als materiell gesicherte Freiheit
- Aufhebung der Herrschaft des Kapitals
è Katholische Soziallehre
Grundwerte:
- Subsidiaritätsprinzip: die übergeordnete Gemeinschaft wird erst tätig, wenn die untergeordnete
Gemeinschaft die Aufgabe nicht lösen kann (= gegen übermäßigen Staatsinterventionismus) · Solidaritätsprinzip: übereinstimmende Lebenslagen u. -anschauungen sowie Interessenkonvergenz
- Verbundenheit als die Sozialordnung gestaltendes Prinzip
- Kommutarismus: Arm + Reich als eine Gesellschaft; mehr Befriedigung in d. Beziehung zu anderen Menschen als durch Warenfetischismus · Recht auf Arbeit als Menschenrecht
- es darf keine Ausbeutung und Randexistenzen ohne Menschenwürde geben
- keinen blinden Glauben an d. freie Entfaltung der Marktkräfte als Lösung sozialer Probleme; jedoch
Befürwortung des Kapitalismus als Wirtschaftssystem
- Mensch + Menschenwürde stehen im Mittelpunkt vor Profit
Wurzeln:
katholische Sozialenzykliken z.B. Papst Pius XI., ... Papst Johannes Paul II.
Ziele:
- Verantwortung der Gesellschaft für das Individuum à Subsidiarität (teilweise Eigenverantw.
d. Ind.)
- Verantwortung des Individuums für die Gesellschaft à Verpflichtung zu sittlichem Handeln
1.2 Sozialstaat und Rechtsstaat
Das GG verlangt in Art.28 einen sozialen Rechtsstaat. Grundwerte: Sozialstaat Rechtsstaat
Existenzsicherung Würde, Freiheit, Gleichheit sozialer Ausgleich Schutz des Privateigentums Staatseingriffe in Privateigentum
Vollbeschäftigung,
Erhaltung der Arbeitskraft
= Schutz der Gesellschaft = Schutz der Gesellschaft durch den Staat vor dem Staat
Formale Rechtsstaatlichkeit: Alle staatliche Gewalt ist an geltendes Recht gebunden. = Rechtssicherheit, Rechtsschutz + unabhängige Justiz
Materielle Rechtsstaatlichkeit: In den Rechtsnormen muß Gerechtigkeit walten.
Bindung der Staatsgewalt an Grundwerte der gerechten Gesell-
schaftsordnung; v.a. die klassischen liberalen
Grundwerte der per-
sönlichen Freiheit und rechtlichen Gleichheit (Art.1, 2, 14 usw.)
ABER auch soziale Grundwerte (Art.1, 12, 20 usw.)
Zwar sind (nach alter Auffassung) Sozialstaat und Rechtsstaat Gegensätze, da der Rechtsstaat den Bürger vor Eingriffen des Staates schützt, während der Sozialstaat gerade diese gebenden + neh-menden Eingriffe fordert, um der Erfüllung sozialer Ansprüche gerecht werden zu können.
Tatsächlich aber führt der soziale Rechtsstaat den klassischen liberalen Rechtsstaat insofern weiter, indem er nicht nur die rechtliche Freiheit und Gleichheit des Individuums sichert, sondern ebenso die materiellen Voraussetzungen für soziale Gleichheit (Chancengleichheit usw.) schafft.
Aus dem Sozialstaatsprinzip läßt sich nur in Ausnahmefällen eine einklagbare Forderung begründen, z.B. Menschenwürde à materielles Existenzminimum
Die Sozialstaatsklausel zielt auf die annähernd gleiche Förderung des Wohles aller Bürger.
(2.) Grundprinzipien der sozialen Sicherung
Soziale Sicherung im engeren Sinn bedeutet, den einzelnen vor einer unzumutbaren
Verschlechterung seiner Existenzbedingungen zu schützen, indem bei existenzgefährdenen Risiken (Krankheit, Unfall: kein Einkommen mehr / Tod, Unfall, Krankheit: Ernährer kein Einkommen mehr, Existenz der Hinterbliebenen ist bedroht usw.) eines der drei unten beschriebenen Prinzipien Leistungen erbringt. Allerdings gilt der Vorrang der Eigenvorsorge (= der soziale Schutz soll so weit gehen, wie der einzelne nicht in der Lage ist, auf sich gestellt Vorsorge zu treffen).
Außerdem bedeutet soziale Sicherung aber auch die Verbesserung der materiellen
Existenzbedin-ungen sozial schwacher Gruppen, um der Forderung nach Chancengleichheit gerecht zu werden (Gleichheit der Startchancen für Einkommenserwerb).
Der Grad der Unzumutbarkeit von Existenzbedingungen ist eine politische Entscheidung; unterschreiten sie einen Standard (Existenzminimum), tritt die Sozialhilfe in Kraft.
2.1 Versicherungsprinzip
Versicherungsgemeinschaften: Beitragszahlungen; im Versicherungsfall (z.B. Krankheit, Unfall, Alter)
Anspruch auf finanzielle Leistungen.
- System von Leistung / Gegenleistung
- gesetzliche Rentenversicherung
- gesetzliche Krankenversicherung
- gesetzliche Unfallversicherung
- Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld)
2.2 Versorgungsprinzip
Aufgrund (nicht-finanzieller) besonderer Opfer oder Sonderleistungen Anspruch auf Sicherungsleistungen; Finanzierung aus dem öffentlichen Haushalt.
- Kriegsopferversorgung
- soziale Entschädigung bei Impfschäden
- Beamtenversorgung
- Kindergeld (ohne Einkommensgrenzen)
2.3 Fürsorgeprinzip
Jeder aufgrund seiner besonderen individuellen Situation Bedürfte hat unabhängig von irgendwelchen Vorleistungen oder Opfern Anspruch auf Hilfe; Finanzierung aus dem öffentlichen Haushalt.
- Sozialhilfe
- Jugendhilfe
- Resozialisierung
- Wohngeld
- Kindergeld (bei Einkommensgrenzen)
è Die drei Prinzipien treten meist in Mischformen auf. In der BRD dominiert bisher das Versicher-
ungsprinzip, das als grundsätzliche Leistungs-Gegenleistungs-Beziehung am ehesten zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung paßt.
2.4 Freiwillige Versicherung und Versicherungszwang
Die liberale Handhabe der freiwilligen Existenzsicherung birgt das Problem, daß leichtsinnige und kurzsichtige Menschen, die sich nicht versichern, der Allgemeinheit zur Last fallen. Daher ist ein Sicherungszwang unbedingt notwendig.
Der Sicherungszwang in der Form der Versicherungspflicht bedeutet, Individuum muß sich versichern, kann aber entscheiden, bei welcher Gesellschaft (z.B. KFZ- Haftpflichtversicherung). Der markt-wirtschaftliche Wettbewerb erzeugt aber eine Differenzierung: Gesunde zahlen wenig, Kranke viel. Dadurch gibt es keine voraussehbaren Nettozahler + Nettoempfänger - es findet kein Solidaraugleich statt. Deshalb ist das Prinzip der Pflichtversicherung nötig: der Versicherte ist verpflichtet, seiner Versicherungspflicht bei einem bestimmten Versicherungsträger nachzukommen, z.B. gesetzliche Rentenversicherung.
Der wichtigste Zweig der Versicherungen ist die Sozialversicherung. Pflichtversichert sind alle Arbei-ter + Angestellten sowie ein großer Teil der Selbständigen. à gesetzliche Krankenversicherung: Schutz vor + bei Krankheit (Arztkostenerstattung) à gesetzliche Rentenversicherung: Altersrente, Invalidenrente, Witwen- und Waisenrente à Arbeitslosenversicherung: Schlechtwettergeld, Arbeitslosengeld (max. 1 jahr) / Arbeitlosenhilfe
(sofern nach Arbeitslosengeld noch immer bedürftig)
(3.) Sozialpolitik
Die Finanzen der drei großen Säulen des Sozialsystems - Renten-, Kranken- und
Arbeitslosenversicherung -sind extrem angespannt; die Verschuldung wächst immer mehr an.
3.1 Krise des Sozialstaates
Ursachen
- Massenarbeitslosigkeit: Einnahmen fallen, Ausgaben steigen
- demographischer Wandel à Alterung der Bevölkerung: Finanzierungsproblem d. Pflege- u. Renten- versicherung
- Wiedervereinigung: rapider Zuwachs von Anspruchstellern an das Sozialsystem · Globalisierung
- 1972 Rentenreform = Einführung d. flexiblen Altersgrenze (à Anstieg der Rentenbezugsdauer): finanziert durch Beitragzahler der Sozialversicherung (Arbeitgeber und -nehmer)
- Widerspruch des Sozialsystems: durch die enge Kopplung der Beiträge an die Einkommen sinken die Einnahmen immer dann, wenn die Ausgaben steigen.
Folgen
- Einschränkung der verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer à geringe Spar- bzw. Konsummög- lichkeiten
- Behinderung des Leistungswillen des einzelnen
- Kostenbelastung der Arbeitgeber: hohe Lohnnebenkosten
damit à Arbeitlosigkeit: Rationalisierung (Maschinen sind auf Dauer billiger + sozialabgabenfrei)
à Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit d. Unternehmen
- Anwachsen der Verschuldung der öffentl. Haushalte · Gefahr des Mißbrauchs
Mögliche Lösungsansätze
Nicht nur Lohnempfänger, sondern alle Bürger sollten Sozialabgaben per Steuern bezahlen, da dieser über Steuern finanzierte Anteil immer mehr zurückging (Kostenverschiebung auf Beitragszahler würde so aufgehalten). Allerdings wäre eine Steuererhöhung z.B. der Mehrwertsteuer aufgrund der leeren öffentl. Kassen unumgänglich; denkbar wäre auch, um untere Einkommensgruppen nicht übermäßig zu belasten, eine höhere Steuer für Luxusgüter oder eine Ökosteuer für Sozialabgaben heranzuziehen. Einsparungen wären auch möglich durch die Kopplung d. Kindergeldes an d. Höhe des Einkommens.
Argumente pro Sozialstaat
- investive Wirkung der Sozialausgaben auf d. Humankapital: (Reproduktion, Gesundheit + Qualifika- tion der Arbeitskraft)
- politisch-gesellschaftliche Stablisierungs- und Integrationsfunktion des sozialstaatl. Systems · Garantie d. sozialen Absicherung = Ermöglichung der Motivation + Qualifikation d. Arbeitskräfte
- ermöglicht Strukturwandel, da Angst vor sozialen Folgen unbegründet à soziale Absicherung als institutionelle Voraussetzung für ökonomische, soziale + kulturelle Modernisierung · Sozialstaat schafft Arbeitsplätze: stationäre + ambulante Pflege, Erzieherberufe usw.
3.2 Rentenversicherung
Probleme
- Demographischer Wandel: Bevölkerungsrückgang und höhere Lebenserwartung
- Arbeitslosigkeit
Lösungsvorschläge
- Grundrente a) beitragsfinanzierte Grundrente: Jeder zahlt den gleichen Beitrag und erhält dafür je nach Versicherungsdauer eine einheitliche Rente.
b) steuerfinanzierte Grundrente: alle Bürger, die 25 Jahre lang Steuern bezahlt haben, erhalten ab 65 eine Grundrente von 55% d. durchschn. Pro-Kopf- Einkommens
à in beiden Fällen gilt: zur Sicherung des Lebensstandards sind Einkünfte aus Betriebspensionen und privater Altersvorsorge notwendig.
- Umlagerente Die Erwerbstätigen zwischen 15 und 65 Jahren zahlen für die Generation der Renter
(Generationenvertrag); die Höhe der Rente hängt vom Beitrag und dem Verhältnis Beitragszahler / Rentner ab.
- Basisrente Anstatt Garantie des Lebensstandards nur noch Basis-Sicherung; dafür gleichblei bende Beiträge (durch Fixierung der Beitragsbemessungsgrenze = bis zu diesem Betrag wird das Gehalt bei der Rente berücksichtigt) à zusätzliche private Vorsorge notwendig.
- Kapitalrente ,,Kapitaldeckungsverfahren" = Ansparen der Rente im Laufe des Arbeitslebens (bei Banken, Versicherungen + Investmentfonds)
à hohe Rendite ABER hohes Risiko (Inflation, Fehlspekulation, Börsenkräche, Wirt- schaftskrisen usw.)
- Mindestrente lediglich Grundsicherung = zusätzliche Mindestrente aus Steuergeldern für die
Bezieher von Kleinstrenten
à zusätzliche private Vorsorge notwendig.
- Cappuccino-Modell (Niederlande) staatliche Basisrente + Pensionsfonds (80% der Rentner)
+ evtl. freiwillige private Vorsorge; Kaffee = staatliche Basisrente
Milchschaum = anfüllende Betriebsrenten (= Pensionskassen)
Häufig gestellte Fragen
Was sind die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Sozialstaates in Deutschland?
Das Sozialstaatsprinzip ist in Art. 20 und 28 GG verankert und zielt auf sozialen Ausgleich und soziale Sicherheit ab. Relevante soziale Grundwerte finden sich in Art. 1, 2, 3, 6, 9, 14 und 15 GG. Art. 79 GG garantiert den Schutz des Wesensgehalts von Grundrechten.
Welche Ziele verfolgt der Sozialstaat?
Der Sozialstaat zielt darauf ab, die Stellung sozial schwacher Personen zu verbessern, die soziale Lage derer zu sichern, die es nicht selbst können, und eine annähernd gleiche Förderung des Wohles aller sowie eine gleichmäßige Verteilung der Lasten zu gewährleisten.
Welche unterschiedlichen Menschenbilder liegen den politischen Ideologien (Liberalismus, Sozialismus, Katholische Soziallehre) zugrunde?
Der Liberalismus betont persönliche Freiheit, rechtliche Gleichheit und privates Eigentum. Der Sozialismus legt Wert auf soziale Gleichheit, Solidarität und Freiheit. Die Katholische Soziallehre betont Subsidiarität, Solidarität, Kommutarismus und das Recht auf Arbeit.
Wie unterscheiden sich Sozialstaat und Rechtsstaat?
Der Sozialstaat fokussiert auf Existenzsicherung und sozialen Ausgleich, während der Rechtsstaat Würde, Freiheit, Gleichheit und den Schutz des Privateigentums betont. Der soziale Rechtsstaat geht über den klassischen liberalen Rechtsstaat hinaus, indem er materielle Voraussetzungen für soziale Gleichheit schafft.
Welche Grundprinzipien der sozialen Sicherung gibt es?
Es gibt drei Grundprinzipien: das Versicherungsprinzip (Leistung/Gegenleistung), das Versorgungsprinzip (besondere Opfer/Sonderleistungen) und das Fürsorgeprinzip (Bedürftigkeit unabhängig von Vorleistungen).
Was ist das Versicherungsprinzip und welche Bereiche deckt es ab?
Das Versicherungsprinzip basiert auf Beitragszahlungen in Versicherungsgemeinschaften, die im Versicherungsfall (z.B. Krankheit, Unfall, Alter) finanzielle Leistungen erbringen. Es umfasst die gesetzliche Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung.
Was ist das Versorgungsprinzip und welche Bereiche deckt es ab?
Das Versorgungsprinzip gewährt aufgrund besonderer Opfer oder Sonderleistungen Anspruch auf Sicherungsleistungen, die aus dem öffentlichen Haushalt finanziert werden. Beispiele sind die Kriegsopferversorgung, soziale Entschädigung bei Impfschäden, Beamtenversorgung und Kindergeld (ohne Einkommensgrenzen).
Was ist das Fürsorgeprinzip und welche Bereiche deckt es ab?
Das Fürsorgeprinzip gewährt jedem Bedürftigen, unabhängig von Vorleistungen, Anspruch auf Hilfe, finanziert aus dem öffentlichen Haushalt. Beispiele sind Sozialhilfe, Jugendhilfe, Resozialisierung, Wohngeld und Kindergeld (bei Einkommensgrenzen).
Warum ist ein Sicherungszwang notwendig?
Ein Sicherungszwang ist notwendig, um zu verhindern, dass leichtsinnige und kurzsichtige Menschen, die sich nicht versichern, der Allgemeinheit zur Last fallen.
Was sind die Ursachen für die Krise des Sozialstaates?
Ursachen sind Massenarbeitslosigkeit, demographischer Wandel (Alterung der Bevölkerung), die Wiedervereinigung, Globalisierung, die Rentenreform von 1972 und ein Widerspruch des Sozialsystems durch die enge Kopplung der Beiträge an die Einkommen.
Welche Folgen hat die Krise des Sozialstaates?
Die Folgen umfassen die Einschränkung der verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer, die Behinderung des Leistungswillen des einzelnen, die Kostenbelastung der Arbeitgeber, die Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, das Anwachsen der Verschuldung der öffentlichen Haushalte und die Gefahr des Missbrauchs.
Welche Lösungsansätze gibt es für die Krise des Sozialstaates?
Mögliche Lösungsansätze sind die Beteiligung aller Bürger an Sozialabgaben per Steuern, Steuererhöhungen (z.B. Mehrwertsteuer, Luxusgütersteuer, Ökosteuer) und die Kopplung des Kindergeldes an die Höhe des Einkommens.
Welche Argumente sprechen für den Sozialstaat?
Der Sozialstaat hat eine investive Wirkung auf das Humankapital (Reproduktion, Gesundheit, Qualifikation der Arbeitskraft), eine politisch-gesellschaftliche Stabilisierungs- und Integrationsfunktion, garantiert soziale Absicherung und ermöglicht Strukturwandel und schafft Arbeitsplätze.
Welche Probleme gibt es in der Rentenversicherung?
Probleme sind der demographische Wandel (Bevölkerungsrückgang und höhere Lebenserwartung) und die Arbeitslosigkeit.
Welche Lösungsvorschläge gibt es für die Rentenversicherung?
Lösungsvorschläge sind die Grundrente (beitrags- oder steuerfinanziert), die Umlagerente (Generationenvertrag), die Basisrente (nur noch Basis-Sicherung), die Kapitalrente (Ansparen der Rente), die Mindestrente (zusätzliche Rente aus Steuergeldern) und das Cappuccino-Modell (staatliche Basisrente + Pensionsfonds + private Vorsorge).
- Arbeit zitieren
- Philipp Koch (Autor:in), 2000, Sozialstaat und Sozialpolitik in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97513