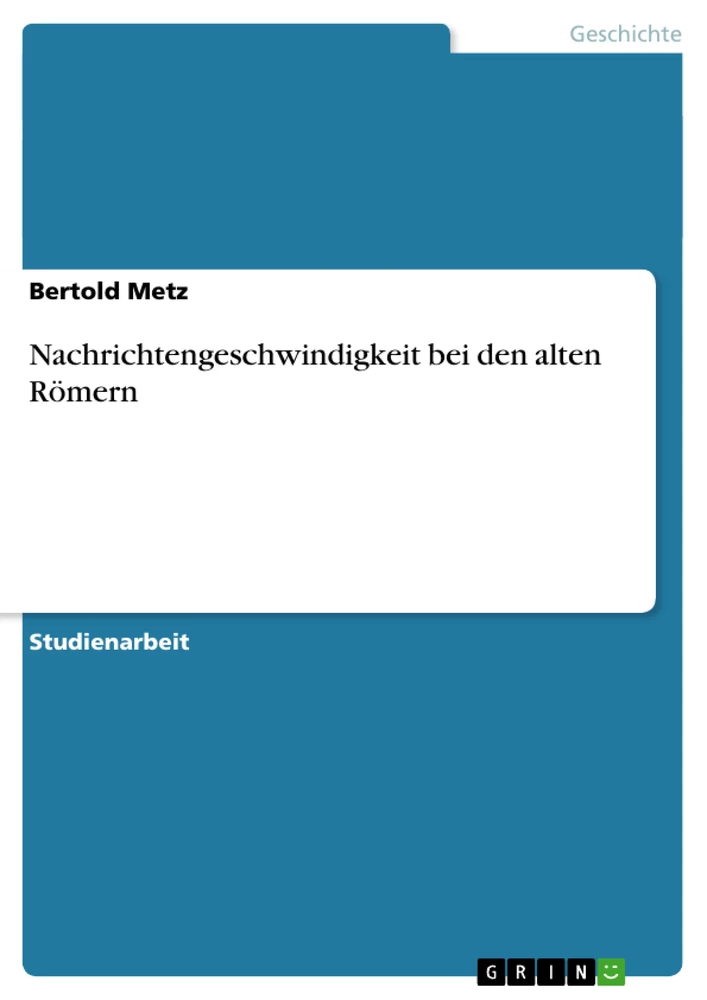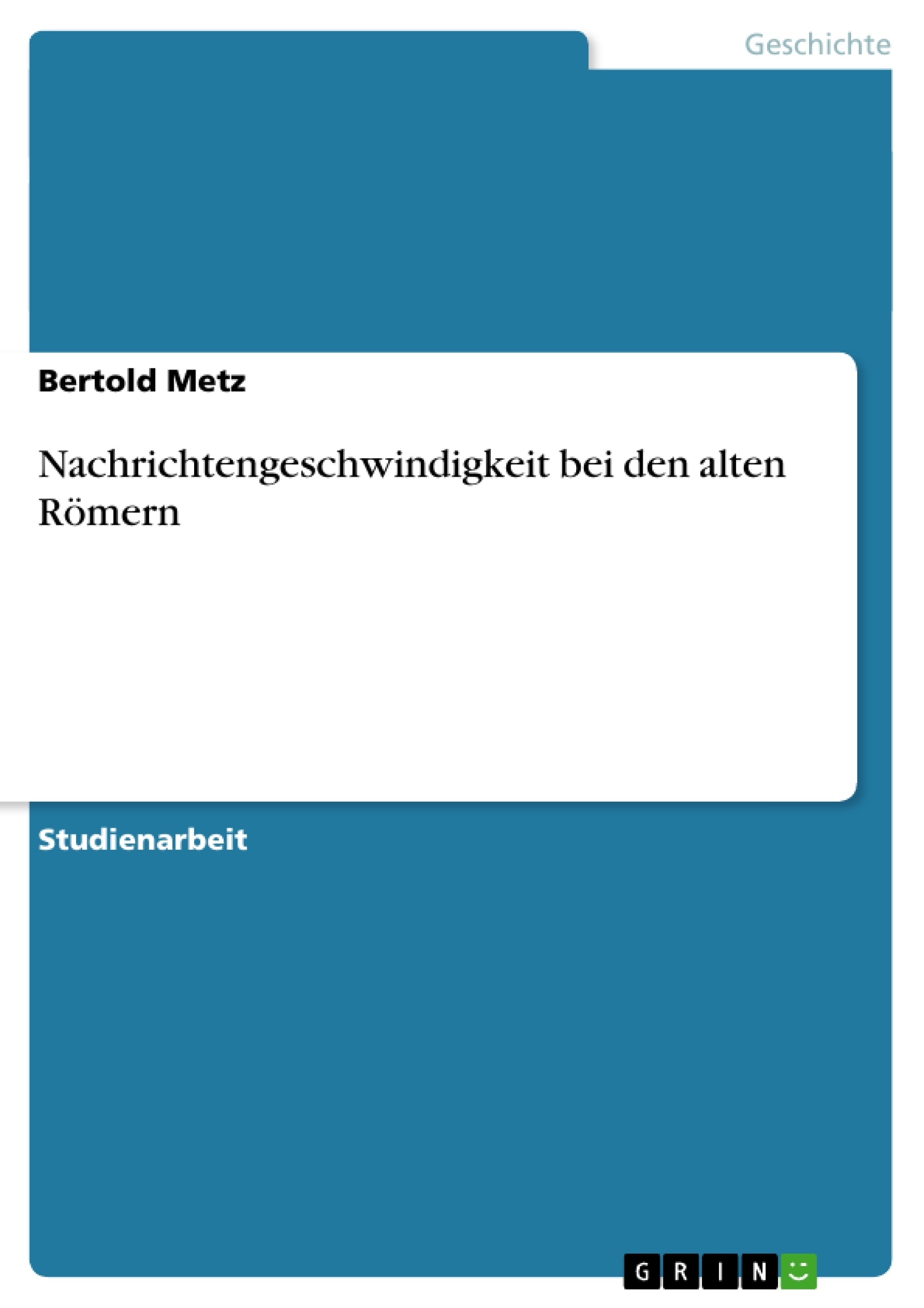Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt ohne E-Mails, ohne Telefon, ohne die blitzschnelle Kommunikation des 21. Jahrhunderts. Wie schnell verbreiten sich Nachrichten in einem Reich, das sich über Tausende von Kilometern erstreckt? Diese Frage steht im Zentrum dieser faszinierenden Untersuchung des Nachrichtenwesens im Römischen Reich. Entdecken Sie die akribischen Methoden, mit denen die Römer Informationen über Land und See transportierten, von den beschwerlichen Märschen der Legionäre bis zu den waghalsigen Seereisen über das Mittelmeer. Erfahren Sie mehr über das ausgeklügelte Relaissystem des cursus publicus, das es ermöglichte, dringende Botschaften mit bemerkenswerter Geschwindigkeit zu befördern. Verfolgen Sie die Routen der reitenden Boten, die Tag und Nacht unterwegs waren, und die gefährlichen Seewege, die von Wind und Wetter abhängig waren. Tauchen Sie ein in die Welt der tabellarii, der Fußboten, die kilometerweit eilten, um private Nachrichten zu überbringen. Doch wie zuverlässig war dieses System wirklich? Welche Hindernisse – von Straßenräubern bis zu Schiffbrüchen – bedrohten den Informationsfluss? Anhand von Originalquellen wie den Briefen Ciceros und den Schriften von Livius rekonstruiert diese Arbeit ein lebendiges Bild des römischen Nachrichtenwesens. Sie beleuchtet nicht nur die technischen Aspekte der Nachrichtenübermittlung, sondern auch die politischen, militärischen und sozialen Auswirkungen. Ein Muss für alle, die sich für die römische Geschichte, die Logistik antiker Reiche und die Bedeutung von Kommunikation in einer vernetzten Welt interessieren. Ergründen Sie die Geheimnisse der römischen Kommunikation, von der Briefbeförderung bis zur staatlichen Kurierdienst. Erfahren Sie, wie Informationen das römische Reich zusammenhielten und welche Herausforderungen bei der Nachrichtenübermittlung auftraten. Die Geschwindigkeit der Nachrichten spielte eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Imperiums. Begleiten Sie uns auf einer Reise in die Vergangenheit und entdecken Sie die faszinierende Welt des römischen Nachrichtenwesens, ein Spiegelbild unserer eigenen Informationsgesellschaft. Dieses Buch bietet einen detaillierten Einblick in die Transportmethoden, Reisezeiten und Kommunikationsstrategien der Römer und zeigt, wie sie trotz technologischer Beschränkungen ein effizientes Nachrichtensystem aufbauten.
Inhalt
1. Vorwort
2. Die Quellen
3. Das Relaissystem
4. Arten und Geschwindigkeiten der Fortbewegung
4.1. Zu Fuß
4.1.1.Das Heer
4.1.2.Der einzelne Fußgänger
4.2. Reitende Boten
4.3. Wagenfahrten
4.4. Schiffahrt
4.4.1.Binnenschiffahrt
4.4.2.Seefahrt
5. Unsicherheiten im Briefverkehr
6. Übersicht
7. Literaturverzeichnis
1. Vorwort
Durch seine gewaltigen Ausmaße imponiert heute das Imperium der römischen Kaiserzeit, maß doch seit Ende des ersten Jahrhunderts die West-Ost - Achse von der Westküste Spaniens bis an die Grenzen des Partherreiches mehr als 4500 km in der Luftlinie, eine Distanz, die mit einem modernen Flugzeug in knapp 5 Stunden bewältigt werden kann. Doch die Römer waren auf weniger fortschrittliche Hilfsmittel angewiesen, sie reisten zu Fuß, zu Pferde, im Wagen oder zu Schiff.
Das in dieser Arbeit verschriftlichte Referat beschäftigt sich mit den Geschwindigkeiten, die auf diese Art und Weise erreicht werden konnten, um eine theoretische Grundlage für die Rekonstruktion derjenigen Geschehnisse zu schaffen, die mit der Überwindung einer bestimmten Wegstrecke zusammenhingen. Deshalb ist die Arbeit nach den verschiedenen Fortbewegungsarten gegliedert (zu Fuß, zu Pferd, zu Wagen, zu Schiff), und es werden jeweils Beispiele für Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeiten aus den antiken Quellen angeführt. Der besondere Schwerpunkt liegt dabei auf dem Nachrichtenwesen, das bei sämtlichen politischen und privaten Aktionen eine wichtige Rolle spielte und dem Faktor Zeit als entscheidender Größe unter-worfen war. Auch die Geschwindigkeit des marschierenden Heeres wurde berücksichtigt.
Bei der Auswahl der relevanten Quellenstellen war vor allem das Werk Wolfgang Riepls1 behilflich, denn "in erster Linie hat [ihm] mit wenigen Ausnahmen, die gesamte alte griechische und lateinische Literatur einschließlich der Inschriftensammlungen und, soweit schon zugänglich, der Papyrusurkunden als Quelle gedient" (Riepl 477)
2. Die Quellen
Als Belege für die (meist rekonstruierten) Geschwindigkeitsangaben ist an erster Stelle der Briefwechsel Ciceros2 zu nennen, da die Briefe zum Großteil mit Orts- und Datumsangaben versehen sind. Weiterhin finden sich für den Gegenstand nützliche Hinweise vor allem bei Livius3 , Herodian4, Cassius Dio5 und in der Historia Augusta.6
3. Das Relaissystem
Auf längere Distanzen ermüdet der Läufer, das Roß ermattet. Vor allem bei eiligen Nachrichten stellt die daraus resultierende Geschwindigkeitsverringerung ein ernstzunehmendes Problem dar. Eine Lösung bietet das Relaissystem, die Botenstaffel; an bestimmten Punkten wird der Bote bzw. sein Pferd ersetzt, der Weg bis zur nächsten Ablösestation kann in Höchstgeschwindigkeit zurückgelegt werden. Schon 2300 v.Chr. wurde dieses System in Ägypten zur Verbreitung von Wasserstandsmeldungen eingesetzt (Riepl 181); bei den Römern fand es seine Blüte in der Einrichtung des cursus publicus mit den mansiones und mutationes als Wechselstationen. Auf den Wagenverkehr hat es die umfassendste Anwendung gefunden, da hier alle leistungsbringenden Teile ausgetauscht werden können; deshalb erhielten die Überbringer drin-gender Botschaften in der späten Kaiserzeit oft den ausdrücklichen Befehl, die Reise (mit dem cursus publicus) Tag und Nacht fortzusetzen (Riepl 181-183).
Bei der nun folgenden Untersuchung muß also sorgfältig unterschieden werden zwischen 'Relaisgeschwindigkeit' und 'einfacher Geschwindigkeit'.7
4. Arten und Geschwindigkeiten der Fortbewegung
4.1. Zu Fuß
4.1.1. Das Heer
Man unterscheidet hier zwei Standardgeschwindigkeiten:8 Im militaris gradus (normaler Schritt) legt das Heer ca. 20 Millien (=30 km), im citatior gradus (Eilschritt) ca. 24 Millien (=36 km) pro Tag zurück.
Höhere Marschanforderungen setzen das Ablegen des Gepäcks voraus (z.B. Liv 3,23,3; 7,37,6; 7,37,11). Die Quellen nähern sich übereinstimmend einer oberen Grenze von 90 km pro Tag, die nicht überschritten werden kann (vgl. Riepl 135). Diese Leistung bewältigt z.B. Phillip III. v. Macedonien beim Vorstoß von Demetrias nach Elatea im Jahre 207 v.Chr. (Liv. 28,7,3). Bei längeren Distanzen jedoch sinkt die Geschwindigkeit des Heeres. So legt Scipio Africanus im Jahre 210 v.Chr. den Weg vom Ebro nach Neukarthago (ca. 440 km) in 7 Tagesmärschen zurück, also mit einer Tagesleistung von 63 km (Liv. 26,42,6)
4.1.2. Der einzelne Fußgänger
Die tabellarii waren meist zu Fuß unterwegs. Für Privatleute verbot sich schon aus Kostengründen die Verwendung fahrender oder reitender Boten, zumal höhergestellte Persönlichkeiten stets eine größere Anzahl tabellarii unterwegs hatten (Riepl 140f). Doch die Briefboten wurden durch die Schreiber scharf kontrolliert; wenn sie bummelten, mußten sie mit einer Rüge rechnen (Cic. fam. 2,19,1). Die exorbitanteste Leistung, die in diesem Zusammenhang aus der Antike anzuführen wäre, vollbrachte Euchidas, der das heilige Feuer von Delphi nach Platäa überführte und an einem Tag 187 km zurücklegte. Diese Anstrengung mußte er jedoch mit seinem Leben bezahlen.9 Der legendäre Läufer von Marathon, Phiddipides, überwand 490 v.Chr. innerhalb von 2 Tagen eine Entfernung von ca. 225 km.10 Im normalen Briefverkehr konnte ein Bote 75 km pro Tag meistern (vgl. Riepl 139-146); Briefe aus Rom brauchten zu Cicero nach Neapolis (ca. 200 km) drei bis fünf Tage (Riepl 142). Livius hingegen schätzt eine Tagereise auf ca. 40 km (Liv 30,29).
Zum Vergleich sollten entsprechende Leistungen der neueren Zeit zumindest rezipiert werden. Der Berufsläufer Littlewood gewann 1888 ein Sechstagelaufen mit 1002 km (167 km/Tag) (Riepl 146). Der Weltrekord im Bahnenlauf über 100 km wird von Don Ritchie mit 6:10:20 h gehalten; die 252km wurden beim "Spartathlon" von Yiannis Kouros in 20:25h zurückgelegt. (Kempen 93-96) Da die eben genannten Athleten modernste Technologie in ihr Training einbezogen, gibt sich hier ein gutes Maß für die Grenzen des Machbaren.
Über die Schnelligkeit von Relaisbotenläufern sind wir auf Mutmaßungen angewiesen. Wahrscheinlich wurde das Relaissystem nur in den Anfängen des cursus publicus auf Fußboten angewandt.
4.2. Reitende Boten
Für die einfache Reitergeschwindigkeit besitzen wir nur wenige Belege (Riepl 151). Der Grund dafür liegt in der mangelnden Kondition des Reittieres,. Bei Mehrtagesmärschen ist ein Fußgänger erheblich ausdauernder als ein Pferd mit Reiter:
"`Nach dem vierten Tagesmarsch [...] marschiert der Reiter nicht schneller als der Fußsoldat, und nach dem siebten beginnt der Fußsoldat den Reiter zu überholen, und er muß von da an seinen Tagesmarsch zusehends früher beenden, um es der Kavallerie zu ermöglichen, am gleichen Tag überhaupt noch im Lager anzukommen.` So faßte der U.S. Colonel William B. Hazen 1878 seine während der Indianerkriege im amerikanischen Westen gewonnenen Erfahrungen zusammen."11
Der Vorteil des Reiters liegt auf längeren Strecken also nur im Relais.
Das erste Zeugnis von untergelegten Pferden finden wir bei Livius: Tib. Sempronius Gracchus wollte die Treue König Philips190 v.Chr. durch einen überraschenden Besuch auf die Probe stellen, und "per dispositos equos prope incredibili celeritate ab Amphissa [...] die tertio Pellam pervenit." (Liv. 37,7,11 - Hervorhebung BM), das entspricht einem Schnitt von ca. 107 km pro Tag. Dann hört man erst wieder bei Caesar von im voraus bereitgestellten Pferden,12 die er zur beschleunigten Nachrichtenübermittlung verwendet (z.B. bc 3,101,3).
Die höchste uns überlieferte Leistung mit Relais aus dieser Zeit stammt von Hannibal. Er floh von Carthago nach Thapsus, hatte seine Flucht jedoch vorbereitet und Pferde zum Wechseln entlang des Weges verteilt. So bewältigte er diese Strecke (ca. 225 km) in nur 12 Stunden (Liv. 33,47-48).
Die Auswertung des verfügbaren Quellenmaterials ergab eine Durchschnitts-geschwindigkeit für berittene Relaiskuriere von 150-180 km pro Tag (Riepl 193f, Junkelmann 84), die Höchstgeschwindigkeit mit kurzem Relais liegt bei ca. 300 km pro Tag (Riepl 209). Diese Angabe deckt sich auch mit der Überlieferung anderer Völker: In China legten Relaiskuriere unter Kublai-Khan täglich 300-330 km zurück (Riepl 195).
Ein direkter Beweis dafür, daß außer den Pferden auch die Reiter gewechselt wurden (was eine enorme Geschwindigkeitssteigerung zur Folge gehabt hätte), läßt sich aus den Quellen nicht erbringen (Riepl 193), doch es ist anzunehmen, daß dies im Rahmen des cursus publicus schon begangen wurde, denn bei mehrtägigen Reisen fällt das Schlaf- und Eßbedürfnis des Boten stark ins Gewicht. Gerade bei besonders wichtigen Nachrichten scheint das aber nur selten gemacht worden zu sein, da der Bote so mündlich befragt werden konnte; außerdem war die persönliche Zuverlässigkeit eines Boten ein wichtiger Faktor.
4.3. Wagenfahrten
Ein gewöhnlicher Reisender legte im Wagen durchschnittlich 60 km/Tag zurück, so z.B. Horaz, der in 10 Tagen von Brundisium nach Rom reiste (ca. 500 km).13 Das Relaissystem wurde vor allem von Caesar verwandt, der im Wagen auch schlief und Briefe diktierte. So überwand er die 1200 km von Rom an die Rhone in knapp 8 Tagen, was einem Schnitt von 150 km/Tag entspricht.14
4.4. Schiffahrt
4.4.1. Binnenschiffahrt
Die Zeugnisse für Benutzung der Binnenschiffahrt im Dienste der Nachrichtenbeförderung sind spärlich (Riepl 174); zur schnellen Beförderung kam nur die "Talfahrt" stromabwärts in Betracht, da die Schiffe stromaufwärts gezogen werden mußten. Von der Stromgeschwindigkeit, die ihrerseits vom Wasserstand abhängt, hängt auch die Geschwindigkeit des Schiffes ab. Eil- oder Depeschenboote konnten bei mäßiger Besetzung mit sich ablösender Rudermannschaft flußabwärts je nach Strömung bequem 100 bis 200 km täglich hinter sich bringen. (Riepl 180)
4.3.2 Seefahrt
Die durchschnittliche Geschwindigkeit zur See betrug ca. 10-11 km/h, eher weniger (vgl. Riepl 160f;167;168) , wobei in der Zeit der Republik wegen schlechteren Schiffen und unerfahrenerer Besatzung das Tempo bei ca. 6-8 km/h lag (ebd.). Plinius führt einige Rekordzeiten auf:15
275 km/Tag Von Ostia nach Africa (Karthago oder Utica) = ca. 550 km in 2 Tagen. 245 km/Tag Von Puteoli nach Alexandria (2200 km) in 9 Tagen 225 km/Tag Von Rom nach Tarraco (900 km) in 4 Tagen Besondere Aufmerksamkeit ist an dieser Stelle den sommerlichen Passatwinden des Mittelmeeres zu schenken, die die Geschwindigkeit und manchmal sogar die Richtung der Reise maßgeblich beeinflußten, da sie stets nur aus nördlicher Richtung wehen. Der Weg von Rom nach Alexandria konnte so in 10-20 Tagen bewältigt werden, der Rückweg jedoch verlief entlang der Südküste Kleinasiens über Kreta und Sizilien bei Gegenwind, was die Reisezeit mindestens verdoppelte.16 Zudem mußte während der Winterszeit von Oktober bis März die Schiffahrt bis auf wenige Ausnahmen eingestellt werden, da es noch keinen Kompaß gab, was die Orientierung auf hoher See bei trüber Witterung erschwerte (Vegetius 5,9; Cic. Att 6,20,1; 10,11,4; fam. 2,14) Tagsüber richteten sich die Seeleute nach Markierungen (an der Küste) oder nach der Sonne, nachts nach den Sternen (Casson 174). Deshalb bewegten sich die Schiffe meist auch der Küste entlang (Liv. 26,19; 30,39; 34,8; 36,42; 31,44; 42,40).
5. Unsicherheiten im Briefverkehr
Cicero schreibt an Atticus: "A te litteras crebro ad me scribi video, sed omnes uno tempore accepi." (Cic. Att. 4, 7(6),2) Diese Notiz drückt die Unzuverlässigkeit des damaligen Briefverkehrs aus. Mehrere Faktoren nahmen hier Einfluß:
A) Wetterverhältnisse
Sie machten sich besonders beim Seeverkehr bemerkbar. Deshalb wurden wichtige Meldungen bisweilen durch mehrere Boten versandt (Cic.fam. 10,33,3; Cic. Att. 6,1,9).
Hierzu nur folgende Anekdote:
"Von Antiochia schrieb der Präfekt Petronius an Caligula wegen der Weigerung der Juden, des Kaisers Bildsäule im Tempel aufzustellen. Caligula drohte deshalb Petronius mit dem Tode. Die Überbringer dieses Briefes wurden jedoch drei Monate lang durch Stürme auf dem Meere aufgehalten, während andere mit der Nachricht von dem unterdessen erfolgten Tode Caligulas [am 24. Jan. 41 n.Chr.] eine günstigere Fahrt hatten. Den zweiten Brief mit der Nachricht hatte Petronius bereits 27 Tage in Händen, als der erste für Petronius so fatale ihn erreichte." (Riepl 230)
B) Wartezeiten
Passagierschiffe gab es keine. Deshalb mußte man an den Kaianlagen solange herumfragen, bis man ein Schiff in die gewünschte Richtung fand. In Ostia waren die Schiffahrtbüros um einen Platz konzentriert, wo man sich nur zu erkundigen brauchte. Doch einen festen Fahrplan gab es nicht - der hing nicht nur vom Wetter und den Winden ab, sondern auch von gewissen Vorzeichen (vgl. Casson 177ff).
Jeder, der eine mündliche oder schriftliche Nachricht verschicken wollte, mußte (vom frühen cursus publicus abgesehen) einen eigenen Boten nach dem Bestimmungsort abfertigen oder eine Gelegenheit abwarten, bis er einem gerade dahin reisenden Freund, Kaufmann oder fremden Boten die Sendung mitgeben konnte (Riepl 242). Freunde und Bekannte kündigten ihre Abreise an, um Briefe mitzunehmen (Cic. fam. 9,2,1f). Doch trotzdem herrschte oft Mangel an Beförderungsgelegenheiten (Att. 4,2,1; Q.fr. 2,12,3; fam. 15,16,1).
C) 'Kidnapping' des Boten
Im Krieg versuchten die beteiligten Parteien, Boten abzufangen (Liv. 23,34; 27,43; Dio 30,8) Vor allem die Bürgerkriege behinderten den reichsinternen Briefverkehr. So ließ z.B. Septimius Severus bei seinem Vorrücken auf Rom die Briefe des Gegenkaisers Pescennius Niger, die dieser an den Senat schrieb, abfangen (HA Severus 6,8).
D) Straßenräuber
Das Brigantentum behinderte den Briefaustausch nur wenig. Es beschränkte sich meist auf einzelne abgelegene, waldige und gebirgige Gegenden (z.B. Cic. fam.10,31,1 bezieht sich auf das Waldgebirge an der Grenze von Castilien und Andalusien) (Riepl 283).
6. Übersicht
Die allerhöchsten Geschwindigkeiten, die mit Relais erreicht werden konnten, sind 300-335 km in 24 h. Das Privatnachrichtenwesen erreichte etwa 75 km in 24 Stunden; diese Geschwindigkeit kann man z.B. aus Ciceros Korrespondenz erschließen. Routinenachrichten brauchten doppelt solange wie Expreßnachrichten (mit dem cursus publicus).17
"Eine amtliche Nachricht [...] ohne Expreßbeförderung durch Diplom konnte nach dem inneren Ägypten wohl vier Wochen und darüber unterwegs sein." (Riepl 230) Ein Brief Ciceros brauchte von Rom nach Athen bei rauher See 21 Tage (Fam. 14,5,1), ein anderer 46 (Cic. filius ad fam. 14,5,1) bzw. 1/4 Jahr (Att. 1,20,1, wahrscheinlich Gelegenheitsbeförderung). Ein Brief von Britannien nach Rom benötigte 27-34 Tage (ad Qu. fr. 3,1,13; 3,1,17; 3,1,25; Att. 4,17,3) Die Boten mit der Meldung vom Siege Caesars bei Munda (Spanien) waren knapp 35 Tage unterwegs (Dio 43,42 - 2625 km). Von Syrien nach Rom brauchte ein Brief 50 Tage (fam. 12,12). Der Freigelassene Icelsus brachte Galba die Nachricht vom Tode Neros in knapp 7 Tagen nach Spanien (Plut. Galba 7). Auf dem Landweg brauchte man von Italien nach Spanien einen, von Italien nach Alexandria zwei Monate (Casson 173). Um von Rom nach Brundisium zu gelangen benötigte man 7, auf dem Festland nach Byzanz 25 und nach Antiochia 40 Tage (Casson 218f).
7. Literaturverzeichnis
Primärquellen:
Caesar: Der Bürgerkrieg. Hg. und übers. von Georg Dorminger. 4. Aufl. München 1976
Cicero: An seine Freunde (Epistularum ad familiares). Hg. und übers. von Helmut Kasten. 2. Aufl. Darmstadt 1976
Ders.: Atticus-Briefe. Hg. und übers. von Helmut Kasten. Darmstadt 1990
Dio, Cassius: Römische Geschichte. Übers. von Otto Veh. 5 Bde. Zürich 1985-7
Herodian: Ab excessu divi Marci. Übers. von C.R.Whittaker. 2 Bde. London 1969/70
Historia Augusta - Römische Herrschergestalten. Übers. von Ernst Hohl. 2 Bde. Zürich, München1976, 1985
Horaz: Satiren und Episteln. Lat. und dt. von Otto Schönberger. 2., erw. Aufl. Berlin 1991
Livius: Römische Geschichte. Hg. und übers. von Hans Jürgen Hillen. 10 Bde. (Bücher 1-44) München, Zürich 1987/88
Plinius: Naturalis historiae - Natural History. Übers. von H.Rackham. Vol 5 London, Cambridge 1961
Plutarch: Große Römer - Vitae parallelae. Übers. von Konrat Ziegler. 6 Bde. Zürich, Stuttgart 1954-65.
Vegetius, Flavius Renatus: Epitoma rei militaris. Übers. von Fritz Wille. Aarau 1986
Sekundärliteratur:
Casson, Lionel: Reisen in der Alten Welt. München 1976
Junkelmann, Markus: Die Reiter Roms. Teil I: Reise, Jagd, Triumph und Circusrennen. Mainz 1990
Kempen, Yvonne: Krieger, Boten und Athleten. St. Augustin 1992
Riepl, Wolfgang: Das Nachrichtenwesen des Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Römer. Leipzig, Berlin 1913
Wells, Colin: Das römische Reich. 4.Aufl. München 1994
[...]
1 Riepl, Wolfgang: Das Nachrichtenwesen des Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Römer. Leipzig, Berlin 1913
2 Cicero, Marcus Tullius: An seine Freunde (Epistularum ad familiares). Hg. und übers. von Helmut Kasten. 2. Aufl. Darmstadt 1976 (= Cic. fam.). Ders.:Atticus - Briefe. Hg. und übers. von Helmut Kasten. Darmstadt 1990 (= Cic. Att.)
3 Livius, Titus: Römische Geschichte. Hg. und übers. von Hans Jürgen Hillen. 10 Bde (Bücher 1-44) München, Zürich 1987/88 (=Liv.)
4 Herodian: Ab excessu divi Marci. Übers. von C.R. Whittaker. 2 Bde. London 1969/70
5 Cassius Dio: Römische Geschichte. Übers. von Otto Veh. 5 Bde. Zürich 1985-7
6 Historia Augusta - Römische Herrschergestalten. Übers. von Ernst Hohl. 2 Bde. Zürich, München 1976, 1985
7 vgl. hierzu Riepl 180-201
8 Flavius Renatus Vegetius: Epitoma rei militaris. Übers. von Fritz Wille. Aarau 1986; 1,9
9 Plutarch: Große Römer. Übers. von Konrat Ziegler. 6 Bde. Zürich, Stuttgart 1954-65; Aristides 20 - zur Glaubwürdigkeit dieser Überlieferung vgl. Kempen, Yvonne: Krieger, Boten und Athleten. St. Augustin 1992, S. 110ff
10 vgl. Kempen 96ff
11 Junkelmann, Marcus: Die Reiter Roms. Teil I: Reise, Jagd, Triumph und Circusrennen. Mainz 1990; S. 84
12 z.B. Caesar: Der Bürgerkrieg. Hg. und übers. von Georg Dorminger. 4. Aufl. München 1976 (=bc)
13 Horaz: Satiren und Episteln. Lat. und dt. von Otto Schönberger. 2., erw. Aufl. Berlin 1991; sat. I,5
14 Plutarch: Caesar 17
15 Plinius: Naturalis historiae - Natural History. Übers. von H. Rackham. Vol. 5 London, Cambridge 1961; XIX.I, 3-4
16 Casson, L.: Reisen in der Alten Welt. München 1976; S. 176
Häufig gestellte Fragen
Was behandelt dieses Dokument über Nachrichtenwesen und Fortbewegung im Römischen Reich?
Dieses Dokument ist eine akademische Untersuchung der Geschwindigkeiten und Methoden der Fortbewegung im Römischen Reich, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nachrichtenwesen. Es untersucht, wie schnell Nachrichten und Personen zu Fuß, zu Pferd, mit Wagen und Schiffen transportiert werden konnten.
Welche Quellen werden für die Informationen verwendet?
Die Analyse stützt sich auf antike Quellen wie die Briefe Ciceros, die Werke von Livius, Herodian, Cassius Dio und die Historia Augusta. Außerdem wird auf die Sekundärliteratur des Nachrichtenwesens im Altertum verwiesen, insbesondere auf das Werk von Wolfgang Riepl.
Was ist das Relaissystem und wie funktionierte es?
Das Relaissystem war eine Methode, um die Geschwindigkeit der Nachrichtenübermittlung über lange Distanzen zu erhöhen. Boten oder Pferde wurden an bestimmten Stationen (mansiones und mutationes im cursus publicus) ausgetauscht, so dass die nächste Etappe mit maximaler Geschwindigkeit zurückgelegt werden konnte. Dies galt besonders für den Wagenverkehr.
Welche Geschwindigkeiten konnten zu Fuß erreicht werden?
Das Heer legte im normalen Schritt (militaris gradus) etwa 30 km und im Eilschritt (citatior gradus) etwa 36 km pro Tag zurück. Einzelne Fußgänger konnten im normalen Briefverkehr etwa 75 km pro Tag schaffen. Ausnahmsweise wurden auch Leistungen um die 187 km pro Tag erzielt, jedoch unter extremer körperlicher Anstrengung.
Wie schnell waren reitende Boten?
Reitende Boten erreichten durchschnittliche Geschwindigkeiten von 150-180 km pro Tag im Relaissystem. Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 300 km pro Tag waren mit kurzen Relais möglich.
Welche Geschwindigkeiten wurden mit Wagen erreicht?
Ein gewöhnlicher Reisender im Wagen legte durchschnittlich 60 km pro Tag zurück. Mit dem Relaissystem konnten jedoch Geschwindigkeiten von bis zu 150 km pro Tag erreicht werden.
Wie schnell war die Schifffahrt?
Die durchschnittliche Geschwindigkeit zur See betrug etwa 10-11 km/h, wobei die Geschwindigkeit in der Republik geringer war (6-8 km/h). Rekordzeiten von bis zu 275 km pro Tag wurden bei bestimmten Routen und günstigen Windverhältnissen erreicht.
Welche Unsicherheiten gab es im Briefverkehr?
Der Briefverkehr war von verschiedenen Unsicherheiten geprägt, darunter Wetterverhältnisse, Wartezeiten auf Schiffe, das Abfangen von Boten im Krieg und Straßenräuber. Diese Faktoren führten zu erheblichen Verzögerungen und Unzuverlässigkeiten bei der Nachrichtenübermittlung.
Wie lange brauchten Nachrichten, um von einem Ort zum anderen zu gelangen?
Die Dauer der Nachrichtenübermittlung variierte stark je nach Entfernung, Transportmittel und Umständen. Expreßnachrichten konnten Rom nach Athen in 21 Tagen erreichen, aber eine Gelegenheitsbeförderung konnte bis zu einem Vierteljahr dauern. Andere Beispiele umfassen 35 Tage von Spanien nach Rom und 50 Tage von Syrien nach Rom.
Was ist der Cursus Publicus?
Der Cursus Publicus war ein staatliches Kuriersystem im Römischen Reich, das für den schnellen Transport von Beamten, Gütern und Nachrichten eingerichtet wurde. Es umfasste ein Netzwerk von Straßen, Gasthäusern (mansiones) und Pferdewechselstationen (mutationes), um eine effiziente Kommunikation und Mobilität innerhalb des Reiches zu gewährleisten.
- Quote paper
- Bertold Metz (Author), 2000, Nachrichtengeschwindigkeit bei den alten Römern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97488