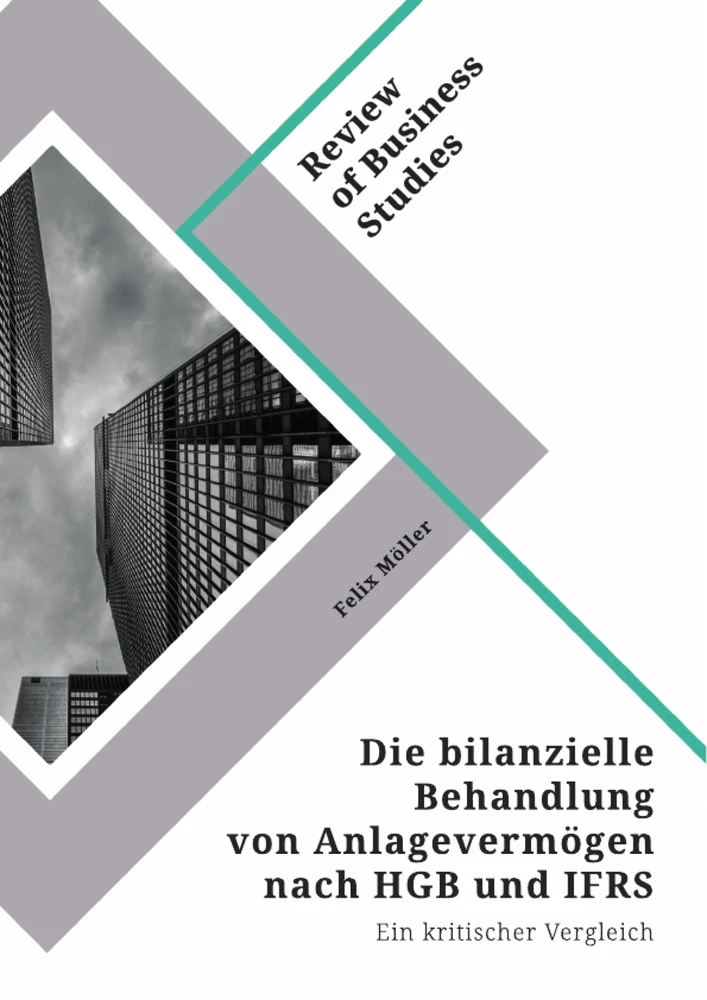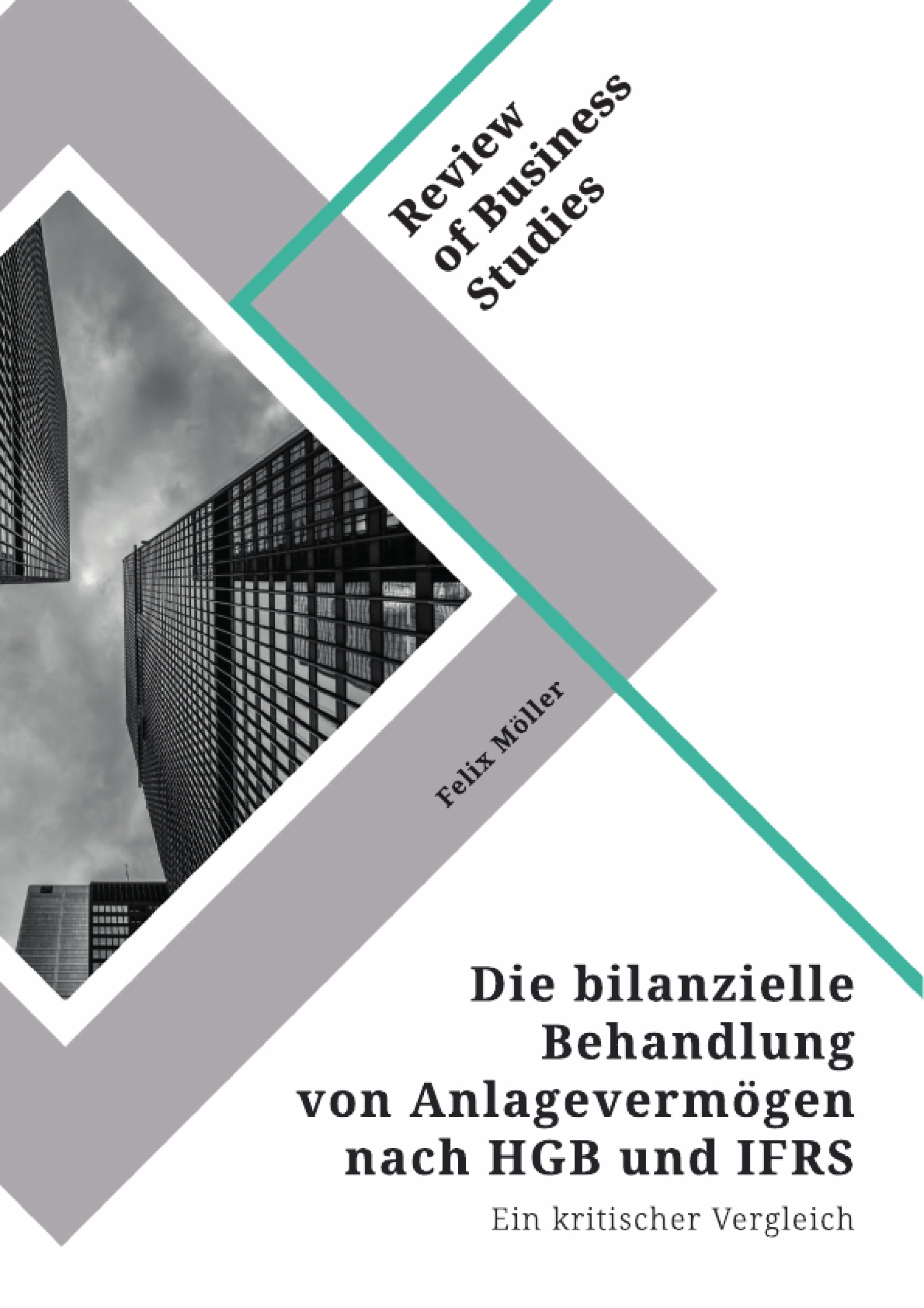Diese Bachelorarbeit soll die Unterschiede in der bilanziellen Behandlung von Anlagevermögen darstellen und aufzeigen, wie diese Unterschiede auf die abweichenden konzeptionellen Zielsetzungen der Rechnungslegungssysteme zurückgeführt werden können.
Im Rahmen einer Analyse relevanter (Lehrbuch-) Literatur und Rechnungslegungsvorschriften werden die Bilanzierungsvorschriften nach HGB und IFRS verglichen und Unterschiede konzeptionell begründet. Nach kurzer Betrachtung der konzeptionellen Grundlagen von HGB und IFRS werden die Bilanzierungsvorschriften für Vermögensgegenstände des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens dargestellt. In Kapitel 4 werden Unterschiede analysiert und mit den in Kapitel 2 dargestellten Grundlagen begründet. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen, bietet einen Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf und endet mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzeptionelle Grundlagen
- Handelsgesetzbuch
- International Financial Reporting Standards
- Bilanzierungsvorschriften für das Anlagevermögen nach HGB und IFRS
- Definitionen und Anwendungsbereich
- Immaterielles Anlagevermögen
- Sachanlagevermögen
- Finanzanlagen
- Kritischer Vergleich und konzeptionelle Begründung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die bilanzielle Behandlung von Anlagevermögen nach Handelsgesetzbuch (HGB) und International Financial Reporting Standards (IFRS) kritisch gegenüberzustellen. Es werden die konzeptionellen Grundlagen beider Regelwerke beleuchtet und die jeweiligen Vorschriften für die Bilanzierung von immateriellem Anlagevermögen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagen detailliert analysiert.
- Vergleich der Bilanzierungsvorschriften für Anlagevermögen nach HGB und IFRS
- Analyse der Unterschiede in der Definition und Abgrenzung von Anlagevermögen
- Bewertung von Anlagevermögen unter HGB und IFRS
- Kritische Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen beider Systeme
- Konzeptionelle Begründung der Unterschiede
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Relevanz des Vergleichs der Bilanzierung von Anlagevermögen nach HGB und IFRS. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die verfolgte Methodik. Die Einleitung hebt die zunehmende Bedeutung internationaler Rechnungslegungsstandards und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft hervor. Sie legt den Fokus auf die Notwendigkeit eines detaillierten Vergleichs, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Systeme zu verstehen.
Konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für den Vergleich der beiden Rechnungslegungsstandards. Es beschreibt die grundlegenden Prinzipien des HGB, wie beispielsweise das Prinzip der Vorsicht und der Gläubigerschutz. Im Gegenzug werden die grundlegenden Prinzipien der IFRS, wie beispielsweise das Prinzip der Fair Value Messung und die Ansatzpflicht erläutert. Das Kapitel bildet die Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die jeweiligen konzeptionellen Unterschiede beider Systeme herausarbeitet. Es veranschaulicht, wie diese konzeptionellen Unterschiede sich auf die praktische Anwendung auswirken.
Bilanzierungsvorschriften für das Anlagevermögen nach HGB und IFRS: Dieses Kapitel befasst sich mit den konkreten Bilanzierungsvorschriften für Anlagevermögen nach HGB und IFRS. Es analysiert die Definitionen und den Anwendungsbereich beider Regelwerke. Dabei werden die verschiedenen Kategorien des Anlagevermögens (immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen, Finanzanlagen) einzeln betrachtet und die jeweiligen Vorschriften detailliert dargestellt. Es werden die Unterschiede in der Bewertung, der Abschreibung und der Ansatzpflicht aufgezeigt, wobei konkrete Beispiele zur Veranschaulichung verwendet werden. Die Kapitel unterstreichen den Einfluss der unterschiedlichen Bewertungsansätze auf die Bilanzierung.
Kritischer Vergleich und konzeptionelle Begründung: In diesem Kapitel werden die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Bilanzierungsvorschriften kritisch verglichen und die konzeptionellen Unterschiede begründet. Es werden die Vor- und Nachteile beider Systeme diskutiert, wobei insbesondere die Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit der Bilanzierung und die Transparenz für die Stakeholder beleuchtet werden. Der Fokus liegt auf der Beantwortung der Frage, welches System für welche Zwecke besser geeignet ist und welche Konsequenzen sich aus der Wahl des einen oder anderen Systems ergeben. Es werden auch die Herausforderungen bei der Umstellung von HGB auf IFRS behandelt.
Schlüsselwörter
Anlagevermögen, HGB, IFRS, Bilanzierung, Bewertung, Immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen, Finanzanlagen, kritischer Vergleich, Rechnungslegung, konzeptionelle Grundlagen, Fair Value, Vorsichtsprinzip.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Bilanzierung von Anlagevermögen nach HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit vergleicht die bilanzielle Behandlung von Anlagevermögen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie analysiert die konzeptionellen Grundlagen beider Regelwerke und die Vorschriften für die Bilanzierung von immateriellem Anlagevermögen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagen.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit zielt auf eine kritische Gegenüberstellung der Bilanzierungsvorschriften für Anlagevermögen nach HGB und IFRS ab. Sie beleuchtet die konzeptionellen Unterschiede, analysiert die jeweiligen Vorschriften detailliert und diskutiert Vor- und Nachteile beider Systeme.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit umfasst den Vergleich der Bilanzierungsvorschriften, die Analyse der Unterschiede in der Definition und Abgrenzung von Anlagevermögen, die Bewertung von Anlagevermögen unter HGB und IFRS, eine kritische Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen beider Systeme sowie eine konzeptionelle Begründung der Unterschiede.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den konzeptionellen Grundlagen (HGB und IFRS), ein Kapitel zu den Bilanzierungsvorschriften für Anlagevermögen nach HGB und IFRS, ein Kapitel zum kritischen Vergleich und der konzeptionellen Begründung sowie ein Fazit und Ausblick.
Wie werden die konzeptionellen Grundlagen behandelt?
Das Kapitel zu den konzeptionellen Grundlagen beschreibt die grundlegenden Prinzipien des HGB (z.B. Vorsichtsprinzip, Gläubigerschutz) und der IFRS (z.B. Fair Value Messung, Ansatzpflicht). Es zeigt auf, wie sich diese konzeptionellen Unterschiede auf die praktische Anwendung auswirken.
Wie werden die Bilanzierungsvorschriften für Anlagevermögen behandelt?
Das Kapitel zu den Bilanzierungsvorschriften analysiert die Definitionen und den Anwendungsbereich beider Regelwerke für immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagen. Es werden Unterschiede in Bewertung, Abschreibung und Ansatzpflicht detailliert dargestellt und mit Beispielen veranschaulicht.
Wie wird der kritische Vergleich durchgeführt?
Im Kapitel zum kritischen Vergleich werden die Bilanzierungsvorschriften gegenübergestellt, Vor- und Nachteile beider Systeme diskutiert und die Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und Transparenz für Stakeholder beleuchtet. Die Arbeit untersucht, welches System für welche Zwecke besser geeignet ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anlagevermögen, HGB, IFRS, Bilanzierung, Bewertung, Immaterielles Anlagevermögen, Sachanlagevermögen, Finanzanlagen, kritischer Vergleich, Rechnungslegung, konzeptionelle Grundlagen, Fair Value, Vorsichtsprinzip.
- Quote paper
- Felix Möller (Author), 2020, Die bilanzielle Behandlung von Anlagevermögen nach HGB und IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/974479