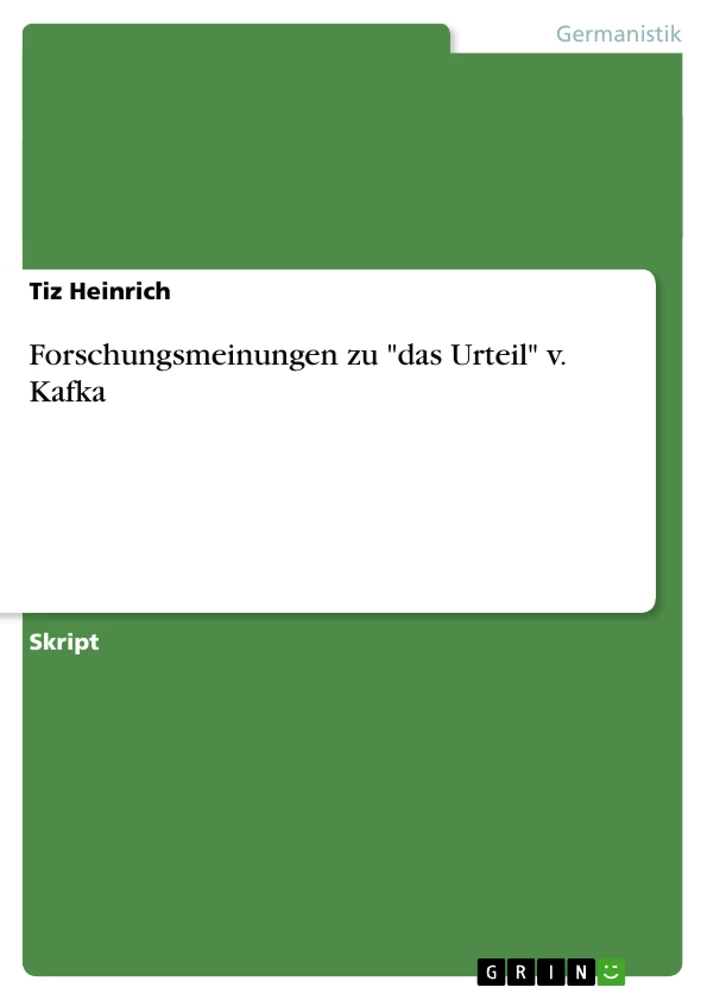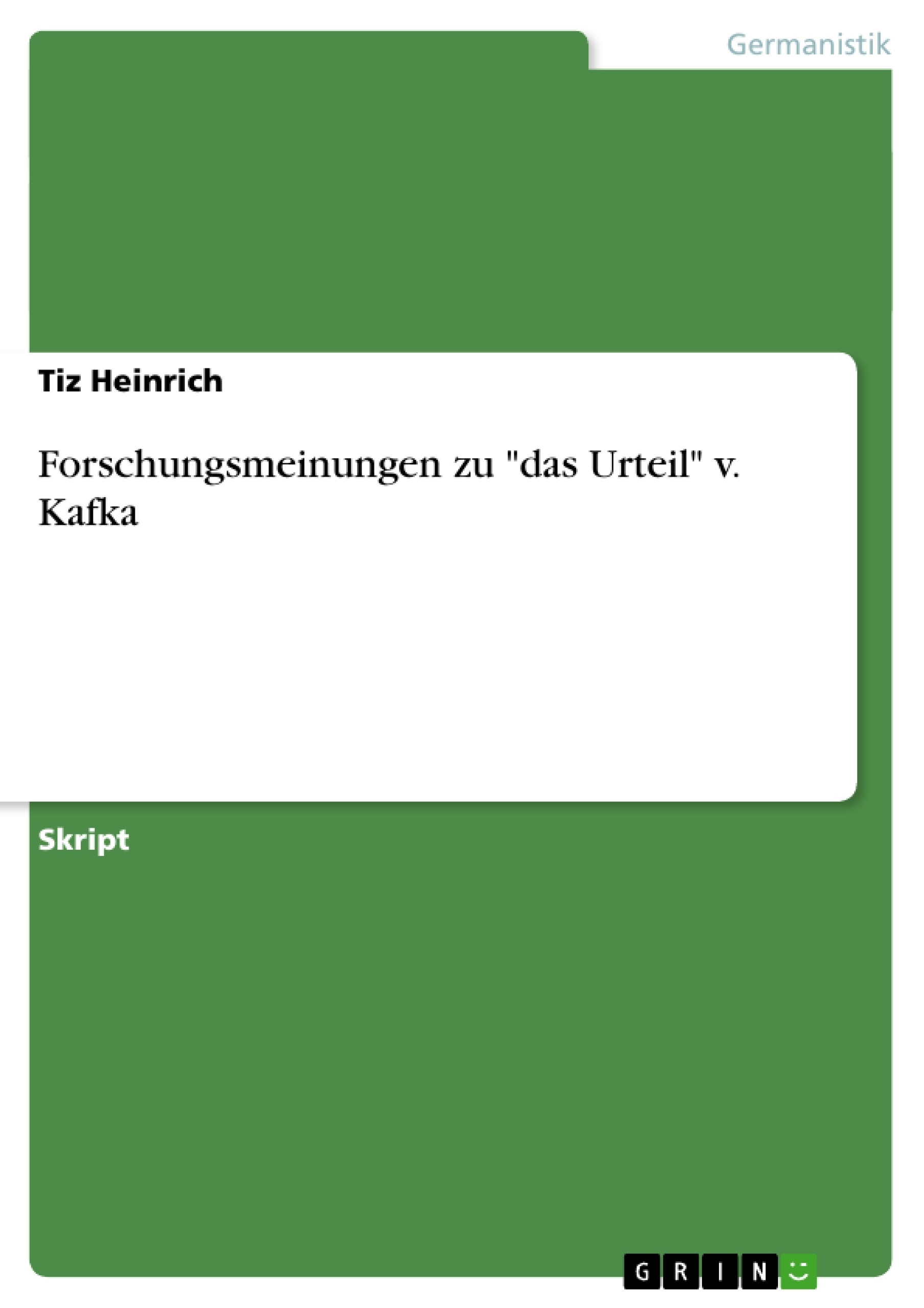Tiz Heinrich
Forschungsmeinungen zu "das Urteil" v. Kafka
Autobiographisches zum "Urteil"
"Sonntagvormittag": Der 22. Sept. 1912 = Sonntag!
1. Herbst 1912: Ka.'s literar. Durchbruch wegen dem "Urteil" (Selbstbestätigung!)
2. Ende 1911: Ka. wird zusammen mit seinem Schwager Mitbegründer einer Prager Asbestfabrik (Bürgerl. Laufbahn vs. Kunst, Ka.'s Zwiespalt)
3. August 1912: Kafka lernt Felice Bauer kennen, Heiratspläne..."Das Urteil verdanke ich -auf Umwegen- ihr." (vgl. Georg geht zugrunde, Kafkas "Erklärungen in Briefen an Felice: "Kein Zusammenhang usw..."
4. Nacht vom 22/23 Sept. = literar. Durchbruch! [Ist wohl nicht im Text verarbeitet worden, weil er ja erst am Schreiben war! Wird oftmals v. der Forschung vergessen! (Vgl. "Freund" = Ka.'s Schriftsteller Ur-Ich...]
5. 14. Sept. = Geburtstag seines Vaters
6. 15. Sept. sich abzeichnende Verlobung Brods mit Kafkas Schwester Valli
7. 20./21. Sept. Jom-Kippur-Fest (Versöhnungsfest, menschl. Bekenntnis der Sünden und
Bitte um deren Vergebung.) Vgl. Steinberg ('62): "Kafka hatte Schuldgefühle..." Auch Binder ('75): "Der sensibilisierte Kafka wurde sich seiner Schuld gegenüber der Gemeinschaft besonders stark bewusst...Das Fest könnte zumindest ein Auslöser gewesen sein!"
8. Im Sept. Besuch des vollbärtigen Onkels Alfred Löwy aus Madrid, nach Kafkas eigener Aussage ein Vorbild für den "Freund". Er erzählte ihm vom Junggesellentum und von seiner Isolation in Spanien. (Kafka war also in einem Spannungsfeld zw. Onkels Junggesellentum und Brods & Schwesters Verlobung!)
9. 17.11 - 7.12 1912: "Verwandlung" geschrieben.
Man kann also viele Vergleiche ziehen zw. Kafkas Biographie und dem Text "Urteil" Z.Bsp. Georg & Freund (Freund = Ka.'s unsoziales, künstlerisches Ich; Georg = Ka.'s bürgerl. angepasstes Ich) ABER, so Gray, Solches ist bloss der Anlass des Textes, noch keine Interpretation!
KAFKAS eigene Kommentare zum "Urteil" Von Nemec '81
1. ,,Freund" hat grösste Gemeinsamkeit zw. Vater & Sohn. Er ist blosse Abstraktion! Der Vater steigt aus dem Freund hervor, Ka. weiss nicht genau warum.
2. Die Braut lebt nur durch die Beziehung zum Freund. Da Georg nichts hat, trifft ihn das Urteil des Vaters so hart! [Es wird ihm bewusst, dass er bloss scheinbar hatte! Vgl. Vater: "Hast du wirklich einen Freund in P'burg?"]
3. Kafka an Brod: "Weisst Du, was der Schlussatz (des Urteils) bedeutet? - Ich habe dabei an eine starke Ejakulation gedacht." Und im Tagebuch: "...Gedanken an Freud natürlich haben mich beim Schreiben begleitet" Hieraus folgert Nemec, Kafka erteile damit die Lizenz, zur Entschlüsselung des Textes durch die Psychoanalyse, im Sinne der Traumarbeit. Er verlagert also die Bedeutung ausserhalb des Textes. D.h. Das Unbegreifliche bleibt unbegreiflich! Kafka freute sich exxtreem darüber, "wie sich die Geschichte vor mir entwickelte" vgl. sexuelle Erregung beim Schreiben. Weshalb solche Freude? Weil Kafka in der Person Georgs seine eigene Vater-Problematik abhandelt und! im gegensatz zu Georg nicht wegen der Übermacht des Vaters untergeht, sondern schreiben kann!!! Kafka schafft also als Dichter das Unmögliche, an dem Georg scheiterte: Auf dem Weg der Unterordnung unter die ihn bedrängenden Verhältnisse über sie zu triumphieren und gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen. (Bereits am Morgen nach der Niederschrift vor den Schwestern!) [Alles unter Ziff. 3. = Nemec '81 Interpretation!!!]
4. Widmung: "Für Fräulein Felice B." Er wollte Felice an sich binden, musste aber den Zusammenhang zw. Text & seinem Leben vor ihr leugnen (vgl. Brief vom 24. Okt. 1912 an sie: "Im übrigen hat die Geschichte nicht den geringsten Zushg. mit ihnen...") Felice bekam den Text ers im Frühling '13 zu Gesicht! Ka: "Aber du kennst ja noch gar nicht deine kleine Geschichte. Sie ist ein wenig wild und sinnlos und hätte sie nicht ihre innere Wahrheit (was sich niemals allgemein feststellen lässt, sondern immer wieder von jedem Leser oder Hörer von neuem zugegeben oder verleugnet werden muss) sie wäre ein nichts." Nemec: Kafka nehme hier die absurd scheinenden Momente seiner Geschichte zum Anlass, um den Bezug zu seiner eigenen (Lebens-)Geschichte zu leugnen. Kafka leugnete den Zusammenhang mehrmals, bzw. sagte, die Wahrheit sei das, was sich der Leser gerade dabei denke.
5. Nachdem FeBa schliesslich den Brief hat, kümmert sich Kafka wieder um das Verständnis des Textes: "Siehst du irgendeinen Sinn im Urteil?...ich finde ihn nicht, sogar die Bedeutung der zufälligen Namen habe ich erst später erkannt..." (2.6.'13) Und am 10.6.'13: "Das Urteil ist nicht zu erklären!" Dies tönt wie ein Interpretationsverbot! Vielleicht ist es eins?!?!
6. Der Text = eine Geburt mit Schleim und Schmutz. Ka. muss sich selbst den Gehalt seines eigenen Produkts deutlich machen: "...nur ich habe die Hand, die bis zum Körper (der Geburt) dringen kann und Lust dazu hat." [Vgl. Ka.'s Aussage: "Die Seele erkennt niemals sich selbst." Obwohl er selbst geschrieben hat, versteht er nicht alles!]
7. Noch 1920-'23 in Gesprächen mit Janouch sagt Ka.: Das Urteil ist das Gespenst einer Nacht...und die dadurch vollbrachte Abwehr des Gespenstes." Also Abwehr statt Lösung?! Ka. bestimmt an diesem Bsp. den Zweck literar. Lektüre: "Der Mensch liest um zu fragen", also nicht um Antworten zu finden, sondern um bei seiner Unklarheit stehen zu bleiben. [Meine Meinung:Er schrieb für sich, eben um abzuwehren. Am Schluss sah er ein gelungenes Werk vor ihm auf dem Tisch. Also wollte er diesen Text auch um jeden Preis veröffentlichen. Er wusste ja im Grunde, dass niemand ihn "verstehen" würde. Er brauchte Geld und rang um Anerkennung! Dieser Text bedeutete sein Sieg. D.h. Er musste nicht mehr befürchten abzustürzen, wie Georg.]
Übrigens: Nach Speirs helfen Ka.'s Kommentare nicht, weil sie widersprüchlich sind. [Hahaha!!!]
GRAY zum "Urteil" ('94)
1. Das "Urteil" konkretisiert eine allgemeine Krise des bürgerlichen Selbstbewusstseins (der bürgerl. Intellektuellen) vor dem 1. W.K. [Speirs '94 = dagegen: wegen des katastrophalen Ausgangs] Typisch für Kafkas Werk ist die Verallgemeinerung des eigenen Lebens (vgl. Bende- Mann)
2. Nicht der Inhalt, sondern die Form macht den Text zu einem anerkannten Meisterwerk der literarischen Moderne.
3. Gray erhellt den Zusammenhang zw. formalen Eigenschaften und der Rezeption anhand von S. Freuds Aufsatz "Das Unheimliche":
3.1. Um unheimlich zu wirken, muss ein Text
a) Das unheimliche Geschehen in eine Umgebung objektiver Berichterstattung
einbetten.
b) Der Leser muss sich mit dem Helden identifizieren können.
3.2. Nach Freud hat der Begriff "heimlich" 2 Bedeutungen:
a) Heimisch, vertraut
b) versteckt, verborgen
-Einerseits ist Georg = "heimlich", weil er zuhause im Vertrauten geblieben ist, und der Freund = "un-heimlich", weil er in der Fremde ist.
-Andererseits ist Georg = "un-heimlich", weil er mit dem Brief sein
"heimisch/heimliches", kindlich/unschuldiges Ur-Ich zugunsten des "un-heimlichen" bürgerlichen/angepassten Ichs verdrängt. ("so bin ich, so hat er mich hinzunehmen" (vgl. Nemec: die spielerische Langsamkeit seines Brief-Verschliessens...)
-Der Freund ist -so Gray- deshalb des Vaters "...Sohn nach meinem Wunsch," weil er sich eben nicht anpasst, sondern seinem Ur-Ich folgt und nach P'burg zieht. Es ist ja auch der "teuflische Mensch" Georg der verurteilt wird. Der Freund ist immer noch das unschuldige Kind, das Georg einmal war.
4. Das "Urteil" erzählt vom Scheitern dieser Verdrängung:
"Un-heimliches" wird "heimlich" D.h. wird bewusst! Führt zum Selbstmord. Georg will Stellvertreter seines Vaters sein/werden (Geschäft, Zimmer, Heirat). Dies wird aus Georgs sprachlichen Fehlleistungen erkennbar. ("Alles wird mit-übertragen...")
5. Mit welchem Recht verurteilt der Vater seinen -ihm so ähnlichen- Sohn? Es geht beiden um Macht, nicht um Moral! Nach Gray verurteilt der Vater das unzeitgemässe Nachahmen seines Sohnes. (Das Ur-Ich wäre den Zeitumständen adäquat!)
6. Das Urteil beschreibt also, so Gray, 2 Alternativen für das heranwachsende Bürgertum der europäischen Moderne (=Industrie- & Massenzeitalter):
a) Nachahmung der Alten, d.h. Anpassung an die verhärteten Verhältnisse
b) Sich der neuen Zeit aussetzen, ohne Vorbilder! Ohnmacht.
Diese beiden Möglichkeiten stellen, nach Gray, die Aporie des bürgerlichen Menschen der Kafka-Generation dar. [vgl. in Deutschland damals: Weltpolitik am Biertisch...] Wichtig! Der Freund überlebt (gerade noch) den Untergang des "alten" sozio-ökonomischen Systems. Georg geht aber unter [bzw. drauf]
Aus diesem Zusammenhang heraus interpretiert Gray den Text als eine Kritik Kafkas an das sich selbst entfremdete/-ende Subjekt.
7. Der Interpret muss -so wie der Vater diejenige des Sohnes- die Zudeckungsstrategien Kafkas aufdecken. D.i. das, was Kafka im Text "ver-heimlicht." Und das ist, nach Gray,
Die Kritik an den Zeitumständen.
Gerhard Neumann zum "Urteil" ('81)
Neumann sieht 3 Motivkreise von denen aus er den Text eingrenzen kann:
1. Paradoxie:
Kafkas Werk wird Paradoxie zugeschrieben. Am eindrücklichsten von Heinz Politzer ('65).
Die Paradoxie wird verschieden begründet:
a) Aus dem biographischen Umfeld Kafkas
b) Als Folge eines künstlerischen Mangels bei Kafka (Politzer & Binder '76)
Beicken ('76) hat geltend gemacht, weder eine psychologische noch eine mimetisch orientierte Analyse vermöge den Kern von Kafkas Werk aufzudecken.
2. Sprache als Macht:
Produktion von Macht durch Sprache wurde erstmals von Canetti ('69) in seinem Aufsatz: "Der andere Prozess" aufgezeigt. Kafka sei der grösste Experte der Macht. (Familie = Erziehungsinstitution des modernen Menschen.)
3. Literarisches Sprechen im Kontext der Macht:
Aus diesem Zusammenhang zwischen dem sozialpsychologischen und dem sprachlichen Aspekt folgt die Frage: Welche Rolle spielt die Sprache als soziales Machtimstrument?
Nach Neumann war das "Urteil" der wichtigste Text zur Selbstwerdung für Kafka, d.i. "Wie werde ich der ich bin?" Er sieht den Kern des "Urteils" in der Darstellung einer Identitätskrise:
Georgs Brief = dessen autonome Selbstdefinition, wird dem Vater zur Beurteilung unterbreitet in der Hoffnung bestätigt zu werden.
Nach der biologischen folgt eine Reihe von sozialen Geburten. Hilfe dazu sind Rituale. Neumann: "Das Jam-Kippur Fest spielt eine wichtige Rolle für den Text."
Nach Neumann vergegenwärtigt der Text das Scheitern eines Individuums an einer solchen Geburt. D.i. Die Emanzipation (Georgs, des Sohnen) aus der Familienrolle in die Gesellschaftsrolle. [kann man nicht so trennen!!!].
Hierbei gewinnen zwei Argumente topischen Charakter:
a)ödipus-Mythos
b) Parabel vom verlorenen Sohn
Also: Rebellion & Reintegration! Georg =ödipus / Freund = verlorener Sohn.
Georgs Identität wird durch die Gegenüberstellung mit dem Freund, durch den Vater zerstört. (vgl. Vater: "Wärst du fort, dann wärst du ein Sohn nach meinem Herzen.") Problem Georgs: Er muss zugleichödipus und verlorener Sohn sein.
Der Kampf Goergs um/für seine Emanzipation = Rededuell!
Neumann: "Der Text muss auch als sozialhistorisches Dokument gelesen werden." (D.i. Labilität der Identität des bürgerlichen Subjekts in einer Welt der Disziplinierung. Kafkas Werk will also -so Neumann- versuchen, die Zerstörung des Menschen durch soziale Machtsprache als eine Urteils- und Verurteilungssprache zu demonstrieren, die in der Familie entsteht.
Neumanns Schluss: "Das "Urteil" ist eine sozialhistorische Diagnose der Zerstörung des bürgerlichen Subjekts durch seine eigene Gesetzesordnung."
[Nach dieser ganzen syntagmatischen und paradigmatischen Faselei schreibt Neumann: "Es wird deutlich, dass in Kafkas Texten aus der Rede der Figuren keine Wahrheit bezogen werden kann." So what? Wie will er Machtmechanismen herausdröseln, wenn die Sprache der Figuren "unwahr" ist? Wo ist denn der Bezugspunkt?]
Neumanns Exkurs: zu Kafkas Tagebucheintrag vom Aug. 1916 [Also 4 Jahr nach dem "Urteil"!!]
Kafka notierte 12 Punkte [hier zus.gefasst]:
1. Jeder Mensch ist eigentümlich. Aber Familie und Schule verwischen diese E.-tümlichkeit 2-6 Leseverbot als Kind wirkte tief! "Man erkannte meine Eigentümlichkeit nicht an!"
Schmerz = Preis für Sozialisation.
8. "Es ist sicher, dass ich von meinen Eigentümlichkeiten nie jenen wahren Gewinn zog, der sich in dauerndem Selbstvertrauen äussert."
9. "Da ich meine Eigentümlichkeiten unterdrückte, begann ich mich zu hassen." Kafka unterscheidet hier zw. offenen und verborgenen Eigentümlichkeiten.
10. Einsicht: Niemals konnte alles gestanden werden!
11. Niemand kann sich seiner selbst entledigen.
Neumann sieht die Bedeutung dieses Textes darin, dass Kafka hier versucht, den Prozess der menschlichen Selbstfindung als durch ein Ritual geregelt zu beschreiben, und zwar im Bild des Gerichts. D.h. Verbot, Verhör, Tat, Beurteilung, Beweisführung, Geständnis, Reue, Strafe.
Neumanns Einbettung des "Urteil" in Kafkas Gesamtwerk ('83)
"Urteil", "Verwandlung" und "Bericht für..." haben 2 Dinge gemeinsam:
1. Alle drei Texte sind Selbstwerdungsphantasien
2. Bei allen 3 kommts zu Beschädigungen des um Verwirklichung suchenden Subjekts.
Bei Rotpeter am mildesten! Er such auch nicht Freiheit, sondern bloss einen Ausweg. Seine Eigentümlichkeit ist seine Chance! (Er hat keine Seinesgleichen!)
Neumann: "Im Bericht" wird eine Gegenmöglichkeit zur regressiven Verwandlung Gregors und dessesn Selbstzerstörung erprobt. [Geburt aus sich selbst!]
Nach Neumann ist die "Strafkolonie" = Gegenmodell zum "Urteil"
Da es bei Kafka immer um den Versuch das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen In einem Prozess zu thematisieren ergibt sich folgendes Bild:
Im Urteil artikuliert sich dieses Verhältnis als die biologische Dichotomie von Sohn & Vater, also interfamiliär.
Im Bericht als ein Gegenüber von Mensch & Tier
In der Strafkolonie als Konflikt zwischen Mensch & Maschine. (Also Staatlich)
Naumann: "In Kafkas gesamtem Werk geht es um das Ringen um die Frage nach der Möglichkeit menschlicher Selbstbehauptung und ihrer Artikulation."
Das Neue am "Urteil" = Die Einsicht in die Tatsache, dass der Einzelne einerseits getragen wird vom Wunsch nach Selbstverwirklichung, zum anderen aber durch die Rede der Anderen eingeschränkt wird. (Der Mensch wird in eine sprachlich vorgeprägte Welt geboren.
Binder zum "Urteil ('75)
Kafka erlebte in "dieser" Nacht, das Getragenwerden von der Inspiration. Er las den Text sogleich verschiedenen Personen vor [Wie Georg, der beim Vater Bestätigung suchte?!] Beim Korrekturvorgang vom Februar 1913 sind ihm verschiedene Veziehungen klar geworden, vgl. Tagebuch)
a) Der Freund = Abstraktion, in der die verschiedenen Aspekte der Vater-Sohn Beziehung zusammengefasst sind. Freund also ¹ Figur, sondern Beziehungsfunktion. Bei der Beleuchtung des Freundes steigt die Vater-Sohn Beziehung auf. Er ist ihre grösste Gemeinsamkeit.
b) Die Braut lebt nur durch die Beziehung zum Freund, kann also leicht vertrieben werden!
c) Vater-Sohn Problematik: Kafka wollte 'mal "Urteil", "Heizer" und "Samsa" in einem Sammelband mit Titel Söhne herausgeben.
Vgl. Verwandlung - Urteil:
1. In beiden Texten: Vater = selbstständiger Geschäftsmann, d.f. berufl. Schwächung des Sohnes.
2. Im "Urteil" ists der Tod der Mutter, der den Vater schwächt Im "Samsa" ists der geschäftl. Zusammenbruch, finanzielles Unglück. In beiden Fällen folgt daraus: Aufstieg des Sohnes. [Rollentausch Vater-Sohn]
3. In beidenTexten erfolgt ein Wendepunkt, eine erneute Umkehrung der Machtverhältnisse [weil die Söhne jeweils zu schwach sind, um in der neuenerwünschten Rolle zu bestehen!]
d) "Gedanken an Freud natürlich..." Nach Binder verbindet Kafka die Erzählung eindeutuig mit Freud, D.h.ödipus...(Erst nach dem Tod der Mutter = geschäftl. Erfolg, Braut = Schändung des Andenkens...)
Nach Binder folgt Kafka nicht expressionistischen Vorbildern! Sondern:
1. Grillparzers autobiographische Erzählung "Der arme Spielmann": Dem innerlich
schwachen Sohn gelingt es nicht, sich gegen seinen Übermächtigen Vater durchzusetzen, er stirbt elend.
2. Einzelheiten des Epilogs von "Schuld & Sühne" seien ins "Urteil" eingeflossen:
Raskolnikov in Sibirien schämt sich, dass er sich vor der Sinnlosigkeit eines Urteils beugen muss um zur Ruhe zu kommen.
vgl. auch Raskolnikovs Freunde in P.'burg, Briefe an sie = trocken u. unbefriedigend Raskoln. schaut ebf. an einem warmen Frühlingstag voller Schwermut auf einen Fluss und bemerkt, dass er vor einem neuen gesellschaftlichen Leben steht. Kafka habe aber mehr Motive und Stimmung übernommen als Figurenkonstellationen.
3. Nach Binder hat eine Prager Lokalsage "Die goldene Gasse" die Konzeption des "Urteils" mitbestimmt.: Vater klagt Tochter der Buhlschaft an, den Geliebten der Verführung. Hanina rennt aus der Stube und wirft sich in die brausende Donau, während ihr Vater fast leblos auf dem Boden liegt. [Parallelle zum "Urteil" ist frappant!!!]
Kafkas Verhältnis zu seinem Vater war bestimmt durch Abhängigkeit & Hass. 1911 brach ein offener Familienkonflikt aus. Gründe nach Binder: Kafka entdeckte die jüdische Welt durch jüd. Schauspieltruppen im Herbst 1911 in Prag. Er, Kafka, habe seine Einstellung geändert: vom "Assimilierten" zum "Gesellschaftskritischen" Denken.
4. Einfluss dieser jüdischen Stücke auf das "Urteil". Zbsp. Formale Besonderheiten:
1. Schroffheit der Teilszenen untereinander
2. Knappheit in der Darstellung der Figuren, nur das Nötige wird erwähnt.
3. Georgs Selbstgespräche entsprechen dem A-Parte-Sprechen das damals noch -im gegensatz zur dt. Bühnenpraxis- im Jiddischen Theater noch dehr gebräuchlich war. Mögliche Vorbilder: Abraham Scharkanskys "Kol Nidre": Vater verurteilt Tochter zum Tod, sie begeht Selbstmord.
Forschungsmeinungen zu "das Urteil" v. Kafka - Häufig gestellte Fragen
Autobiographische Aspekte im Zusammenhang mit "das Urteil"?
Die Forschung hat autobiographische Bezüge im Leben Kafkas zu "das Urteil" identifiziert. Dazu gehören: Kafkas literarischer Durchbruch im Herbst 1912, seine Mitbegründung einer Asbestfabrik Ende 1911, seine Beziehung zu Felice Bauer ab August 1912, der Zeitpunkt der Niederschrift des "Urteils" in der Nacht vom 22./23. September, der Geburtstag seines Vaters am 14. September, die sich abzeichnende Verlobung von Brods mit Kafkas Schwester Valli am 15. September, das Jom-Kippur-Fest am 20./21. September und der Besuch seines Onkels Alfred Löwy im September. Auch die "Verwandlung" wurde kurz danach geschrieben (17.11-7.12.1912).
Was sagte Kafka selbst zum "Urteil"?
Kafka selbst äusserte sich zum "Urteil" und seinen Figuren. Er sah im "Freund" eine Abstraktion, die die Vater-Sohn-Beziehung repräsentiert. Die Braut existiert nur durch die Beziehung zum Freund. Kafka assoziierte den Schlusssatz des Urteils mit einer starken Ejakulation und dachte beim Schreiben an Freud. Er leugnete anfangs den Zusammenhang zwischen dem Text und seinem Leben vor Felice Bauer, änderte aber später seine Meinung und sagte, er könne keinen Sinn darin finden. Er beschrieb den Text als eine Geburt mit Schleim und Schmutz und sah das "Urteil" später als die Abwehr eines Gespenstes.
Welche Interpretationsansätze gibt es laut Gray?
Gray interpretiert das "Urteil" als eine Konkretisierung der Krise des bürgerlichen Selbstbewusstseins vor dem Ersten Weltkrieg. Er analysiert den Text im Zusammenhang mit Freuds Aufsatz "Das Unheimliche" und zeigt, wie das Spiel mit dem "Heimlichen" und "Unheimlichen" zur Wirkung des Textes beiträgt. Der Vater verurteilt das unzeitgemäße Nachahmen seines Sohnes. Gray sieht das Urteil als Beschreibung zweier Alternativen für das heranwachsende Bürgertum und als Kritik am sich selbst entfremdeten Subjekt. Der Interpret müsse die Zudeckungsstrategien Kafkas aufdecken.
Wie deutet Gerhard Neumann das "Urteil"?
Neumann sieht das "Urteil" im Kontext von Paradoxie, Sprache als Macht und literarischem Sprechen im Kontext der Macht. Er betont, dass das "Urteil" für Kafka ein wichtiger Text zur Selbstwerdung war und den Kern des "Urteils" in der Darstellung einer Identitätskrise sieht. Er vergleicht Georg mitödipus und den Freund mit dem verlorenen Sohn. Der Text sei auch als sozialhistorisches Dokument zu lesen. Neumann interpretiert Kafkas Tagebucheinträge von 1916 im Zusammenhang mit dem "Urteil" und sieht darin den Prozess der menschlichen Selbstfindung als ein durch ein Ritual geregeltes Verfahren. Er betrachtet die Beziehung zwischen Einzelnem und Allgemeinem als die Dichotomie von Sohn und Vater. In Kafkas gesamtem Werk gehe es um das Ringen um die Frage nach der Möglichkeit menschlicher Selbstbehauptung und ihrer Artikulation.
Welche Verbindungen sieht Binder zum "Urteil"?
Binder sieht im "Freund" eine Abstraktion der Vater-Sohn-Beziehung. Er vergleicht die Verwandlung mit dem Urteil. Kafka verbindet die Erzählung eindeutig mit Freud. Kafka folgte nicht expressionistischen Vorbildern, sondern Grillparzers "Der arme Spielmann" und Elementen aus "Schuld und Sühne" von Dostojewski. Binder sieht zudem einen Einfluss der Prager Lokalsage "Die goldene Gasse". Die jüdischen Stücke hatten auch einen Einfluss, z.B. durch die Schroffheit der Teilszenen und Georgs Selbstgespräche.
- Quote paper
- Tiz Heinrich (Author), 1999, Forschungsmeinungen zu "das Urteil" v. Kafka, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97442