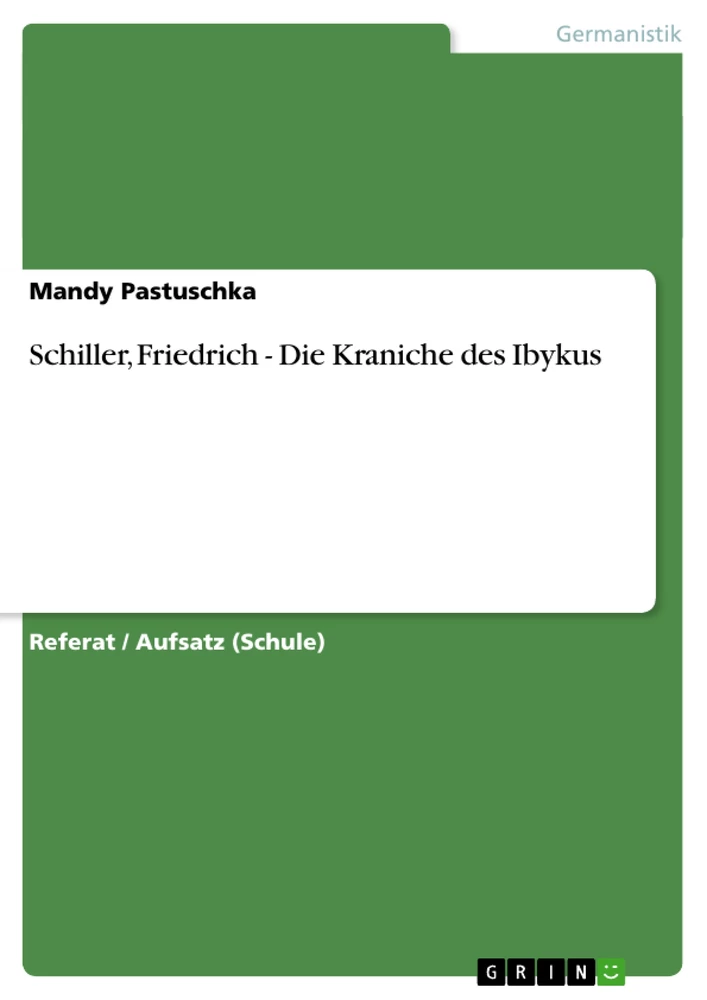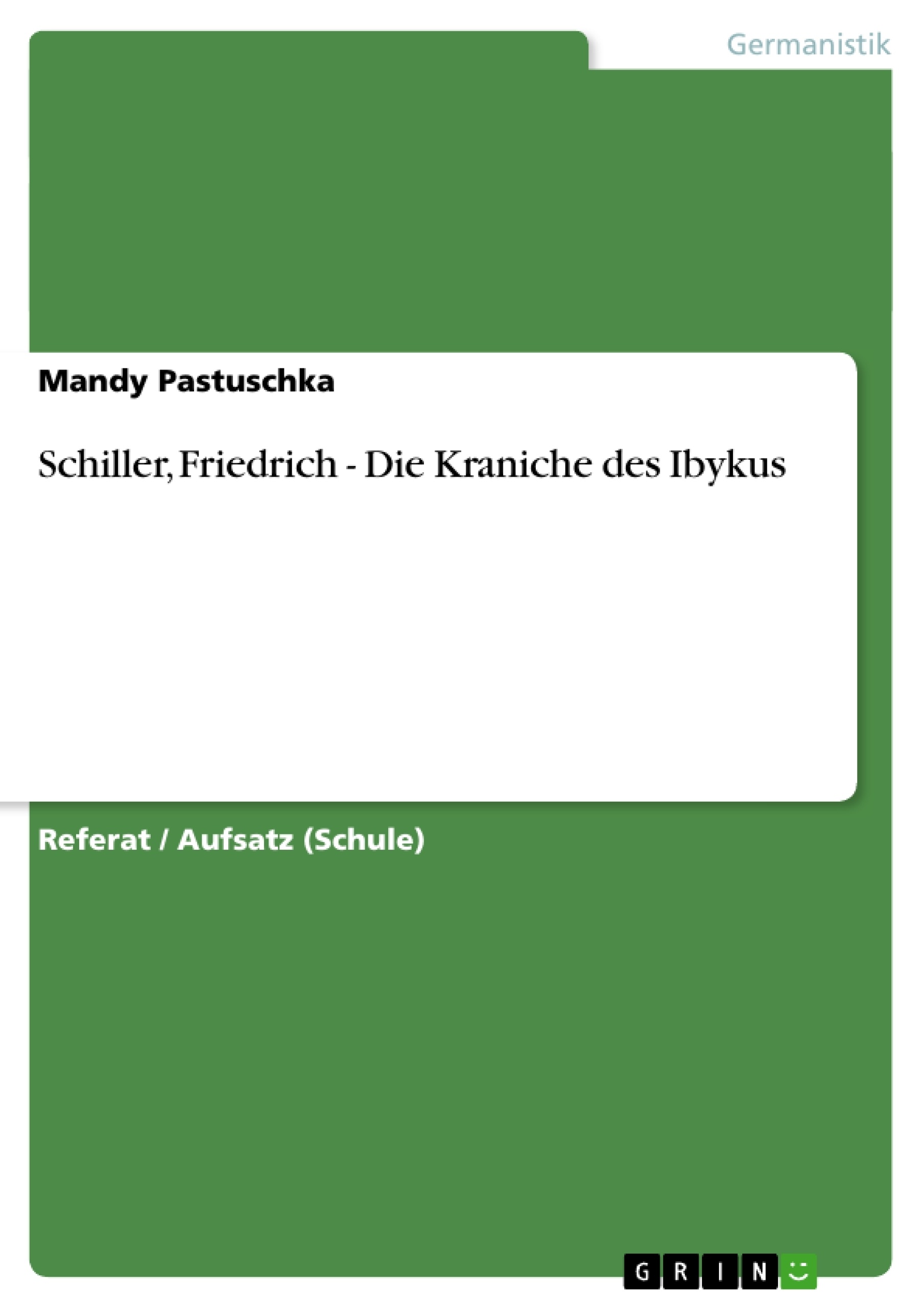Ein Schrei zerreißt die Stille des antiken Griechenlands: Der gefeierte Dichter Ibykus, auf dem Weg zu den berühmten Isthmischen Spielen, wird Opfer eines heimtückischen Mordanschlags. Hilflos und dem Tode nahe, ruft er die über ihm kreisenden Kraniche als Zeugen seiner schrecklichen Tat an – ein Fluch, der die Mörder unerbittlich verfolgen soll. Friedrich Schillers meisterhafte Ballade "Die Kraniche des Ibykus", entstanden im klassischen Balladenjahr 1797, entführt den Leser in eine Welt, in der Götter und Schicksal das Leben der Menschen bestimmen. Die Geschichte von Ibykus ist eine packende Erzählung über Schuld, Sühne und die unentrinnbare Gerechtigkeit, die selbst die gerissensten Verbrecher nicht entkommen lässt. Während das Volk über den Verlust des Dichters trauert und nach den Tätern sucht, braut sich im Verborgenen ein göttlicher Racheplan zusammen. Die Eumeniden, furchterregende Rachegöttinnen, greifen in das Geschehen ein und spinnen ein Netz aus Angst und Schrecken. Auf dem Höhepunkt der Spiele, inmitten der feiernden Menge, offenbaren sich die Mörder auf dramatische Weise selbst. Ein unbedachter Ausruf, eine zufällige Bemerkung über die Kraniche des Ibykus, wird zu ihrem Verhängnis. Schiller verwebt in dieser Ballade gekonnt antike Motive, tiefgründige Moralvorstellungen und eine spannungsgeladene Handlung zu einem zeitlosen Meisterwerk. Die kunstvolle Sprache, die eindringlichen Bilder und die psychologische Tiefe der Charaktere machen "Die Kraniche des Ibykus" zu einem unvergesslichen Leseerlebnis. Tauchen Sie ein in diese faszinierende Welt und erleben Sie, wie die Kraniche des Ibykus die Wahrheit ans Licht bringen und die Schuldigen ihrer gerechten Strafe zuführen. Diese Ballade ist mehr als nur eine Geschichte; sie ist eine Reflexion über die menschliche Natur, die Macht des Schicksals und die alles durchdringende Gerechtigkeit. Entdecken Sie die Schönheit und die Tragik dieser klassischen Dichtung und lassen Sie sich von Schillers Sprachgewalt in ihren Bann ziehen. "Die Kraniche des Ibykus" ist ein Muss für alle Liebhaber der klassischen Literatur und ein spannendes Leseerlebnis für jeden, der sich von einer packenden Geschichte fesseln lassen möchte. Erleben Sie das Drama, die Spannung und die moralische Tiefe dieser zeitlosen Ballade und verstehen Sie, warum sie bis heute nichts von ihrer Faszination verloren hat.
,,Die Kraniche des Ibykus"
,,Die Kraniche des Ibykus" ist eine von Friedrich Schiller geschriebene Ballade aus dem Jahre 1797. Diese Ballade ist ein Resultat aus dem Bündnis Goethe - Schiller ( 1794· Balladenjahr ). Beide hatten ein gemeinsames Interesse für Antike und Renaissance.
Auch ,,Die Kraniche des Ibykus" spielen in der Antike, nämlich im alten Griechenland.
In der Ballade geht es um einen damals anerkannten Schriftsteller, welcher auf dem Weg zu den aller zwei Jahren stattfindenden ismenischen Spielen ermordet wird. Die Mörder entkommen unerkannt, das Volk ist sauer und entrüstet. Bei den Spielen fliegen Kraniche über das Volk, auch bei dem Mord waren diese dabei. Die Mörder entlarven sich im Enddefekt selbst, indem sie ,,Die Kraniche des Ibykus" ausrufen. Sie werden verurteilt. ,,Die Kraniche des Ibykus" ist, wie schon erwähnt, eine Ballade. Es ist ein Gedicht, indem ein handlungsreiches, tragischendendes Geschehen, erzählt wird. Die Ballade ist aus 23 Strophen zu je acht Versen aufgebaut. Auffällig an dieser Ballade ist der Mischreim. Es ist wie ein regelmäßiger Mischreim, d.h. die ersten vier Verse der Strophen sind jeweils Paarreime, z.B. Strophe 1: ,,... Gesänge - ...Landesenge" und ,,...vereint- ...Götterfreund", die letzten vier Verse sind Kreuzreime, wie z. B. (wieder Strophe 1): ,,...Gabe - ...Apoll - ...Stabe - ...voll". Dieses Muster begleitet uns die ganze Ballade über.
Auffällig ist auch die Monologfolge. Die Ballade ist im Ganzen ein Erzählmonolog vom lyrischen ,,Ich", hat aber mittendrin öfters einmal Monologe/Reden von anderen ,,Figuren". Das lyrische ,,Ich" übernimmt hier also nicht die Hauptrolle, sondern die Funktion des Erzählers.
Für mich hat der Titel ,,Die Kraniche des Ibykus" keine großen Erwartungen, geschweige den Vorstellungen hervorgerufen. Erst währen des Lesens ist mir der genaue Sinn und der Zusammenhang klar geworden.
Der Aufbau der Ballade ist der typische Balladenaufbau: Einleitung, steigende Handlung, Hauptteil und Balladenurteil 8bzw. Lehre/Moral).
Die Einleitung beginnt mit der ersten Strophe und geht bis zur dritten. In diesen wird der Grund, warum Ibykus sich auf die Reise macht (·Spiele) genannt. Außerdem wo er langkommt und was er erlebt. Ibykus macht sich aus Korinth auf den Weg. Er ist ein Götterfreund, mit vielen Gaben beschenkt.
Während die ersten beiden Strophen die Einleitungserzählung ist, ist die dritte Strophe ein Monolog. Ab der vierten Strophe beginnt dann die steigende Handlung. Ibykus, gerade auf dem Weg durch den Wald, wird nach einem schweren Kampf mit zwei Mördern schwer verletzt. Er fleht noch in der Strophe nach Rettern, doch sein Rufen bleibt unerhört. In der sechsten Strophe ruft er, kurz vor seinem endgültigen Ableben, noch einen, für den Handlungsverlauf wichtigen Satz aus: ,,Von euch, ihr Kraniche dort oben, Wenn keine andre Stimme spricht, sei meines Mordes Klag erhoben!".
In den Strophen sieben bis zwölf geht es um die Reaktionen des Volkes auf Ibykus Tod. Das Volk ist wütend, traurig, sauer und entrüstet. Sie fordern die Verurteilung der Mörder, doch leider sind diese noch nicht gefaßt.
Mit dem Auftritt der griechischen Rachegöttinnen (Eumeniden), ab der Strophe dreizehn, beginnt der Hauptteil der Ballade. In den Strophen dreizehn bis fünfzehn wird das scheußliche Aussehen dieser Wesen beschrieben (,,schwingen in entfleischten Händen"; ,,in ihren Wangen fließt kein Blut"; ...).
In den Strophen sechzehn und siebzehn führen die Rachegöttinnen einen Monolog, indem sie die Auswirkungen für Schuldige und Unschuldige auslegt.
Die Strophe achtzehn beschreibt dann den Abgang der mysteriösen Wesen. In den folgenden Strophen können die Menschen nicht glauben was sie sahen - war es Einbildung oder Wirklichkeit.
Mit ,,Sieh da, sieh da, Timotheus, Die Kraniche des Ibykus!" verrät sich einer der Täter selbst, und damit auch seinen Mittäter (Strophe 20). Der Himmel färbt sich schwarz und der Zug der Kraniche wird für alle sichtbar.
Die beiden vorletzten Strophen zeigen die Reaktion auf diesen Ausruf. Erst Unklarheit und Unverständnis, doch dann werden die Stimmen im Volk immer lauter. Man fordert die Ergreifung der entlarvten Täter.
Die 23. Und damit letzte Strophe scheint theoretisch das Balladenurteil zu sein. Die Täter sind gefaßt, es wird genannt, was mit ihnen passiert - sie bekommen die Rache zu spüren. Doch bei der Ballade ,,Die Kraniche des Ibykus" kann man auch behaupten, die ganze Ballade ist wie eine Lehre. Es ist etwas Verboten und wird früher oder später bestraft. Friedrich Schiller verwendete in dieser Ballade sehr viele Adjektive (,,frommer Schauder"·2, 4; ,,graulichtem Geschwader"·2, 8). In den ersten Strophen verwendete er weniger Adjektive. Sie häufen sich erst so richtig mit dem Auftritt der Rachegöttinnen (,,streng und ernst"; ,,ird'schen Weiber"; ,,sterblich Haus"; ...).
Damit wird die Bedeutung von Götter in der Antike in den Vordergrund gerückt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in ,,Die Kraniche des Ibykus"?
,,Die Kraniche des Ibykus" ist eine Ballade von Friedrich Schiller aus dem Jahr 1797, die im antiken Griechenland spielt. Sie handelt von dem Schriftsteller Ibykus, der auf dem Weg zu den ismenischen Spielen ermordet wird. Die Mörder entkommen zunächst unerkannt, werden aber später durch ihren Ausruf ,,Die Kraniche des Ibykus!" während der Spiele entlarvt und verurteilt.
Wie ist die Ballade aufgebaut?
Die Ballade besteht aus 23 Strophen mit jeweils acht Versen und verwendet einen Mischreim (Paarreime in den ersten vier Versen, Kreuzreime in den letzten vier Versen jeder Strophe). Sie folgt dem typischen Balladenaufbau: Einleitung, steigende Handlung, Hauptteil und Balladenurteil.
Was ist das Besondere an der Erzählweise?
Die Ballade wird hauptsächlich von einem lyrischen "Ich" als Erzähler vorgetragen, enthält aber auch Monologe/Reden anderer Figuren. Der Erzähler übernimmt also nicht die Hauptrolle, sondern die Funktion des Berichterstatters.
Welche Rolle spielen die Kraniche in der Ballade?
Die Kraniche sind Zeugen des Mordes an Ibykus. Als Ibykus stirbt, bittet er sie, seinen Mord zu rächen. Später, während der ismenischen Spiele, verraten sich die Mörder durch ihren Ausruf über die Kraniche, was zu ihrer Entdeckung und Verurteilung führt.
Was ist das Balladenurteil bzw. die Lehre der Ballade?
Die Ballade vermittelt eine Moralerzählung, in der Unrecht früher oder später bestraft wird. Die Rede der Rachegöttinnen (Eumeniden) dient als Balladenurteil, das die Konsequenzen von großen Verbrechen verdeutlicht. Die Moral ist nicht explizit am Ende der Ballade formuliert, sondern von Anfang an implizit vorhanden.
Welche sprachlichen Mittel werden in der Ballade verwendet?
Friedrich Schiller verwendet in der Ballade viele Adjektive, besonders im Zusammenhang mit der Beschreibung der Rachegöttinnen, um die Bedeutung der Götter in der Antike hervorzuheben und die Atmosphäre zu intensivieren.
- Quote paper
- Mandy Pastuschka (Author), 2000, Schiller, Friedrich - Die Kraniche des Ibykus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97404