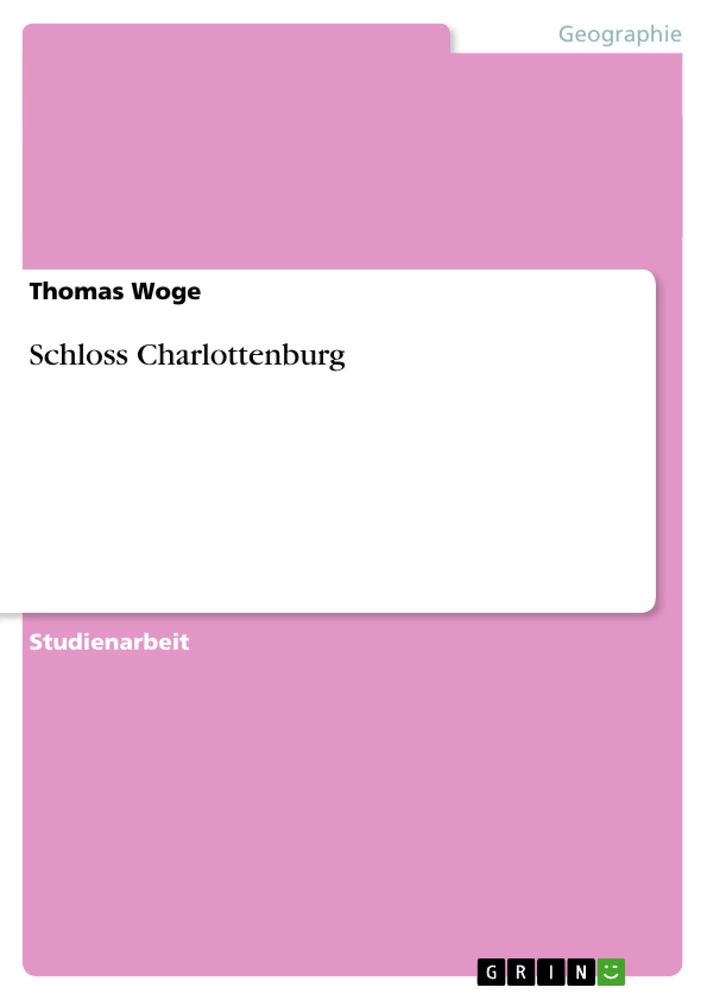Stellen Sie sich vor, Sie wandern durch die Hallen eines Schlosses, in denen jeder Stein, jede Tapete und jedes Kunstwerk eine Geschichte flüstert – eine Geschichte von königlicher Pracht, philosophischen Salons und den Narben des Krieges. Dieses Buch entführt Sie auf eine faszinierende Reise durch die über dreihundertjährige Geschichte von Schloss Charlottenburg, von seinen bescheidenen Anfängen als Sommerresidenz für Sophie Charlotte, der philosophischen Königin, bis zu seiner heutigen Bedeutung als eines der bedeutendsten Wahrzeichen Berlins. Erleben Sie den Glanz des preußischen Hofes unter Friedrich I., die Sparsamkeit Friedrich Wilhelm I. und die kulturelle Blütezeit unter Friedrich dem Großen, dessen Vorliebe für Musik und Theater dem Schloss neues Leben einhauchte. Folgen Sie den Spuren berühmter Architekten wie Nering, Eosander und Schinkel, deren visionäre Entwürfe das Schloss im Laufe der Jahrhunderte prägten. Entdecken Sie die Geheimnisse des Schlossparks, der von Lenné in einen idyllischen Landschaftsgarten verwandelt wurde, und erfahren Sie, wie das Schloss die städtebauliche Entwicklung Berlins und Charlottenburgs maßgeblich beeinflusste. Tauchen Sie ein in die dramatischen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, die das Schloss in Schutt und Asche legten, und begleiten Sie den mühsamen Wiederaufbau, der Charlottenburg zu seiner heutigen Pracht verhalf. Dieses Buch ist eine Hommage an ein architektonisches Juwel, ein Spiegelbild der preußischen Geschichte und ein lebendiges Zeugnis der Berliner Kultur. Es beleuchtet die architektonischen Veränderungen, die politischen Einflüsse und die persönlichen Schicksale, die das Schloss geprägt haben, und bietet einen eindrucksvollen Einblick in das Leben am Hofe, die Kunstförderung und die gesellschaftlichen Umwälzungen der vergangenen Jahrhunderte. Erkunden Sie die goldenen Galerien, die königlichen Gemächer und die versteckten Winkel dieses ehrwürdigen Schlosses und lassen Sie sich von seiner Schönheit und seinem historischen Wert verzaubern. Das Buch behandelt die Schlossbau zur Zeit von Sophie Charlotte und Friedrich I., die Erweiterungen unter Friedrich I., das Schloss unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen, die Zeit Schinkels, den Einfluss des zweiten Weltkrieges auf das Schloss und die Zeit direkt nach dem Krieg.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der Schloßbau zur Zeit von Sophie Charlotte und Friedrich I.
Die Lage
Die ersten Bauten
Erweiterungen
Das Schloß zur Zeit von Friedrich Wilhelm I.
Die Zeit Schinkels
Im Schloßgarten
Das Schloß unter Friedrich Wilhelm II.
Schloß Charlottenburg zu Beginn des 20. Jh.
Besitzfragen des Schlosses nach Ende der Monarchie
Einfluß des zweiten Weltkrieges auf das Schloß Die Zeit direkt nach dem Krieg
Schloß Charlottenburg heute
Literaturverzeichnis
Einleitung
Betrachtet man heute das Schloß Charlottenburg, so erscheint es einem als zwar ausgedehntes, aber doch zierliches Baugebilde. Dieser Eindruck entsteht durch die unmittelbar anknüpfende Bebauung von Wohn- und Geschäftshäusern, die in ihrer Höhe und Umfang das Schloß in den Hintergrund rücken lassen. Schornsteine und der Turm des Rathauses wachsen höher in den Himmel und sogar der Kuppelturm des Schlosses, der einst die Umgebung beherrschen sollte wirkt eingesunken. Weiterhin wird der heutige Eindruck vom stark ausgeprägten Autoverkehr geprägt, der sich unerläßlich am Schloß vorbeischlangelt und es ,,liegen" läßt.
Das diese Zustände nicht immer so waren, erscheint jedem logisch. Doch wie kam es zur Entwicklung vom Dorf und Gut Lützow, dem Standort des Schlosses, zu dem heutigen Charlottenburg, und vielmehr welche Rolle spielte das Gebäude in dieser Entwicklung? Diese Hausarbeit soll die Veränderungen und den Bedeutungswandel des Schlosses Charlottenburg, in seiner nun über dreihundertjährigen Geschichte aufzeigen.
Der Schloßbau zur Zeit von Sophie Charlotte und Friedrich I.
Die Lage
Das Schloß Charlottenburg, ursprünglich Landhaus Lietzenburg, benannt nach dem benachbarten Dorf und Gut Lützow, blickt als bevorzugter Aufenthaltsort vieler preußischer Herrscher auf eine lange wechselvolle Geschichte zurück. Die Anlage entstand unter dem prunkliebenden Kurfürsten Friedrich III., der sich 1701 in Königsberg zum König krönen ließ. Es war die Sommerresidenz seiner zweiten Frau Sophie Charlotte, der ,,philosophischen Königin", die der künstlerischen Prachtentfaltung des Berliner Hofes ein geistiges Leben von hoher Bedeutung an die Seite stellte. Zuerst sollte das bei Potsdam gelegene Gut Caputh der Sommersitz der Kurfürstin werden. Da jener Ort aber sehr abgelegen war, gab sie das Besitztum zurück und erhielt das Dorf und Gut Lützow jenseits des Tiergartens.
Lützow
Die Wahl des Bauplatzes war das Ergebnis sorgfältiger Überlegungen und man entschied sich für eine gleich hinter dem Ort gelegene Stelle, die mit einem an zwei Seiten von der Spree gerahmten Gelände geradezu einlud, dort ein fürstliches Schloß mit Garten zu errichten. Die weite Sicht und der breite Flußlauf erinnerte zugleich an die heimatliche Besitzung Herrenhausen, wo zur gleichen Zeit die Kurfürstin Sophie von Hannover, die Mutter von Sophie Charlotte, den in der Nähe der Leine befindlichen Schloßgarten umgestalten und vergrößern ließ. Abgesehen davon, daß die Spree, die kurz vor ihrer Mündung in die Havel hier eine Breite hat, die den Garten mit genügend Wasser speisen konnte, boten sich der Baugesinnung des Barock, die nach geordneter Weiträumigkeit strebte, auch in städtebaulicher Hinsicht große Vorteile. So konnte die Grundlinie ,,Via Triumphalis der Linden", geradewegs durch den Tiergarten weitergeführt, auch die Basis für das neue Schloß sein, indem dieses durch die nord-südlich verlaufende Schloßstraße achsengerecht mit ihr verbunden wurde. Damit waren jene beiden neuen Berliner Städte (Dorotheenstadt und Friedrichstadt) und Lietzenburg in einem gemeinsamen Achsensystem zusammengefaßt und einander zugeordnet. Die Schloßstraße bildete als Mittellinie des Schlosses zugleich die Hauptachse des Gartens und setze sich jenseits der Spree als Schneise durch die Jungfernheide fort. Diese Schneise richtete sich auf das 1693 erworbene Schloß Tegel und wies darüber hinaus auf eine vom Schloß Oranienburg ausgehende, geradewegs nach Süden führende Allee.
Die ersten Bauten
Mit der Räumung des mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Baugeländes wurde im Herbst 1694 begonnen und es entstand zunächst eine Sommervilla ohne Wirtschafts- und Kavalierflügel. Dieser Ursprungsbau hebt sich als überragender Mittelbau aus der heutigen Anlage deutlich heraus. Der ursprüngliche Farbton ist ein in den Tiefen noch heute erkennbares warmes Ockergelb, von dem sich die architektonischen Teile deutlich abheben. Dieses erste Schloß, ein Bau von etwas nüchterm-strengem Aussehen, aber ausgezeichnet durch eine gute rhythmische Gliederung, war von dem Oberbaudirektor Arnold Nering entworfen und im Jahre 1695 begonnen worden.
Nering hat die begrifflich unentwickelte Baukunst Brandenburgs mit der Gesetzmäßigkeit und der Formensprache der italienischen Renaissance bekannt gemacht und ihr damit die Grundlagen für die Entfaltung des Barock vermittelt. Als dieser wenige Monate nach dem Baubeginn am 21. Oktober 1665 verstarb, wurde die Weiterführung dem tüchtigen, aber künstlerisch wenig bedeutenden Martin Grünberg übertragen, der vor allem durch Kirchenbauten bekannt geworden war. Grünberg legte nach Kritik an seiner nüchternen Art die Bauleitung im März 1699 nieder. Wenige Monate später, am 1. Juli 1699, dem Geburtstag des Kurfürsten, fand die feierliche Einweihung Lützenburgs statt.
Lützenburg
Erweiterungen
Seit der Grundsteinlegung 1695 und rasch nach der Einweihung ist die Bedeutung des Schlosses über eine vorstädtische Villa hinausgewachsen. Da aber die Räumlichkeiten für einen längeren Aufenthalt, der eine größere Hofhaltung beinhaltete, nicht ausreichend waren, wurde schnell über die Errichtung von Wirtschafts- und Kavaliersflügeln gedacht, die jedoch wegen schlechter Finanzverhältnisse nicht sofort verwirklicht werden konnten. Erst durch den Sturz des hervorragenden Minister Danckelmann 1698, dessen straffe Finanzwirtschaft den Unternehmungen des baueifrigen Kurfürsten entgegenstand, war der Weg zu einer reicheren künstlerischen Entfaltung frei. Im Jahre 1700 machte der Schwede Johann Friedrich Eosander eine Studienreise nach Iraris. Zu dieser Zeit war in Berlin der ehrgeizige Plan des Kurfürsten, seinem Haus die Königskrone zu erwerben, ein Stück voran getrieben. Am 18. Januar 1701 fand in der von Eosander ausgeschmückten Schloßkirche in Königsberg die kirchliche Weihe für die selbstherrliche Krönung statt. Am 6. Mai hielt König Friedrich I. seinen glänzenden Einzug in Berlin. Die Rangerhöhung, der auch der Zuschnitt der Hofhaltung angepaßt werden sollte, hat sich offenbar auf die Baupläne Sophie Charlottes positiv ausgewirkt. Der Erweiterungsbau wurde 1702 durch Eosander, der im gleichen Jahr zum Baudirektor ernannt worden war, begonnen. Seine Lösung, die er für die Erweiterung fand zeigt, daß er in Paris und vor allem in Versailles entscheidende Anregungen gefunden hat. Der strenge blockhafte Bau Nerings wurde in eine lange Hügelanlage umgewandelt. An der Eingangsseite verband man Seitenflügel, die schon vorher getrennt vom Hauptbau begonnen waren, so mit diesem, daß ein großer geschlossener Ehrenhof entstand. An der Gartenseite wurde der Bau in gleichmäßiger Höhe um das Dreifache verlängert, um eine Fassade zu gewinnen, die sich vom Park aus als Schauwand darbot. Eosander gebührt mit dieser Schöpfung der Verdienst, Norddeutschland mit dem französischen Flügelbau bekannt gemacht zu haben.
Am 1. Februar 1705 verstarb plötzlich Königin Sophie Charlotte, als die Arbeiten an Lützenburg noch im vollen Gang waren. Friedrich I., der den Namen Lützenburg zur Erinnerung an sie in Charlottenburg umbenannte, nahm die Weiterführung des Baus sogleich auf und schmiedete zeitgleich an Plänen für das Berliner Stadtschloß, Oranienburg, Schönhausen und das Stadtschloß in Potsdam. Charlottenburg rückte aber neben dem Berliner Stadtschloß mehr und mehr in den Vordergrund, und neue Ideen gewannen hier an Gestalt, obwohl die Hofkammer über die Unsummen, die die Planungen des Königs verschlungen, nur stöhnte und kaum aufzubringen wußte.
Von den neu beplanten Anlagen wurden zwischen 1708 und 1712 der Turm und die westliche Orangerie ausgeführt. Der östliche Gartenflügel und der vorgesehene Abschluß des Vorhofes durch Pavillons waren beim Tode Friedrich I. am 25. Februar 1713 noch nicht begonnen. Der innere Ehrenhof wurde mit Klinkern gepflastert und durch ein schmiedeeisernes Gitter abgeschlossen, das die vergoldeten Sterne aus dem Emblem des schwarzen Adlerordens zieren, den der König anläßlich seiner Krönung gestiftet hatte.
Aus einem Brief der Schwiegermutter an den König kurz vor seinem Tod wird ersichtlich, daß man hoffte, er würde wieder zu neuen Kräften kommen, wenn er sich weiterhin in der schönen Umgebung seines Lieblingsschlosses aufhalten würde. Sie schrieb noch am 28. Januar 17131:
"Das E.M sich so wol befinden, aber etwas schwag auf die behne sein, welges ich aber hoffe, den Frülin (Frühling) zu charlottenburg besser wirdt werden, wan E.M. in den schönen Garten sich excersieren werden. Mit gehen erhalte ich mich gesundt."2
Als Friedrich I. starb und sein Nachfolger die Fortführung aller Schloßbauten, mit Ausnahme des Berliner Stadtschlosses, durch ein unerbittliches Veto untersagte, war Charlottenburg schon mehr als das prunkvolle Schloß eines verschwenderischen Monarchen, denn direkt vor den Toren des Schlosses ist mit der zunehmenden Bedeutung der Residenz ein größeres Gemeinwesen entstanden, dem der König 1705 die Stadtrechte zuerkannte. Schon zu Zeiten Sophie Charlottes hatten sich an der Schloßstraße und in den östlichen Straßenzügen Hofbeamte, Kaufleute und Handwerker angesiedelt. Die Richtung der Berliner Straße nahm jenseits des Schloßgartens eine nach Spandau weisende Allee auf und im Nordwesten wurde die eingangs erwähnte Allee nach Schloß Schönhausen bis zum Zielpunkt durchgeführt, die streckenweise noch heute in der Seestraße erhalten ist. Dem Wunsch der Charlottenburger Bürger, daß die große Heerstraße, die durch die Jungfernheide nach Spandau führt, über Charlottenburg gelegt werde, verdankt die Nahe dem Schloß errichtete Spreebrücke ihre Erbauung.
So wurde vom Schloß ausgehend, die Umgebung durch Wegeverbindungen erschlossen, die für die städtbauliche Entwicklung Berlins und Charlottenburgs von hoher Bedeutung gewesen sind.
Das Schloß zur Zeit von Friedrich Wilhelm I.
Der neue König haßte allen Prunk. In großer Schlichtheit lebte er wie ein Bürger seines Staates. Sein Vater hatte ihm zwar die Pflicht auferlegt, daß Schloß zur ,,völligen Perfektion" zu führen, aber diesem Wunsch wollte Friedrich Wilhelm I. nicht nachkommen. Es war nicht nur die Abneigung gegen den Lebens- und Regierungsstil des Vaters, es waren auch die Forderungen eines gänzlich herabgewirtschafteten Staatshaushaltes, die den neuen König zu äußerster Sparsamkeit und nüchterner Denkweise zwangen. Seine großen Verdienste lagen nicht in der Kunstförderung und die meisten Künstler verließen den Hof, jedoch richtete er sein Augenmerk auf den geordneten Aufbau des Staatswesens und auf die Hebung des allgemeinen Wohlstands. Für seine Schlösser gab er nur wenig Geld aus.
In Charlottenburg vollendete er anstelle des Schlosses den 1712 begonnen Bau der Luisenkirche. Das den Museen gewidmete und im Verfall begriffene Opernhaus schenkte er den Bürgern zur Errichtung eines Schul- und Hirtenhauses. Es widerstand jedoch seinem ökonomischen Sinn, Schloß Charlottenburg gänzlich zu vernachlässigen und so wurden die notwendigen Unterhaltungsarbeiten nicht versagt. Vom Park wurden einige Randteile den Bürgern als Ackerland überlassen, alles übrige aber ließ der König sorgfältig pflegen und unterhalten. Als persönliche Wohnstätte zog Friedrich Wilhelm I. aber seine Jagdschlösser und das Schloß in Potsdam vor.
Die Stadt kam wie schon erwähnt in den Genuß seiner landesväterlichen Fürsorge, indem er ihr eine ausgedehnte Stadtmark schenkte, ihr die lange entbehrte Verfassung gab, sie in den Postverkehr einbezog, Innungen schuf und die Berlin-Spandauer Straße über Charlottenburg legte. Der Ort selbst konnte aber im Schatten Potsdams nicht gedeihen, die Steuereinnahmen gingen zurück und seine Rechte wurden sukzessive eingeschränkt. Es entstand sogar der Plan, die Stadt wieder in ein Dorf umzuwandeln. Der König suchte das Schloß nur auf, wenn er einen Gast festlich empfangen wollte. Jedoch geizte er auch bei seinen Staatsgästen. Als Zar Peter durch Deutschland reiste sagte der König:
"Ich will 6000 Taler definieren, dafür soll Finanzdirectorium die Menage so machen, daß ich den Zaren defrigieren kann von Wesell bis Memel. In Berlin aber wird der Zahr aparte tractirt; nit einen Pfennig gebe mehr dazu. Aber vor der Welt sollen sie von 30 à 40,000 Rthlr. sprechen, daß es mir koste."3
Während der Regierungszeit Friedrich Wilhelm I. erlebte das Schloß nur ein einziges glanzvolles Fest, nämlich als Friedrich August von Polen und Kurfürst von Sachsen im Mai/Juni 1728 den preußischen König besuchte. Es wurde ein großes Feuerwerk veranstaltet. Ein Teil der Gäste vertrieb sich die Zeit im Garten mit Sternschießen. Sobald jemand den an einer Stange befestigten Stern traf, wurde eine Leuchtkugel in den Himmel gefeuert. Nach den Feierlichkeiten wies der König jedoch sofort wieder Sparmaßnahmen an.
Nur durch den Tod des Königs im Jahre 1740 entging Charlottenburg dem Bedeutungsverlust und konnte durch den neuen König Friedrich der Großen, der am 31. Mai 1740 die Regierung antrat, einer Blütezeit entgegen sehen. Am Todestag des Vaters bezog Friedrich II. das Schloß. In diesen Tagen gab es in der Stadt einen enormen Besucheransturm. Dies führte so weit, daß alle Gasthöfe und Schenken überfüllt waren. Es entstand sogar laut Berichten ein Lebensmittelengpaß.4 Das Rechtswesen (Preußisches Landrecht), des Steuerwesens (Abschaffung der Akzise), des Schulwesens und der Militärverfassung wurden durch ihn veranlaßt. Der neue König wollte das geistige Erbe seiner Großmutter Sophie Charlotte wieder aufleben lassen. Er besaß ein tiefes Verständnis für Musik und war mit Haydn, Mozart, Boccherini und später auch mit Beethoven freundschaftlich verbunden. Im Flügel von Knobelsdorff ließ er ein Konzertzimmer einrichten.
Als großer Förderer des deutschsprachigen Theaters, bedeutete die nur elf Jahre währende Regierungszeit Friedrich des Großen, von 1786 bis 1797, kann aber nur als Übergangszeit bezeichnet werden. Während in Frankreich die Revolution einen Bruch in der Politik und Kunst bedeutete, das Alte verabscheut und das Neue bejubelt wurde, vollzog sich in Preußen, das im 18. Jahrhundert der modernste Staat Europas war, der Gang der Entwicklung wesentlich ruhiger. In Berlin setzte sich ein eleganter Frühklassizismus durch, zu dessen künstlerisch bedeutendsten Leistungen die Raumausstattungen im Berliner Schloß und im Potsdamer Marmorpalais u.a. von Carl Gotthard Langhansgehören. Im Schloß Charlottenburg nistete sich dieser Frühklassizismus in der westlichen Hälfte des Neuen Flügels ein. 1788 bis 1790 wurden Räume im Erdgeschoß auf der Gartenseite als Sommerwohnung für den König modernisiert. Die beruhigte Formensprache der neuen Zeit, der Sinn für das Gerade, Konstruktive und das natürliche Material, sticht zwar auffällig vom Rokoko ab, aber manche Eigenart dieses Stils ist doch geblieben. Friedrich Wilhelm II. fügte dem Schloß als neuen Bauteil am westlichen Ende der Orangerie einen Theaterbau an, der nicht nur die Symmetrie des Ganzen aus dem Gleichgewicht brachte, sondern auch durch seine Größe einen neuen Schwerpunkt der Anlage bildete. Das Theater wurde 1795 der Öffentlichkeit freigegeben, so daß sich an dieser Stelle Schloß und Stadt enger verbanden.
Insgesamt kam es zu einer Auflockerung der herrscherlichen barocken Ordnung, durch die Errichtung der kleinen Orangerie, und des Belvederes (beide von Langhans), die nicht in das bestehende Achsensystem einbezogen wurden. Es handelt sich hierbei um einen rundlichen Bau mit drei Geschossen, wobei die beiden oberen nur aus jeweils einem großen, mit Parkett, Kristallkronleuchtern und wertvollen Vasen ausgestattetem Saal bestanden. Letztendlich wurde hier jedoch kein Tee getrunken, sondern geheime Sitzungen abgehalten und über die Schriften von Marc Aurels, Leibnitz und des Großen Kurfürsten diskutiert. Laut einer Anekdote erschienen dem König dort einmal Geister, die ihm rieten, den "Pfad der Tugend" einzuschlagen. Seit diesem Ereignis soll er das Belvedere gemieden haben. Außer dem Belvedere ließ er noch zwei Angelhäuser errichten, eins im gotischen Stil und eins aus Korbgeflecht, daß im Jahr 1864 wieder abgerissen wurde.
Die Regelmäßigkeit wurde durch den Anschein des Natürlichen ersetzt, die Symmetrien verwischt und gewundene Wasserläufe und Wege sollten dem Auge ständig wechselnde Landschaftsbilder vorführen.
Belvedere im Garten
Der Brand
Im Jahr 1746 ereignete sich eine Katastrophe im Schloß. Es brach Feuer während des
Besuches der Königin-Mutter aus. Mitten in der Nacht wurden die Schloßbewohner durch die Garde-du-Corps alarmiert. Der Hofchronist Bielfeld berichtet, daß die Menschen im Nachthemd das Gebäude verließen. Die Stadt Charlottenburg war völlig handlungsunfähig und man mußte auf die Feuerspritzen aus Berlin und Spandau warten. Diese trafen jedoch schon nach kurzer Zeit ein, da das Feuer bis in die beiden Nachbarstädte zu sehen war. Der König blieb in der Aufregung ziemlich gelassen und sagte nur: "Es ist ein Unglück, doch werden die Handwerker in Berlin etwas dabei verdienen; wenn nur niemand dabei zu schaden kommt."5 Vier Zimmer brannten völlig aus, der Schaden belief sich auf etwa 25 000 Taler. Sofort nach dem Brand wurde Knobelsdorff beauftragt, die Räume wieder zu rekonstruieren.
Die Vorliebe des Königs für Charlottenburg hielt jedoch nicht während seiner gesamten Regierungszeit. Als er nach dem zweiten Schlesischen Krieg nach Preußen zurückkehrte, zog es ihn mehr und mehr in das 1747 fertiggestellte Sanssouci in Potsdam. Wahrscheinlich belasteten ihn die Nähe zum Unruheherd Berlin und die ständig vor dem Schloß herumlungernden Menschen. "Unbequeme Besucher, Bittsteller, Gaffer, vor allem betriebsame Diplomaten, sie sich unter der vorigen Regierung an einen sehr zwanglosen persönlichen Verkehr mit dem Monarchen gewöhnt hatten, waren schwer fernzuhalten."6 Das Schloß wurde wieder einmal als Veranstaltungsort für Festlichkeiten genützt. Erwähnt seien hier die Land- und Wasserfeuerwerke des Königs, die auch viele Besucher aus Berlin anlockten.
Nach der Brandkatastrophe von 1746 wurde das Schloß ein zweites Mal während des siebenjährigen Krieges beschädigt. 1760 plünderten russische Kosaken und Ulanen, österreichische Husaren und sächsische Dragonen das Schloß. Sie zerstörten Teppiche, Decken, Gardinen, Gemälde und kostbare chinesische Vasen. Die Angestellten wurden verprügelt und entgingen nur knapp dem Tod.
Friedrich Wilhelm II. war kein starker, aber ein gutmütiger und menschenfreundlicher Regent. Er folgte dem gang der Zeit, doch zögernd und auf Wahrung des Überkommenen bedacht. In den wenigen Jahren seiner Regentschaft hat er in Charlottenburg viel gebaut und wie ein barocker Fürst Architektur als Zeichen seiner herrscherlichen Existenz errichtet. Nur haben diese Neubauten viel von der herrschaftlichen Gestalt des Schlosses zurückgenommen.
Die Zeit Schinkels
Am 16. November 1797 bestieg der älteste Sohn Friedrich Wilhelm II. im Alter von 27 Jahren als Friedrich Wilhelm III. den Thron. Seine 43-jährige Regierungszeit, eine der längsten in der Geschichte Preußens, ist von gewaltigen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen bestimmt, die auch im Bereich von Kunst und Kultur eine tiefgehende Wirkung ausübt. Die Kraft des Barock war endgültig gebrochen und das ernste, in sich gekehrte Wesen des neuen Königs und der veränderte Zeitgeist, der Romantik und des Biedermeier wirkten zusammen, um dem Schloß eine neue Bedeutung zukommen zu lassen. In der Sparsamkeit und Bescheidenheit, die ihn auf repräsentativen Glanz der Hofhaltung verzichten ließen, war er dem Soldatenkönig, seinem Urgroßvater ähnlich. Ebenfalls teilte er dessen Leidenschaft für das Militär und so ist es verständlich, daß die ersten und einzigen Bauten, die er dem Schloß hinzufügte, ein Wachgebäude und eine Reitbahn um 1800 waren.
Die Französische Revolution und die aggressive Expansionspolitik Napoleons beendeten, das an der Wende des 19. Jahrhundert, noch immer friderizianische geprägte Zeitalter Preußens. Nach den katastrophalen Niederlagen in den beiden Schlachten von Jena und Auerstädt am 14. Oktober 1806 war Preußen ernsthaft in seiner Existenz bedroht. Preußen verlor etwa die Hälfte seines Staatsgebietes und seiner Bevölkerung. 1806 war die königliche Familie aus Berlin geflohen, die Franzosen besetzten die preußische Hauptstadt, und erst 1809 kehrten Friedrich Wilhelm III. und die Königin Luise aus Königsberg zurück. Aufgrund des triumphalen Einzugs am 23. Dezember 1809 wurden die Wohnungen des Königspaars von dem damals 28-jährigen Karl Friedrich Schinkel modernisiert. Nach den Befreiungskriegen 1813/14 und dem Wiener Kongreß 1815, durch die Preußen politisch und militärisch wieder erstarkt war und in die Heilige Allianz" mit Rußland und Österreich in den Kreis der europäischen Führungsriege aufgestiegen war, trat an die Stelle von Reformen die Restauration und Reaktion. Gleichzeitig wurde der Ausbau der staatlichen Verwaltung ausgebaut und wichtige Weichen für den technischen und industriellen Fortschritt gestellt. Durch die Gründung von Akademien und Universitäten erfuhren ebenfalls die Künste und Wissenschaft sowie Museen und Theater eine großzügige Förderung. Vor allem Berlin, auf dem Weg zu einer Metropole zog Künstler, Gelehrte und Dichter an und bildete ein kulturelles Zentrum. Das "moderne Berlin" wurde geschaffen und der Protagonist dieser Entwicklung war Schinkel. Mit seinen Bauten, wie der Neuen Wache, der Bauakademie, dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, dem Museum am Lustgarten und der Kirche am Werderschen Markt veränderte er das Bild Berlins nachhaltig.
Das Königspaar hatte Schloß Charlottenburg, neben der Pfaueninsel, zum bevorzugten Aufenthaltsort auserkoren und bewohnte während seiner Aufenthalte den westliche Teil des für Friedrich den Großen erbauten neuen Hügel des Schlosses. Da die Räume erst wenige Jahre zuvor für Friedrich Wilhelm II. umgestaltet worden waren, erübrigte sich eine Modernisierung im großen Stil. Die erste grundlegende Umgestaltung geschah, wie schon erwähnt, nach der Rückkehr 1809. Schinkel arbeitete hier zum ersten Mal für das Königshaus und hatte den Auftrag das Schlafzimmer der Königin neu einzurichten. Dabei sollte es aber nicht bleiben. Nach dem plötzlichen Tod der Königin 1810 wurde mit Schinkels Hilfe ein Mausoleum geplant und gebaut, um ihrem Andenken ein bleibendes Denkmal zu setzen. Der König selbst hatte eine Skizze angefertigt, die einen Bau in der Gestalt eines dorischen Tempels vorsah und bat Schinkel, die Ausführungen zügig voranzutreiben. Der Vorbau und alle architektonischen Gliederungselemente waren aus Sandstein gearbeitet und lichtgelb gefärbt. Da eine komplette Ausstattung mit Marmor aus finanziellen Gründen nicht realisierbar war, wurden die Wände mit grünlich-gelben und die Gesimse mit gelblichen Stuckmarmor verkleidet.
Vierzehn Jahre nach dem Tod Luises heiratete der König 1824 die zur Fürstin erhobene Gräfin Auguste Liegnitz. Für sich und seine junge Gemahlin ließ er sich von Schinkel im östlichen Teil des Charlottenburger Schloßparks unweit der Spree eine Sommerresidenz erbauen, deren Vorbild die Villa Reale del Chiatamone in Neapel war. Der auf einem fast quadratischen Grundriß errichtete Neue Pavillon verbindet Einfachheit und Klarheit im architektonischen Aufbau mit Leichtigkeit und Eleganz in den Proportionen. Obwohl der Pavillon mit seinen verputzten Flächen und zarten Profilen sich dem Knobelsdorffschen Hügel anpaßt, hat Schinkel ein persönlich anmutendes Werk geschaffen, in dem die künstlerische Gesinnung seiner Zeit zum Ausdruck kommt. Der Wunsch des Königs, an allen Seiten ins Freie treten zu können, wurde durch eine umlaufende Gartenterrasse im Erdgeschoß und durch einen ebenfalls umlaufenden Balkon im Obergeschoß verwirklicht. Das Mausoleum und der Neue Pavillon (Schinkel-Pavillon) vertreten, wenn man es vereinfacht betrachtet Romantik und Biedermeier. Das Mausoleum blieb jedoch schon unter Friedrich Wilhelm III. nicht unberührt von Veränderungen, die die ursprüngliche Leichtigkeit und Schlichtheit des Baus beeinträchtigten, da man in der Mitte der zwanziger Jahre Fortschritte in der Bearbeitung von Granit gemacht hatte, die es ermöglichte aus riesigen Findlingen, aus der Mark, ein edles Baumaterial zu gewinnen. So wurde der aus gelben Sandstein errichtete Portikus des Mausoleums durch einen in der Form gleichen roten Granit substituiert, der prächtiger wirken sollte. Auch der Garten erfuhr durch Friedrich Wilhelm III. Umgestaltungen. 1819 wurde Peter Joseph Lenné, der bedeutendste Landschaftsarchitekt des 19. Jahrhunderts und Schöpfer auch der Parkanlagen von Sanssouci, Potsdam und Glienicke, mit der Umgestaltung des in großen Teilen noch französisch geprägten Barockgartens in einen modernen Landschaftsgarten beauftragt. Mit Ausnahme der geraden Hauptalleen und dem großen Wasserbassin, die der König zu erhalten wünschte, löste Lenné das barocke Gefüge des Gartens auf. Es wurde im Sinne des englischen Landschaftsgartens von den geometrischen Figuren Abstand genommen und stufenweise Übergänge vom Tektonischen zum Natürlichen, vom Schloß zum Karpfenteich, geschaffen.
Aus Freude darüber, daß seine Frau Luise 1806 aus Pyrmont zurückkehrte, ließ er den öde anmutenden Sandplatz vor dem Schloß in eine Rasenfläche umgestalten und nannte ihn Luisenplatz
Im Schloßgarten
Nur wenige Tage später feierte der König seinen Geburtstag, zu der auch die Bewohner Charlottenburgs eingeladen waren. Mehr als 30 000 Untertanen kamen in den Schloßgarten, um den Feiertag zu begehen. Das waren noch mehr Menschen als beim Einzug der Erbstatthalterin der Niederlande. Der Garten war jedoch nicht nur zu besonderen Anlässen für die Bevölkerung geöffnet. Friedrich Wilhelm III. hatte erlaubt, daß "zu allen Zeiten anständige Menschen den Garten besuchen dürften".7
Der Schloßgarten war auch der erste Ort an dem der Hofstaat und die Bürger Charlottenburgs sich zum ersten mal bei einem Fest begegneten. Die Schwester von Friedrich Wilhelm II., die Erbstatthalterin der Niederlande, besuchte Charlottenburg und wurde mit Jubel im Garten empfangen. Die Kutsche von Elisabeth fuhr jedoch so schnell durch die Menschenmenge im Garten, so daß einige "des vornehmen und gemeinen Pöbels aus Berlin" überritten oder sogar überfahren wurden.8
Während der Französischen Besatzung verwahrloste der Garten zunehmend. Es wird berichtet, daß ein Privatmann aus Charlottenburg die verheerende Finanzlage am Hof erkannte und aus eigener Tasche 75 Taler monatlich für die Wiederherstellung und Pflege des Gartens zinsfrei spenden wollte. Sein Angebot wurde nicht abgeschlagen. Aber auch mit diesen Spenden ließ sich der Garten nicht unterhalten. Schließlich rang sich der König 1810 dazu durch, das Gelände des Küchengartens (gegenüber des Luisenplatzes) zu verkaufen. Der Berliner Bankier Moses Levy erwarb es. Zehn Jahre später kaufte sein Sohn noch das Orangerie- und Spritzenhaus auf. Er ließ beide Gebäude abreißen und baute nach Schinkel Entwürfen ein vornehmes Wohnhaus. Der Anschließende Besitzer, Graf Hacke, veranstaltete eine Lotterie in dem das Wohnhaus den Hauptgewinn darstellte.9
Los der Graf Hackeschen Lotterie
Nach dem Tod Friedrich Wilhelm III. wurden weitere gestalterische Änderungen am Mausoleum in Angriff genommen. Da nun auch der Sarkophag des Königs neben dem seiner geliebten Frau Luise im Mausoleum stehen sollte, mußte es um einen quer gelegten Anbau erweitert werden. Da der so erweiterte Raum mit einem Marmornen Kruzifix und an das Frühmittelalter erinnernden Deckenfresken ausgestattet wurde entstand der Eindruck eines Kirchenraumes. Der Kopf von Königin Luise war nun nicht mehr auf den Schloßgarten ausgerichtet, sondern auf den Altar. Das Königtum wird also mit dem göttlichen in Beziehung gebracht.
Das Schloß unter Friedrich Wilhelm IV.
Der Thronfolger Friedrich Wilhelm IV. bezog schon vor seiner Krönung eine Wohnung im Schloß. Mit seiner Gemahlin Prinzessin Elisabeth richtete er sich im Herbst 1825 und Sommer 1826 ein. Die Ausstattung der Wohnung vermischte bereits von den Vorgängern vorhandenes Mobiliar mit historisierendem Neuen. Der König bewies zwar als junger Mann viel Kunstverständnis, von dem bei seinem Regierungsantritt 1840 leider nicht mehr viel vorhanden war. Nach dreimonatiger Regierungszeit erkrankte der Baumeister Schinkel tödlich, so daß der König nun auch nicht mehr mit seiner Beratung, was die Verschönerung des Schlosses anbelangte, rechnen konnte.
Während der Regierung Friedrich Wilhelm IV. dehnten sich Berlin und Charlottenburg immer weiter aus. Dies führte dazu, daß das Schloß Charlottenburg seinen Charakter als Landsitz verlor. Somit war es als alternative zum Berliner Stadtschloß nicht mehr interessant. Die königliche Familie wohnte nun nur noch einige Wochen im Spätherbst in Charlottenburg. Die Einwohner der Residenzstadt klagten, daß deshalb die Geschäfte nicht mehr so gut liefen. Eine Ausnahme war das Jahr 1848, in dem der Hofstaat bereits im Vorfrühling ins Schloß zog. Bismarck besucht das Schloß vier Jahre später. "Bismarck erschien bei seinem Besuche dort am 27. April 1852 die Einrichtung und Führung des königlichen Haushalts die eines Grandseigneurs auf dem Lande. Über die Verzögerung seines Empfanges wurde er durch ein "gutes und elegant serviertes Frühstück" getröstet."10 Ein anderer Schloßbesucher, der Freiherr von Selb hat jedoch einen ganz anderen Eindruck von den Gepflogenheiten am Hof. Er wohnte einem Vortrag über den Ursprung der Sprache und dem Geist der Buchstaben bei und beklagt sich über das schlichte Abendessen:
"Ein Bauer, der sich zum Abendbrot niederläßt, verlangt, daß sein Eßtisch mit einem Tischtuch bedeckt sei, wäre es auch nicht von Damast, doch von selbstgesponnener und oft selbstgewebter Leinwand; den Luxus eines Tischtuches würde man bei der königlichen Abendtafel vermißt haben."11
Schloß Charlottenburg zu Beginn des 20. Jh.
Zum Ende des letzten Jahrhunderts war Kaiser Friedrich III der letzte, der im Schloß Charlottenburg gelebt hatte. Schwer an Kehlkopfkrebs erkrankt, hatte er nur 99 Tage zu regieren. Kurz vor seinem Tod ließ er sich von seinem Thronfolger im Schloßgarten dessen Brigade vorführen, bevor er sich am 1. Juni ins Neue Palais nach Potsdam begab, wo er zwei Wochen später auch starb. Nach seinem Tod begann für das Schloß eine relativ ereignislose Zeit, in der nur die Gräber als eine Art Wallfahrtsort viele Besucher anzogen.
Besitzfragen des Schlosses nach Ende der Monarchie
Nach dem Ende der Monarchie 1918 war zunächst nicht völlig sicher, was mit den ca. 80 Schlössern, Burgen und Villen des vormals regierenden preußischen Königshauses in allen Teilen Deutschlands geschehen sollte. So wurden einigen Schlössern zeitweise eine andere Nutzung zugeführt. Im östlichen Teil des Eosanderbaus des Schlosses Charlottenburg wurde zum Beispiel ein Lazarett eingerichtet, das auf den Geheimbefehl Noskes das Freikorps Hülsen ins Schloß verlegt wurde. Bereits 1919 setzten sich namhafte Persönlichkeiten, wie Hans von Makowski dafür ein, daß Schlösser der Monarchie als ,,bedeutsame und unersetzliche Zeugen deutscher Geschichte, Kunst- und Kulturentwicklung"12 dauerhaft zu erhalten sind. Gegen 1926 wurde nach langen intensiven Fachdiskussionen ein neues Konzept der ,,Museumsschlösser" entwickelt und schon bereits ein Jahr später, also 1927 kam es zur Gründung der ,,Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten". Ihre Aufgabe bestand nun darin, die ,,Organisch gewachsene Einheit" der ihnen mehr als 50 zugesprochenen Schlösser und Burgen, zu denen zum Teil auch große Gartenanlagen gehörten, zu wahren und zu pflegen. Zu diesen Schlössern mit kunst- und kulturhistorischem besonders wertvollem Inventar gehörte auch Schloß Charlottenburg mit samt seinem Park und den Parkbauten.
Charlottenburg um 1920
Es wurde damit begonnen, den nun in öffentlicher Hand befindlichen Gebäudekomplex ins kulturelle Leben Berlins einzubeziehen, indem man zum Beispiel Festwochen in der goldenen Galerie Konzerte veranstaltete, die Kapelle für den Vortrag von Orgelmusik nutzte, in der Eichengallerie Empfänge gab und andere Teile für die Besichtigungen zur Verfügung stellte.
Einfluß des zweiten Weltkrieges auf das Schloß
Bis zum Beginn der wirklichen Luftangriffe durch die Royal Air Force und die US Air Force hatte Schloß Charlottenburg, wie auch viele der bedeutenden historischen Gebäude kaum Schaden erlitten. In dem Tagebuch des britischen Bomber Commandants ist vom 23./24. September 1940 u.a. noch zu lesen, daß ,,das berühmte Schloß Charlottenburg leicht beschädigt wurde".13
Unter dem Eindruck der durch die anfänglichen Luftangriffe entstandenen Schäden, wurden Mittel zur Verfügung gestellt, die zum Schutz denkmalgeschützter Gebäude und Objekten dienen sollten. So wurde u.a. für die Goldene Galerie im Schloß Charlottenburg Luftschutzbaumaßnahmen bewilligt. Doch die Entwicklung des Luftkriegs zeigte aber, wie wenig diese Objektschutzmaßnahmen Stand halten konnten und enthüllten den wahren Stellenwert des Kulturschutzes bei den damaligen Machthabern. In der Nacht vom 18. zum 19. November des Jahres 1943 erfolgte der erste große Angriff auf Berlin. Erst bei dem zweiten großen Flächenangriff der Royal Air Force in der Nacht vom 22. zum 23. November 1943 wurde das Schloß schwerstens beschädigt. Dabei brannte es fast völlig aus. Der Mittelbau von Nering und der größere Teil des Neuen Flügels (auch Knobelsdorfflügel sowie die Orangerie brannten bis auf geringe Reste der Dekoration aus. Die östlich und westlich des Neringbaus anschließenden Trakte von Eosander erlitten Schäden. Ebenso wurde die in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Schloßbrücke zerstört. Eine Zeitzeugin berichtet u.a. in einer Niederschrift vom 4.11.1993 " ... Und das Charlottenburger Schloß brannte. Das werde ich nie vergessen. Der Schloßturm stand in Flammen, das ganze Gebäude brannte. In dem Durcheinander konnte man nur schwer Einzelheiten erkennen. Ein Lazarettraum war unten in Straßennähe in dem langen Gebäudeteil eingerichtet. Ein wohl Schwerverletzter wurde hereingetragen. Eine Frau schrie: Sie lassen meinen Mann verbluten, hilft denn niemand!"14 Bei den immer verschärften Bombenangriffen, die sich in den Januartagen ereigneten, wurde das Schloß Charlottenburg bei jedem dritten Angriff getroffen.
Das Schloßinventar
Wesentliche Teile des Schloßinventars konnte jedoch gerettet werden. So heißt es: ,,Die beiden Söhne des damaligen Schloßoberinspektors Bahr, die im westlichen Hofflügel wohnten und die Schreckensnacht im Luftschutzkeller unter der Kuppel verbrachten, berichten zudem von gerettetem Kunstwerken (u.a. Bilder), die ihr Vater aus dem brennendem Schloß holte, bevor die Decken einstürzten".15 Weiter soll schon 1941 damit begonnen worden sein, die Auslagerung von Kunstwerken aus den preußischen Schlössern vorgenommen zu haben. Über Einzelheiten geben aber die meist undatierten Verlagerungslisten keine Auskunft mehr, jedoch ist bekannt, daß einige Depots des Schlosses Charlottenburg im Jagdschloß Grunewald im Keller des Berliner Schlosses und in Schlösser in Thüringen verlagert wurden. Durch die Verlagerung konnten wichtige Kunstgegenstände, wenn jedoch nicht alle völlig unbeschädigt, erhalten werden. Als man jedoch erkannte, daß der Verlust an hochwertiger Kunstwerke immer unaufhaltsam anwuchs, begann man mit fotografischen Dokumentationen sowohl auf örtlicher Ebene, wie auch auf der Grundlage eines nationalen Führerprogramms. Am 9. April kam es zu dem Führerbefehl, künstlerische und historisch wichtige Wand- und Deckenmalereien fotografisch zu erfassen. Später wurden die Arbeiten auch auf andere Kunstgattungen wie Skulpturen, Glasgemälde usw. ausgeweitet. Diese Arbeiten sind zum größten Teil dem Photographen Peter Cürlis zu verdanken, der kurz vor dem Angriff etwa 400 Farbphotos angefertigt hatte.
Zerstörungen am Hauptgebäude
Nach der Kriegszerstörung gab das Städtische Orchester Berlin während des Sommers 1944 im Ehrenhof eine Serie von Freiluftkonzerten. Am 24. Juni des selben Jahres wurde vor der Ruine eine Kundgebung abgehalten, bei der der Gaugpropaganderleiter Vogt die 12 000 Teilnehmer für den Glauben an den Endsieg einzunehmen suchte.
Die Zeit direkt nach dem Krieg
Nach dem Krieg versuchte man sehr bald bei dem Magistrat von Berlin einen Antrag für Mittel zum Erhalt des Berliner und Charlottenburger Schlosses durch zu setzen. Jedoch wurde dieser Antrag auf den Hinweis abgewiesen, daß das Augenmerk nun vielmehr auf den desolaten Wohnungsbestand gerichtet werden müsse. Auch nachdem im Oktober der ehemalige Grundbesitz und damit auch die Berliner Schlösser dem Finanzamt für Liegenschaften zugeschlagen wurde, wurden Instandsetzungsmittel weiterhin verneint. Erst durch einen sogenannten Befehlsbau, der auf Anforderung der Besatzungsmacht galt und mit Mitteln durch die Bauverwaltung ausgeführt werden sollte, konnte dem Schloß Charlottenburg ein Charakter baulicher Notwendigkeit gegeben werden.
Im Jahr 1946 begann man bereits mit den Sicherungsarbeiten zur Winterfestmachung einiger Räume, wie dem Porzellankabinett, im Schloß. Doch hat es den Anschein, als sei in anderen Teilen des Schlosses, die von den Bombenangriffen nicht wesentlich zerstört wurden, noch mehr gearbeitet worden. Diese Zustände seien so abenteuerlich gewesen, daß es zu mehreren Beschwerden der Schlösserverwaltung gekommen sei.16 Stukkateure entfernten Hölzer, um diese anderweitig verwenden zu können. Teilweise wurden Starkhölzer auch einfach zu Heizen verbraucht. Um dieses regelrechte Ausschlachten aufzuhalten, veranlaßte man eine Sicherstellung von allem Holzwerk.
Ehrenhof 1953
Der Wiederaufbau, der in den ersten Jahren nach Kriegsende nur mit geringfügigen Maßnahmen beginnen konnte, wurde intensiv seit den 50er Jahren betrieben. Den Verlauf des zähen Durchsetzungsaktes ist im wesentlichen der damaligen Schlösserdirektorin Margarethe Kühn (siehe Bild) zu verdanken, die schon bei dem Befehlbau eine wesentliche Rolle spielte.
Die Restaurierung wurde im wesentlichen nach dem Grundsatz betrieben, nur diejenigen Einzelheiten wiederherzustellen, die durch Photos und Fragmente gesichert sind. In Einzelfällen, wo Kopien nicht möglich waren, wurden allerdings zeitgenössische Künstler beauftragt, freie Nachschöpfungen zu liefern, so bei der Fortuna auf der Schloßkuppel von Richard Scheibe und den Attika-Figuren der Gartenfront, die 1977/78 von verschiedenen Bildhauern ausgeführt wurden.
Bereits 1952 wurde in der Mitte des Ehrenhofes des Schlosses Andreas Schlüters bildnerisches Hauptwerk, das Reiterstandbild der Großen Kurfürsten das Friedrich I. in Auftrag gegeben hatte und dessen ursprünglicher Aufstellungsort seit 1703 die ,,Lange Brücke" in unmittelbarer Nähe des Berliner Schlosses war, aufgestellt. Erst 1949 hatte man das Denkmal aus dem Tegeler See geborgen. Dort war es mit einem Prahm auf dem es im zweiten Weltkrieg sicher gestellt wurde, gesunken. Der Sockel mit dem Relief ist eine Kopie.
Schon damals plante man Räume im Obergeschoß des Ostflügels für Ausstellungszwecke instandzusetzen und das nur leicht zerstörte Mausoleum, das sich im Schloßpark befindet, baldmöglichst zu eröffnen. 1947 waren in den neuen Ausstellungsräumen die von der britischen Militärregierung organisierten Ausstellungen ,,Das Neue Buch" und ,,Baustoffe im Britischen Sektor" zu Ende gegangen.
Nun hatte sich auch Einstellung des Magistrats von Berlin zu der Frage wie mit den Schlössern umzugehen sei, geändert. In einem Bericht über die künftige Verwendung des Schlösser (Katalog-Nr. 154) heißt es: ,,Nach Beendigung dieser Arbeiten ist das Schloß Charlottenburg zweifellos berufen, eine wichtige Rolle im Berliner Kulturleben zu spielen. Es wäre nämlich im Hinblick auf den katastrophalen Mangel an musealen Ausstellungsräumen der einzige künstlerisch wertvolle Komplex, der sich für die Ausstellungen und Veranstaltungen kultureller Art eignet."17
Nach 1948 ist die erste Institution der späteren Stiftung für Preußischer Kulturbesitz im Schloß zu Gast. Nun sollten in der Folgezeit die Nationalgalerie, das Kunstgewerbemuseum (bis 1984) und das Museum für Vor- und Frühgeschichte folgen.
Schloß Charlottenburg heute
Heute ist das wiederaufgebaute, restaurierte und in seiner Inneneinrichtung sorgfältig ergänzte Charlottenburger Schloß als bedeutendste ehemalige Wohnstätte der Hohenzollernkönige und -kaiser einer der Hauptattraktionen der Stadt Berlin.
Die Restaurierung des Inneren, die soweit durchgeführt wurde als Fragmente und bildliche Unterlagen die beschädigten Dekorationen genauestens überliefern, war bis vor einigen Jahren noch im Gange. Die Winterkammern Friedrich Wilhelms II konnten aus Mangel an dokumentarischen Unterlagen nicht wiedererstehen.
Die königlichen Räume sind mit Mobiliar aus verschiedenen Epochen, mit Kunst- und Bildersammlungen u.a. mit dem Hofmaler Antome Pesne ausgeführten Portraits sowie bedeutenden Werken von Antome Watteau und Casper David Friedrich ausgestattet. Bei dem Bild von Antome Watteau (1684-1721) ist zu erwähnen, daß dieses Bild 1984 durch das Land Berlin und mit Hilfe von Spendengeldern für über 15 Mio. DM aus dem Haus Hohenzollern erworben wurde. Somit wurde der Verkauf des Watteau-Bildes ins Ausland verhindert. Mit diesem Bild und anderen Gemälden des französichen Rokoko Malers wurde am 23. Februar 1985 im Knobelsdorff-Flügel eine umfassende Ausstellung eröffnet.18
Weitere Ausstellungsereignisse waren u.a. die anläßlich des 200. Geburtstages des Malers Karl-Friedrich Schinkel, die unter dem Motto ,,Karl-Friedrich Schinkel - Architektur, Malerei, Kunstgewerbe" am 13. März 1981 organisiert wurde und eine weitere Ausstellung zu Ehren Friedrich des Großen im Jahr 1986. Aus Anlaß des 200. Todestages des Preußenkönigs eröffnete der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Ausstellung über Leben und Wirken Friedrich des Großen. Dabei waren etwa 800 hochkarätige Objekte wie zum Beispiel Briefe des jungen Königs zu sehen.19
Bei der Nachkriegsgeschichte von Schloß Charlottenburg muß man außerdem berücksichtigen, daß auch die große preußische Institution der ,,Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten" durch die Teilung Deutschlands sowie durch die Neuverteilung der ehemals preußischen Gebiete alle Schlösser außer Potsdam-Sanssouci Schloß Charlottenburg und die Schlösser Pfaueninsel und Grunewald verloren hatten. Dies bürgte auch ein Problem in der Inventarfrage, da während des Krieges ein Teil der Kunstgegenstände in Teile ausgelagert wurden, die sich außerhalb des westlichen Territoriums befanden. Erst seit der Wiedervereinigung, nach der sich die Stiftungen der beiden deutschen Teile zu der ,,Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg" vereint haben, ist ein reger Inventaraustausch möglich geworden. Somit konnte das Schloß Charlottenburg nun in seiner ursprünglichen Ausstattung wertvolles Inventargut zurück erhalten. Neben den Ausstellungen im Schloß nutzte der Berliner Senat hauptsächlich bis 1990 die Repräsentationsräume noch bei dem Besuch von Staatsgästen. Zu ihnen zählten in der jüngeren Vergangenheit der US- amerikanische Vizepräsident Hubert Humphrey, bei dessen Empfang am 6. April 1967 eine Reihe von Gegendemonstranten verhaftet wurden. Am 5. Mai 1967 ehrte man hier den scheidenden Bundespräsidenten Heinrich Lübke. Als amerikanischer Präsident trug sich Richard Nixon am 27. Februar 1968 im Schloß Charlottenburg ins Goldene Buch ein. Sein Nachfolger Ronald Reagen, der am 11. Juni 1982 Berlin besuchte, hielt nach seinem Empfang im Schloß an der aus Sicherheitsgründen gewählten Gartenseite vor etwa 25 000 ausgesuchten Berlinern eine Rede, in der er sein Eintreten für den Status der Stadt bekräftigte. Zu weiteren Ehrengästen zählten der französische Staatspräsident Fran(ois Mitterand (10. Oktober 1985), Prinzessin Diana (18. Oktober 1985) und der spanische König Juan Carlos (27. Februar 1986)
Literaturverzeichnis
Margarete Kühn, Schloß Charlottenburg, Berlin 1955 Margarete Kühn, Schloß Charlottenburg, Berlin 1970 Winfried und Ilse Baer, Schloß Charlottenburg - Berlin
Helmut Börsch-Supan und Gerhard Ulrich, Schloß Charlottenburg, Berlin 1980 Martin Sperlich, Schloß Charlottenburg, Berlin
1 Margarete Kühn, Schloß Charlottenburg, Berlin 1970
2 Margarete Kühn, Schloß Charlottenburg, Berlin 1950
3 Margarete Kühn, 1950
4 Helmut Börsch-Supan, Gerhard Ulrich, Schloß Charlottenburg, Berlin 1980
5 Margarete Kühn, Schloß Charlottenburg, 1970
6 Margarete Kühn, Schloß Charlottenburg, 1970
7 Helmut Börsch-Supan, Schloß Charlottenburg
8 Winfried und Ilse Baer, Schloß Charlottenburg, Berlin
9 Winfried und ilse Baer, Schloß Charlottenburg
10 Winfried und Ilse Baer, Schloß Charlottenburg
Börsch-Supan, Helmut; Ulrich, Gerhard, Schloß Charlottenburg, Werden und Wandel, 1980
Kunstamt Charlottenburg, Abt. Volksbildung, Schloß Charlottenburg - ein Musensitz?, 1995
Krieger, Bogdan, Berlin im Wandel der Zeiten, 1923
Sperlich, Martin, Schloß Charlottenburg, 1974
Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Stadt u8nd Bezirk Charlottenburg Geschichtslandschaft Berlin, Charlottenburg I, 1986
Berlin Handbuch, Lexikon der Bundeshauptstadt, 1992
Ein Schloß in Trümmern, Charlottenburg im November 1943, 1993
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Schloß Charlottenburg und wo befindet es sich?
Das Schloß Charlottenburg ist ein Schloß in Berlin, ursprünglich ein Landhaus namens Lietzenburg. Es war die Sommerresidenz von Sophie Charlotte, der Frau von Kurfürst Friedrich III. Es blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte als bevorzugter Aufenthaltsort preußischer Herrscher zurück.
Wer waren die wichtigen Persönlichkeiten im Zusammenhang mit dem Bau und der Entwicklung des Schlosses?
Wichtige Persönlichkeiten sind Sophie Charlotte, Friedrich I., Arnold Nering, Johann Friedrich Eosander, Friedrich Wilhelm I., Friedrich der Große, Friedrich Wilhelm II., Karl Friedrich Schinkel und Peter Joseph Lenné.
Wie hat sich die Lage des Schlosses auf die städtebauliche Entwicklung Berlins und Charlottenburgs ausgewirkt?
Die Grundlinie der "Via Triumphalis der Linden" wurde durch den Tiergarten weitergeführt und bildete die Basis für das neue Schloß. Die Schloßstraße verband das Schloß achsengerecht mit ihr. Dies verband die Dorotheenstadt, die Friedrichstadt und Lietzenburg in einem gemeinsamen Achsensystem.
Welche Bauphasen und Erweiterungen gab es im Schloß Charlottenburg?
Zuerst wurde eine Sommervilla ohne Wirtschafts- und Kavalierflügel errichtet. Später wurden unter Johann Friedrich Eosander Seitenflügel hinzugefügt, um einen Ehrenhof zu schaffen. Es folgten weitere An- und Umbauten unter verschiedenen Herrschern.
Welche Rolle spielte das Schloß unter Friedrich Wilhelm I.?
Friedrich Wilhelm I. bevorzugte Schlichtheit und sparte an Prunk. Er vollendete anstelle des Schlosses den Bau der Luisenkirche. Die notwendigen Unterhaltungsarbeiten wurden jedoch nicht versagt. Das Schloß diente hauptsächlich zur festlichen Empfang von Staatsgästen.
Wie wurde das Schloß durch Friedrich den Großen geprägt?
Friedrich der Große ließ im Flügel von Knobelsdorff ein Konzertzimmer einrichten. Nach einem Brand im Jahr 1746 wurde Knobelsdorff mit der Rekonstruktion beauftragt. Friedrich zog jedoch später Sanssouci in Potsdam vor.
Welche architektonischen Einflüsse prägten das Schloß Charlottenburg?
Die Architektur des Schlosses wurde von der italienischen Renaissance, dem Barock und dem französischen Flügelbau beeinflusst. Auch der Frühklassizismus spielte eine Rolle.
Welche Rolle spielte Karl Friedrich Schinkel bei der Gestaltung des Schlosses und des Schloßparks?
Schinkel gestaltete das Schlafzimmer der Königin Luise neu, baute ein Mausoleum für sie und errichtete den Neuen Pavillon. Er prägte damit Romantik und Biedermeier im Schloßpark.
Wie veränderte Peter Joseph Lenné den Schloßpark?
Lenné gestaltete den Barockgarten in einen modernen Landschaftsgarten um. Er löste das barocke Gefüge auf und schuf stufenweise Übergänge vom Tektonischen zum Natürlichen.
Wie wurde der Schloßgarten für die Bevölkerung zugänglich gemacht?
Friedrich Wilhelm III. erlaubte, dass "zu allen Zeiten anständige Menschen den Garten besuchen dürften". Der Garten war auch der erste Ort, an dem sich der Hofstaat und die Bürger Charlottenburgs bei einem Fest begegneten.
Welche Schäden erlitt das Schloß im Zweiten Weltkrieg und wie wurde es wiederaufgebaut?
Das Schloß wurde bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und brannte fast völlig aus. Nach dem Krieg wurde es schrittweise wiederaufgebaut. Wesentliche Teile des Schloßinventars konnten gerettet werden.
Welche Bedeutung hat das Schloß Charlottenburg heute?
Heute ist das wiederaufgebaute und restaurierte Schloß Charlottenburg eine der Hauptattraktionen Berlins und ein bedeutendes Zeugnis der Geschichte der Hohenzollern.
- Quote paper
- Thomas Woge (Author), 2000, Schloss Charlottenburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97397