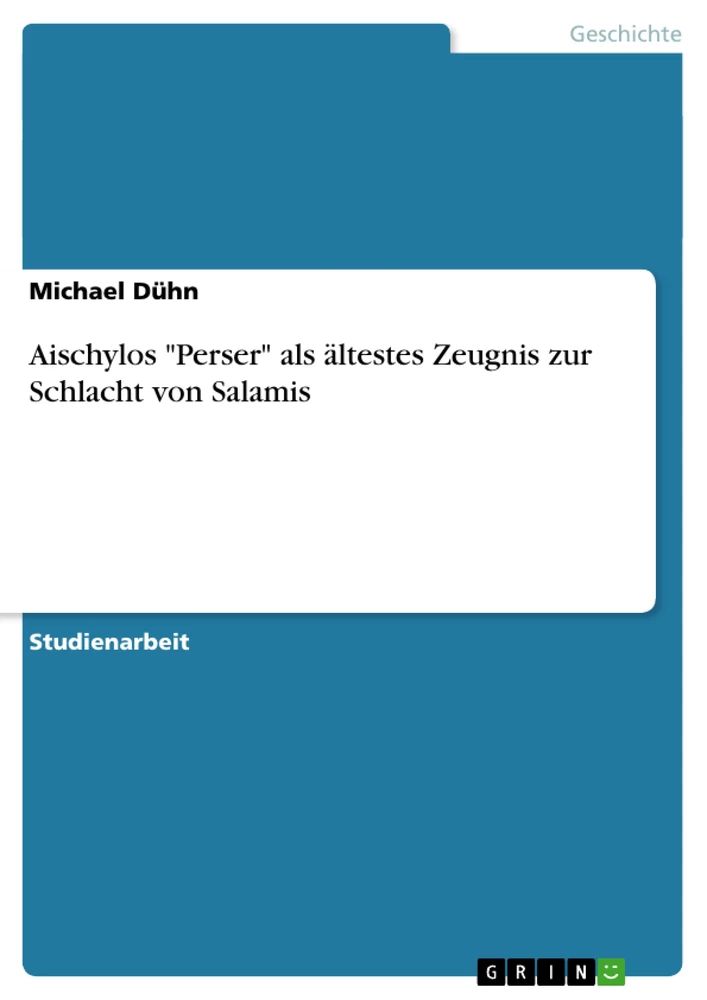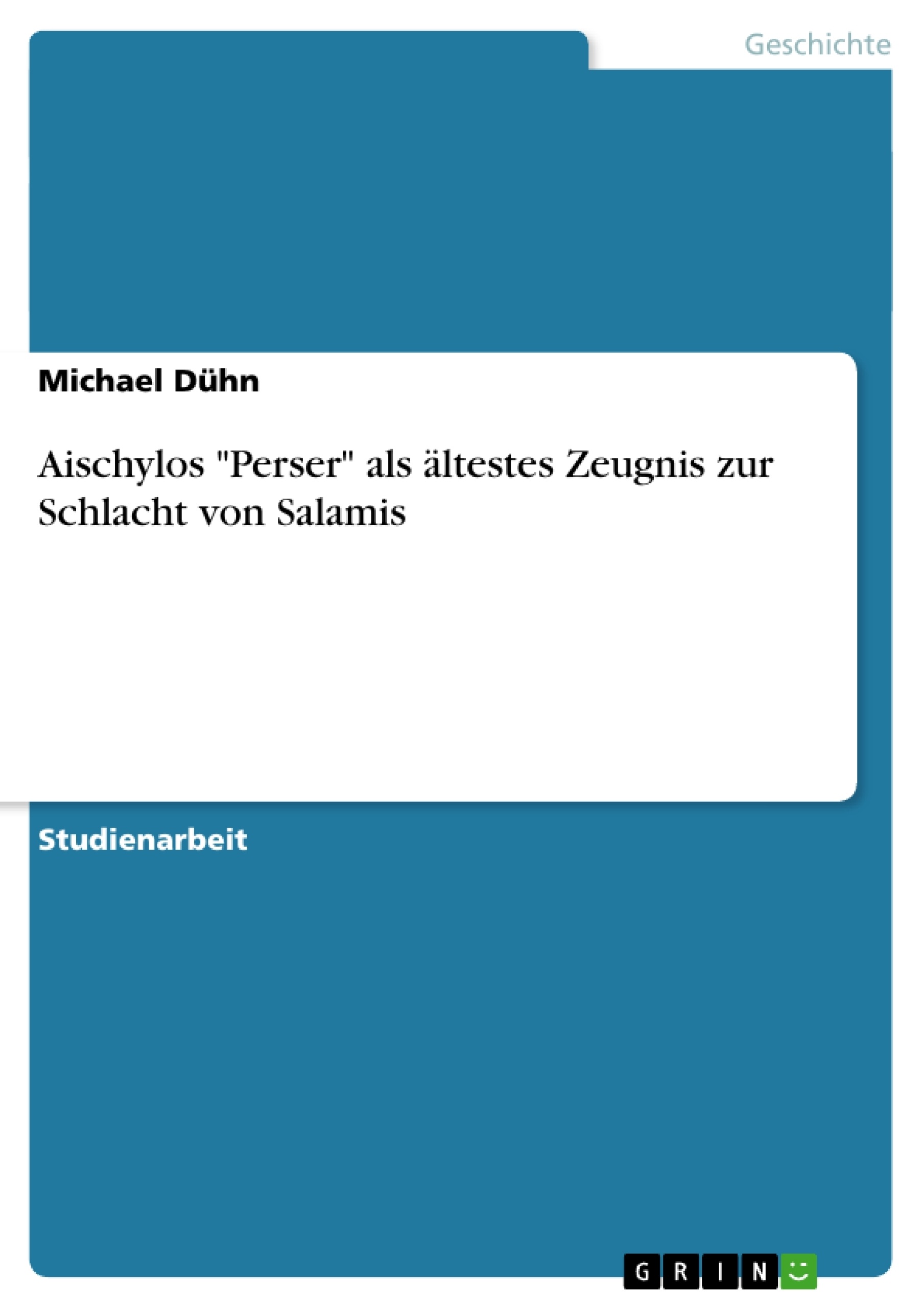Inhalt
1. Einleitung
2. Die Rezeptionsituation
3. Die allgemeine politisch-religiöse Aussage der ,,Perser“
4. Bezüge zu Themistokles und Schwierigkeiten der Interpretation
5. Verwendete Literatur
1. Einleitung
Aischylos ,,Perser" sind nicht nur ein beindruckendes Zeugnis athenischer Kunstproduktion sondern auch unter historischen Gesichtspunkten außerordentlich interessant. Das große Interesse der Althistoriker an dieser ältesten vollständig erhaltenen Tragödie erklärt sich dabei zum einen aus der Tatsache, dass die ,,Perser" die älteste schriftliche Quelle zur Schlacht von Salamis sind1 und zum anderen aus ihrer Sonderstellung in der Überlieferung als einzige erhaltene griechische Tragödie mit nichtmythischer Thematik.
Ungeachtet dessen ist die Auswertung einer Tragödie als historischer Quelle nicht unproblematisch und erfordert zunächst die Rekonstruktion eines historischen Verständnishintergrundes. Hauptsächlich gilt es dabei die künstlerischen Eigenheiten der Tragödie ebenso zu berücksichtigen wie ihr Rezeptionsumfeld. Ziel dieser Arbeit kann es daher nicht sein, einen vollständigen Überblick über Interpretationsmöglichkeiten der ,,Perser" als Quelle zu geben, sondern nach einer kurzen methodischen Einführung lediglich exemplarisch die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Heranziehung der ,,Perser" als Quelle aufzuzeigen.
Dabei soll anknüpfend an Christian Meiers These nach der die Athener die Tragödie brauchten, um sich den ethischen und religiösen Grundlagen ihrer Welt rückzuversichern2, versucht werden, die politischen Implikationen der ,,Perser" aufzudecken. Die zentrale Frage, die diesem Vorgehen zugrundeliegt, ist die nach dem Grund dafür, dass Aischylos acht Jahre nach Salamis in einer Tragödien-Trilogie mit sonst mythischen Sujets3 den Sieg der Griechen gegen die persischen Truppen aufgreift und damit sogar den ersten Preis gewinnt. Zunächst soll dabei die politische und religiöse Tendenz des Stückes allgemein bestimmt werden, um eine erste Antwort auf die Leitfrage geben zu können, um dann das Themistokles-Problem näherer Betrachtung zu unterziehen, weil sich daraus besonders deutlich die Grenzen und Möglichkeiten der Heranziehung der ,,Perser" als Quelle ableiten lassen.
2. Die Rezeptionssituation
Im Gegensatz zu heutigen Theaterstücken4 wurden die Tragödien in Athen für einen ganz bestimmten Anlass (Aufführung im Rahmen der Großen Dionysien) für ein ganz bestimmtes Publikum (die Athener Bürgerschaft) für einen ganz bestimmten Raum (das theatron am Südhang der Akropolis) zu einmaliger Aufführung im Rahmen eines Wettbewerbs geschrieben. Die Tragödie ist also vom Dichter als Spielvorlage für einen klar umrissenen Anlass konzipiert worden. Eine heutige historische Beschäftigung mit athenischer Tragödie darf dies nie außer Acht lassen, läßt doch erst die Vergegenwärtigung der Rezeptionsumstände5 die Tragödie zu einem beredten Zeugnis ihrer Zeit werden; ist sie doch nicht zum Lesen, sondern Ansehen und Anhören gemacht worden.
Dem Dramendichter war also genau bekannt, für wen er schrieb und er kannte als athenischer Vollbürger die gesellschaftliche Situation seiner Bürgerschaft, wobei Bezüge zur unmittelbaren Tagespolitik schon deshalb problematisch waren, weil die Tragödien bereits über ein halbes Jahr vor der Aufführung fertiggestellt sein mußten, um sie zur Vorauswahl dem Archon präsentieren zu können. Dabei legte jeder interessierte Dichter drei Tragödien und ein Satyrspiel vor. Die drei ausgewählten Dichter bekamen je einen Chor und zwei Schauspieler zugewiesen, die Finanzierung übernahm ein wohlhabender Bürger, der ,,Chorege", dem auch der Preis zufiel, wenn die von ihm betreute Tetralogie (drei Tragödien und ein Satyrspiel) gewann.
Der Inhalt der Tragödien wurde in aller Regel dem Mythos entnommen- es wurden also nur dem Publikum vor allem aus den homerischen Epen bekannte Begebenheiten verarbeitet, was den Blick schärfte für die Akzentsetzungen des Dichters und ihm erst die Möglichkeit bot, diese vorzunehmen. Dabei mußte der Dichter unbedingt die Einmaligkeit der Rezeption seiner Tragödien berücksichtigen- alles wichtige mußte bei einmaligem Hören und Sehen zu erfassen sein, andererseits aber auch qualitativ derart hochwertig sein, um zunächst die Vorauswahl und dann das eigentliche agon gewinnen zu können. So mußte sich die Konkurrenz der Dichter direkt auf den jeweiligen polis-Bezug der Tragödien auswirken: nur Tragödien, die Themen verhandelten, zu denen die ganze Bürgerschaft eine Beziehung hatte, konnten gewinnen. Eine wichtige Rolle spielte dabei das affektive Miterleben des Schicksals der Helden auf der orchestra durch das gleichsam lustvolle Entladen der Affekte eleos und phobos6. Darin sieht Aristoteles in seiner ,,Poetik" das hauptsächliche Wirkungsziel der Tragödie, dessen ethische Funktion darin liegt ,, durch bewußte Steigerung und Übersteigerung der Affekte auf der Ebene der ästhetischen Distanz über über den Identifikations-Effekt eine lustvole Entladung dieser Affekte zu erzielen und damit -nach überwindung der affektbedingten Sichtrübung- eine als lustvoll empfundene höhere Stufe rationaler Problemreflexion zu ermöglichen."7 Damit impliziert Latacz in seiner Aristoteles- Deutung, dass grundsätzlich in nahezu jeder Tragödie Probleme enthalten sind, zu deren Reflektion der Einzelne durch das Kunsterlebnis angeregt wird und mit denen der einzelne Zuschauer auch eine Beziehung hat, also auch und vor allem Probleme der gesamten Bürgerschaft.
In Verbindung mit Christian Meiers eingangs zitierter These ergibt dies nun die tragfähige Basis, von der aus die Betrachtung zur politisch- religiösen Aussage der ,,Perser" übergehen kann.
3. Die allgemeine politisch-religöse Aussage der,,Perser"
Aischylos wählte als Schauplatz der Tragödie den Hof des persischen Königs in Susa, der Hauptstadt des Großreiches. Das war einerseits notwendig, um die Ereignisse von Salamis tragisch verarbeiten zu können- schließlich kann nur das Schicksal der Besiegten zu tragischer Entfaltung gelangen. Doch wenn es Aischylos nur darum gegangen wäre, das tragische Schicksal eines im Kriege besiegten, den Griechen feindlichen Volkes zu zeigen, hätte er auch ohnes weiteres Episoden aus der Illias dazu verwenden können- die außergewöhnliche Wahl des Ortes und des Stoffes läßt sich also nicht allein mit dem dramatischen Potential der Ereignisse erklären, zumal Phrynichos vier Jahre zuvor bereits eine Tragödie aus dem gleichen Stoff mit demselben Schauplatz unter dem Titel ,,Die Phönissen" auf die Bühne gebracht hat. Aischylos mußte also, um nicht in die Nähe einer simplen Paraphrase zu gelangen, etwas grundsätzlich Neues zu sagen haben, sonst hätte er dieses ungewöhnliche Sujet nicht gewählt8. Dennoch verlangte die Wahl des Schauplatzes und der handelnden Personen dem athenischen Publikum emotional einiges ab: da wurden die einstigen Todfeinde9 als tragischen Helden dargestellt, mit deren Geschicken mitzutrauern genauso möglich und geboten war wie mit den konventionellen mythischen Helden. Die Darstellung der bösen Vorahnungen der persischen Alten, der schlimmen Träume der Königsmutter Atossa, die großen Klagegesänge (Kommoi) als die Nachricht der Niederlage durch einen Boten überbracht wird und schließlich das Auftreten des geschlagenen Königs, der nur sein Leben und einen leeren Köcher retten konnte, regt nicht zu Schadenfreude an, sondern erzwingt geradezu die Identifikation mit den Besiegten. Und offensichtlich befriedigte sie damit ein Bedürfnis der Athener, denn sie gewann nicht nur den erste Preis (mit den drei anderen Stücken der Tetralogie), sondern wurde schon im folgenden Jahr von Aischylos in Sizilien erneut inszeniert.
Christian Meier erklärt diesen Umstand vor allem mit den großen Verarbeitungsproblemen, die der Sieg von Salamis und seine Folgen der athenischen Bürgerschaft aufgaben: durch die mächtige Flotte, die seit Mitte der achtziger Jahre auf Anregung Themistokles´ gebaut wurde, die damit verbundene Führungsrolle im Kampf gegen die Perser zur See und kluge Bündnispolitik errang Athen die Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum. Aus einer relativ unbedeutenden polis mit kantonalem Horizont war die griechische Führungsmacht geworden. Bei nicht wenigen wird dieser Aufstieg in seiner Raschheit und auch seiner Unerwarteteit Fragen aufgeworfen haben, die Ausdruck eines ,,Sinnverlangens"10 nach den tieferen Gründen für den Sieg gegen die zahlenmäßig vielfach überlegene persische Streitmacht sind sowie nach Begründung der athenischen Vormacht über andere Griechenstädte und schließlich der Vermittlung des höchstrationalen Vorgehens bei der Schlacht mit religiösen Vorstellungen.
Werden die ,,Perser" als Ausdruck dieses ,,Sinnverlangens" genommen und auf mögliche Antworten darauf gelesen, offenbaren sie eine Fülle von Details, die diese Beobachtung stützen und im folgenden kurz skizziert werden sollen.
Schon im Parodos (Einzugslied) des Chores der Alten wird ein deutliches Ungleichgewicht in der Schilderung der griechischen und persischen Truppen deutlich: während für die persische Seite eine Vielzahl von Namen von Heerführern genannt wird11, fallen weder die Namen der griechischen Führer, noch wird neben Athen eine andere griechische Stadt benannt. Dagegen wird immer wieder die Einheit der Griechen betont und gleichzeitig der Anteil der Athener am Sieg deutlich akzentuiert.
Athen ist gezeichnet als Schlüssel zu ganz Griechenland, wie der kurze Dialog zwischen Chor und Atossa zeigt: ,, Atossa: Wo auf der Erden liegt Athen?
Chor: Fern im Westen, nah dem Untergang des Herrschers Helios. Atossa: Dennoch trägt mein Sohn Verlangen nach dieser Stadt? Chor: Wäre alsdann doch ganz Griechenland dem König untertan!"12
Dabei führt der Chor die Größe Athens nicht so sehr auf die bloße Zahl seiner Truppen sondern ihre Qualität und den Reichtum an Silber sowie die Stattsform der isonomen polis zurück, die es den Athenern ermöglichte schon gegen Dareios´ Heer bei Marathon zu siegen13.
Aischylos erwähnt auch in dem folgenden Botenbericht über den Verlauf der Schlacht die Leistungen Athens mehrfach und stellt so damit deutlich die Vormachtstellung Athens in der griechischen Streitmacht heraus.
Dass ein solches Bild Athens dazu angetan war, das Selbstbewußtsein der athenischen Bürgerschaft zu stärken und dem eigenen Selbstbild einen bestärkenden Spiegel vorzuhalten, also die Rechtmäßigkeit des Vormachtanspruches Athens gegen innere und äußere Zweifel zu behaupten, liegt auf der Hand.
Das unterstützend läßt Aischylos auch keinen Gegensatz zwischen Griechen und Persern aus, um die griechische Eigenart zu betonen und so den griechisch-persischen Gegensatz deutlich hervortreten zu lassen: dem persischen Bogen wird die dorische Lanze gegenübergestellt (obwohl 472 längst auch griechische Kämpfer den Bogen benutzten), dem persischen Großreich als Monarchie die griechische polis als Isonomie bzw. Demokratie; und schließlich konfrontiert er das Bild von der griechische Seemacht mit dem der persischen Landmacht14. Auch wenn diese Gegensätze nicht immer der historischen Wahrheit entsprechen, so dienen sie dem dramatischen Ziel, den Versuch der Perser, die Griechen in einer Seeschlacht zu besiegen als persönliche Hybris des Königs Xerxes darzustellen. Nur weil Xerxes den Hellespont mit einer Schiffsbrücke überquerte und damit den Anspruch Poseidon beherrschen zu wollen zeigte, traf ihn den Zorn der Götter.
Um diesen Umstand auch dramatisch fruchtbar zu machen, zögert Aischylos die Rückkehr von Xerxes bis kurz vor Schluss der Tragödie hinaus und setzt davor die Beschwörung des toten Dareios, seines Vaters durch den Chor der persischen Alten um Rat zu fragen,nachdem sie die Kunde von der Niederlage erhalten haben. Dramatisch ist diese Beschwörung nicht unbedingt notwendig, weil schon Atossa mit den Worten ,,Wißt ihr doch gar wohl: mein Sohn ist ein bewundernswerter Mann, wenn es ihm glückt.
Schlägt´s fehl, so schuldet er dem Volk nicht Rechenschaft. Gerettet, herrscht er über dieses Land wie je."15
klar die innenpolitische Folgenlosigkeit der Niederlage vor Salamis benannt hat. Doch macht erst Dareios Xerxes´ Hybris dramatisch plausibel, weil er als Gegenbild zu seinem Sohn als besonnener, zu Lebzeiten stets erfolgreicher Feldherr gezeigt wird16, der aus seiner Position heraus die Fehler des Xerxes klar benennt. So hat Xerxes die Konfrontation mit den Griechen auch auf dem Meer gewagt, überbrückte den Hellespont um das Landheer schnell nach Griechenland bringen zu können und sich damit, von einem Daimon besessen, der Hybris schuldig gemacht, weil er zu Lande und zu Wasser den Angriff wagte. Zu Wasser mußte Persiens Streitmacht auch scheitern, weil sie auf ihr nicht gemäßem Terrain den Angriff wagte. Aischylos bietet also für den unerwarteten, wohl noch 472 unglaublich scheinenden Sieg der Griechen mehrere Erklärungen an. Zum einen die Tapferkeit und die List der Griechen unter Führung der Athener und andereseits Xerxes jugendliche17 Unberatenheit und den den Zorn der Götter gegen ihn, der durch die Überbrückung des Hellespont der Hybris anheimgefallen ist.
Damit wird der Sieg bei Salamis auch zum Ausdruck der göttlichen Macht, die die Welt ordnet und jeden bestraft, der über seinen angestammten Platz hinaus zu Dingen strebt, die ihm nicht gebühren.
Das kann auch als Warnung vor allzu leichtfertigem Umgang mit der neuen Macht Athens im Attisch-Delischen Seebund verstanden werden, drückt aber gleichzeitig auch das Funktionieren der tradierten Vorstellungen von göttlicher Gerechtigkeit aus, die Athen zur Verteidigung seiner angestammten Freiheit verhalf und den Sieg von Salamis für die athenischen Bürger erst verstehbar machten.
Darüber hinaus wird in diesem Kontext deutlich, wieso die Perser nicht als grundsätzlich von den Griechen verschiedene Menschen gezeigt werden sondern als Angehörige eines anderen Volkes, für die die göttliche Macht ebenso gilt und denen, solange sie ihren zugewiesenen Platz (und der liegt östlich des Halys!) nicht verlassen, die gleiche Existenzberechtigung zukommt wie den Griechen18.
4. Bezüge zu Themistokles und Schwierigkeiten der Interpretation
Während in Bezug auf die politische Tendenz der ,,Perser" wie sie im vorangegangenen dargestellt wurde mittlerweile weitgehende Einigkeit in der Forschung besteht19, so existiert die Kontroverse um den Bezug zu Themistokles weiterhin fort.
Dabei sieht eine Gruppe von Wissenschaftlern, vertreten von Podlecki und Davison, in den ,,Persern" eine deutliche Parteinahme für Themistokles und meint darin ein hauptsächliches Ziel der Aufführung auszumachen, während andere, wohl am entschiedensten István Hahn, dagegen argumentieren.
Themistokles stand 472 kurz vor seiner Ostrakisierung, war seit 479 nicht mehr Stratege, hatte nahezu allen innenpolitischen Einfluss eingebüßt und war vom Helden von Salamis zu einer vielumstrittenen und angefeindeten Person geworden. Der Widerspruch zu Kimons erfolgreicher Politik des Ausgleichs mit Sparta und der Konfrontation mit Persien tat ein übriges, um die Zustimmung zu seiner Politik in der Bürgerschaft trotz seiner Verdienste durch die wir vor allem durch Herodot wissen) am Tiefpunkt zu halten20. Vor diesem Hintergrund erscheint Davison und Podlecki die Annahme naheliegend, dass Aischylos mit seiner Tragödie Partei für Themistokles ergreift, dessen Verdienste um den Flottenbau und die Schlacht um Salamis die athenischen Bürger eher zum Dank verpflichteten. Gleichzeitig kann dann Aischylos Eintreten für Themistokles als eine deutliche Parteinahme für die radikale athenische Demokratie gesehen werden und damit gegen die konservative Politik Kimons21.
Als ein Beleg für diese These wird der indirekte Bezug auf die Silberbergwerke von Laureion22 als Grundlage des athenischen Reichtums gesehen. Das Silber wurde vor allem zur Finanzierung des Flottenbaus benutzt, den Themistokles als Stratege anregte und federführend begleitete, auch die Ausbeutung der Silbervorkommen von Laureion in großem Stil ging auf aeine Initiave zurück. Auch die ausführliche Schilderung der entscheidenden Kriegslist, mit der die Perser getäuscht wurden, durch den Boten wird als Indiz für eine Parteinahme zugunsten Themistokles gesehen. War er es doch, der die Idee dazu hatte23. Das völlige Fehlen einer namentliche Erwähnung Themistokles führt Davison dabei auf den Umstand zurück, dass Aischylos mit seinen Äußerungen sehr vorsichtig sein mußte, um nicht die Abneigung gegen Themistokles auch auf sich zu ziehen24.
Weitere Hinweise für obige These werden in der offenkundigen Anlehnung der Anfangsverse an Phrynichos ,,Phoinissai", die vier Jahre zuvor unter der Choregie Themistokles aufgeführt wurden, gesehen. Auch der Chorege der Erstaufführung der ,,Perser", der kaum 25jährige Perikles, wird mit der vermeintlichen Stellungnahme für Themistokles in Verbindung gebracht, galt er doch als Verehrer seiner Politik und ebenso radikaler Verfechter der Demokratie wie er25.
Die Gegner einer solchen stark an persönlichen politischen Aussagen Aischylos´ orientierten Deutung der ,,Perser", für die stellvertretend Istvan Hahns Argumentation skizziert werden soll, setzen mit ihrer Kritik besonders an den möglichen Beweggründen von Aischylos an, gerade für Themistokles Partei zu ergreifen.
Während in den ,,Persern" immer wieder die Einheit der Griechen beschworen wird, zugunsten des Bildes von dieser Einheit auf Namensnennungen weitgehend verzichtet wird, verfolgte Themistokles in den Jahen nach Salamis eine dieser Idee entgegengesetzte Politik, indem er den Mauerbau vorantrieb, um Athen besser gegen eine Invasion der Spartaner zu sichern und einen Ausgleich mit Persien anstrebte, also mit einem Konfrontationskurs zu Sparta einer Idee der Einheit aller Griechenstädte gegen die Perser zuwiderhandelte26. Dagegen verfolgte Kimon, der wichtigste innere Gegner Themistokles eine dem entgegengesetzte Politik der Konfrontation mit Persien und des Ausgleichs mit Sparta und entsprach damit eher dem von Aischylos gezeichneten Einheitsideal.
Auch der Bezug zu den ,,Phoinissai" erscheint in diesem Zusammenhang nicht als eine Geste, die primär als Referenz für Themistokles zu werten ist, weil Aischylos ,,zum Zeitpunkt der Aufführung der ,,Perser" 53 Jahre alt und ein viel zu souveräner Geist dazu [war], als dass er eine simple Paraphrase dargeboten hätte. Wollte Aischylos nicht grundsätzlich Neues sagen, hätte er die ,,Perser" nicht auf die Bühne gebracht."27
Grundsätzlich stellt sich bei Betrachtung dieser Auffassung die Frage, ob es sich bei der ,,Themistokles-Frage" um ein Hauptproblem der poltischen Aussage der ,,Perser" handelt, wie vor allem Podlecki unterstreicht, oder ob nicht vielmehr diese Frage nur einen Nebenaspekt der poltischen Tendenz der ,,Perser" betrifft. Je nach Akzentuierung der Fragestellung kommen die Forscher dabei zu sehr divergierenden Aussagen. Klar zu Tage getreten ist dabei aber, dass die Interpretation der ,,Perser" nicht nur detaillierte Kenntnis der Rezeptionssituationsondern auch der historischen Situation voraussetzt. Auch dann kann eine Heranziehung als Quelle lediglich ergänzenden Charakter zu bereits bestehenden Erkenntnissen haben, weil der Text allein in Bezug auf Themistokles kaum aussagekräftig ist und nur vage Hinweise liefert.
Innerhalb des in Kapitel drei entworfenen Bezugsrahmens muß die Themistokles-Frage als peripheres Problem erscheinen, aber angesichts der wenigen Zeugnisse aus der Zeit um 470 erscheint selbst die Heranziehung solch vager Hinweise wie den wenigen Zeilen der Tragödie gerechtfertigt. Die damit verbundene Unsicherheit der Erkenntnisse muss dabei ebenso in Kauf genommen werden, wie ihre Abhängigkeit vom jeweiligen historischen Verständnisrahmen, wie die Interpretation der fehlenden Nennung von Namen auf der griechischen Seite ebenso zeigt wie die Bewertung des Bezugs auf Phrynichos ,,Phoinissai".
5. Verwendete Literatur
Quelle
Aischylos: Die Perser. Übers. u. Hg. v. Emil Staiger. Stuttgart 1997. Sekundärliteratur
Davison, J.A.: Aeschylus and Athenian Politics 472-456 B.C.In: Ancient Society and Institutions. Studies presented to VICTOR EHRENBERG to his 75th Birthday.Oxford 1966. Goldhill, Simon: Battle narrative and Politics in Aeschylus´ Persae. In: The Journal of Hellenic studies 108. London 1988.
Hahn, István: Aischylos und Themistokles. Bemerkungen zu den "Persern".In: Aischylos und Pindar. Studien zu Werk und Nachwirkung. Hg. von Ernst Günther Schmidt. Berlin 1981. Latacz, Joachim: Einführung in die griechische Tragödie. Göttingen 1993. Lotze, Detlef: Griechische Geschichte. München 31999.
Meier, Christian: Die politische Kunst der griechischen Tragödie. Dresden 1990. Podlecki, A.J.: The political background of Aeschylean tragedy. Ann Arbor 1966. Schuller, Wolfgang: Griechische Geschichte. München 1995 (=Oldenbourg Grundriss der Geschichte 1).
[...]
1 1 Zumal Aischylos aller Wahrscheinlichkeit nach in Salamis mitgekämpft hat und das Stück nur acht Jahre nach der Schlacht uraufgeführt wurde.
2 1 vgl. Meier 1988, bes. S. 7-99
3 2 Die ,,Perser" stehen in der Trilogie als mittleres Stück zwischen ,,Phineus" und ,,Glaukos Potnieus". Das folgende Satyrspiel trägt den Titel ,,Prometheus Pyrkaieus". Von diesen anderen Stücken sind nur wenige kurze Fragmente geblieben, die nur vage Vorstellungen vom Inhalt vermitteln. Die Titel der Tragödien weisen jedoch zweifelsfrei auf Figuren aus dem Umfeld der Argonautensage.
4 1 Die nachfolgende Rekonstruktion der Rezeptionssituation bezieht sich auf das zeitliche Umfeld der Erstaufführung der ,,Perser". Spätere Entwicklungen bleiben unerwähnt, es wird allerdings in Rückgriff auf Meier und Latacz, denen die Darstellung im wesentlichen folgt, davon ausgegangen, dass einzelne Aspekte, für die erst Belege aus späterer Zeit vorhanden sind, schon damals ausgeprägt waren (Proagon, Theaterbau am Akropolissüdhang, etc.), insofern es keine dem widersprechenden früheren Zeugnisse gibt.
5 1 Zu diesem Problem, das sich grundsätzlich im Umgang mit jeder Textquelle zeigt, oft aber klarer zu Tage tritt, schreibt Joachim Latacz: ,,Texte sind Abbreviaturen von außertextlicher Realität. Man kann sie niemals ganz verstehen, wenn man ihre außertextliche Realität nicht mitsieht." (Latacz 1993, S. 18)
6 1 ,,Phobos" bedeutet soviel wie Furcht, In Entsetzen versetzt werden und ,,eleos" kann mit Schauder bzw. Erschrecken übersetzt werden.
7 2 Latacz, S. 66. Vgl. dazu auch Fuhrmann S. 155-176.
8 1 Vgl. dazu Hahn, S. 175 und Meier, S. 77.
9 2 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Konfrontation mit den Persern seit Salamis und Plataiai zwar an Schärfe und Intensität verloren (durch Wegfall der akuten Bedrohung und die weitgeihende Passivität der Perser in den 70er Jahren wegen innerer Probleme), doch noch immer latent durch Kimons antipersische Politik schwelte.
10 1 Meier, S. 86
11 1 vgl. Z. 21-58 und Z. 303- 330
12 1 Z. 231-234
13 1 Z. 236-244,
14 1 vgl. auch Goldhills Interpretation der o.g. Passage, die mit den zusammenfassenden Worten ,,This exchange, then, does not merely praise the Athenians but, more importantly, praises them through a series of oppositions that relate closely to the sense of Athenian ideology." schließt. (Goldhill, S. 191)
15 1 Z. 211-214
16 1 Dabei verschweigt Aischylos bewußt Tatsachen, die den konstruierten Gegensatz aufweichen würden oder verändert sie sogar. So singt der Chor in Zeile 865, dass Dareios nie den Halys, also den persisch-griechischen Grenzfluss übertreten hätte, was unwahr ist, ebenso wie die Tatsache, dass es unter Dareios keine militärischen Niederlagen gegeben hätte (vgl. Z. 863), wie Meier (S. 86ff.) feststellt.
17 2 Obwohl Xerxes 480 v. Chr. schon über 40 und damit keineswegs mehr jung war.
18 1 Dazu I.Hahn: ,,Und wenn die persische Despotie ihre natürlichen Schranken, das
asiatische Festland, überschreiten und das griechische Volk seiner freiheit berauben will, so ist das ein Zeichen von hybris, die zu Fall kommen muss." (Hahn, S. 179)
19 1 seit Erscheinen von Christian Meiers ,,Die politische Kunst der griechischen Tragödie" ist zu den ,,Persern" m. E. nichts dem dort Geschriebenen Widersprechendes publiziert worden.
20 1 vgl. zum Schicksal Themistokles´ nach 480 auch Lotze S.56f. , Schuller S. 31f. u. 119f. (Themistokles-Probleme in der Forschung) und Hahn S. 176ff.
21 1 vgl. Winnington-Ingram, S. 641f.
22 1 Z. 238
23 2 Zumindest steht es so bei Herodot.
24 3 Wie die Athener Bürger reagierten, wenn unliebsame bzw. unangenehme Dinge zu deutlich in einer Tragödie verarbeitet wurden, zeigt das Beispiel der Tragödie ,,Milets Fall" (frühe neunziger Jahre), für die ihr Dichter, wiederum Phrynichos, zu 1000 Grachmen Geldstrafe verurteilt wurde, weil damit zu sehr an eigenes Leid erinnert worden sei (vgl. Davison, S. 101f.).
25 1 vgl. Davison: ,,Unless the evidence has much deceived me, Pericles was at all times after his first appearance in political life an admirer of Themistocles" (S. 103).
26 1 Zu den Details: Hahn S. 176ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der "Perser" von Aischylos?
Die "Perser" von Aischylos ist eine Tragödie, die sich mit der Schlacht von Salamis und ihren Folgen auseinandersetzt. Sie betrachtet die Ereignisse aus der Perspektive des persischen Hofes in Susa, wobei das Stück die Niederlage der Perser und die damit verbundenen politischen und religiösen Implikationen thematisiert.
Warum ist die Rezeptionssituation der "Perser" wichtig?
Die Rezeptionssituation ist entscheidend, da die Tragödie für einen spezifischen Anlass (die Großen Dionysien), ein bestimmtes Publikum (die Athener Bürgerschaft) und einen bestimmten Raum (das Theater am Südhang der Akropolis) konzipiert wurde. Das Verständnis dieser Umstände ermöglicht es, die Tragödie als ein beredtes Zeugnis ihrer Zeit zu interpretieren, da sie nicht zum Lesen, sondern zum Ansehen und Anhören gemacht wurde.
Welche politische und religiöse Aussage wird in den "Persern" vermittelt?
Die Tragödie betont die Einheit der Griechen und die Vormachtstellung Athens im Kampf gegen die Perser. Sie stellt den griechisch-persischen Gegensatz heraus und interpretiert den Sieg der Griechen als Ausdruck göttlicher Macht, die die Welt ordnet und Hybris bestraft. Das Stück kann auch als Warnung vor allzu leichtfertigem Umgang mit der neuen Macht Athens verstanden werden.
Welche Rolle spielt Themistokles in der Interpretation der "Perser"?
Die Rolle von Themistokles ist umstritten. Einige Wissenschaftler sehen in den "Persern" eine Parteinahme für Themistokles und seine Politik, während andere dies ablehnen. Die Tragödie enthält indirekte Bezüge auf den Flottenbau und die Kriegslist von Themistokles, aber sein Name wird nicht explizit erwähnt. Die Bedeutung dieser Bezüge für die politische Aussage der Tragödie ist Gegenstand der Diskussion.
Inwiefern ist die Tragödie eine historische Quelle und welche Einschränkungen gibt es dabei?
Die "Perser" sind eine der ältesten schriftlichen Quellen zur Schlacht von Salamis und eine einzigartige Tragödie mit nichtmythischer Thematik. Die Auswertung als historische Quelle ist jedoch problematisch, da die künstlerischen Eigenheiten der Tragödie und ihr Rezeptionsumfeld berücksichtigt werden müssen. Die Tragödie kann lediglich ergänzenden Charakter zu bereits bestehenden Erkenntnissen haben, da der Text allein kaum aussagekräftig ist und nur vage Hinweise liefert.
Welche literarischen Quellen werden in der Analyse der "Perser" verwendet?
Aischylos: Die Perser. Übers. u. Hg. v. Emil Staiger. Stuttgart 1997.
Sekundärliteratur:
Davison, J.A.: Aeschylus and Athenian Politics 472-456 B.C.In: Ancient Society and Institutions. Studies presented to VICTOR EHRENBERG to his 75th Birthday.Oxford 1966.
Goldhill, Simon: Battle narrative and Politics in Aeschylus´ Persae. In: The Journal of Hellenic studies 108. London 1988.
Hahn, István: Aischylos und Themistokles. Bemerkungen zu den "Persern".In: Aischylos und Pindar. Studien zu Werk und Nachwirkung. Hg. von Ernst Günther Schmidt. Berlin 1981.
Latacz, Joachim: Einführung in die griechische Tragödie. Göttingen 1993.
Lotze, Detlef: Griechische Geschichte. München 31999.
Meier, Christian: Die politische Kunst der griechischen Tragödie. Dresden 1990.
Podlecki, A.J.: The political background of Aeschylean tragedy. Ann Arbor 1966.
Schuller, Wolfgang: Griechische Geschichte. München 1995 (=Oldenbourg Grundriss der Geschichte 1).
- Quote paper
- Michael Dühn (Author), 2000, Aischylos "Perser" als ältestes Zeugnis zur Schlacht von Salamis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97376