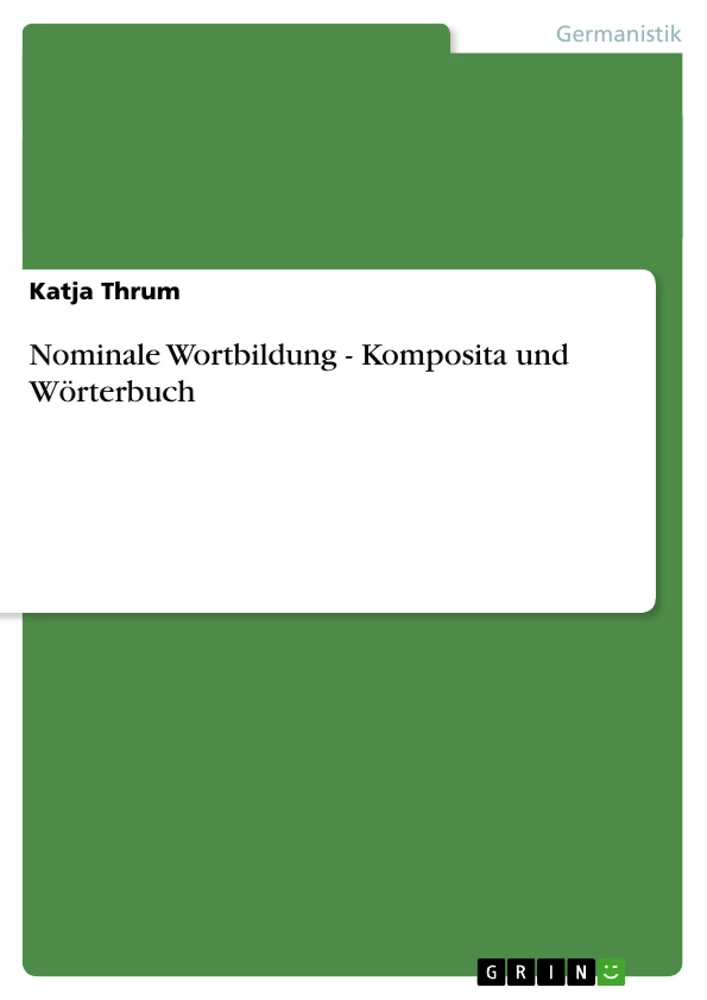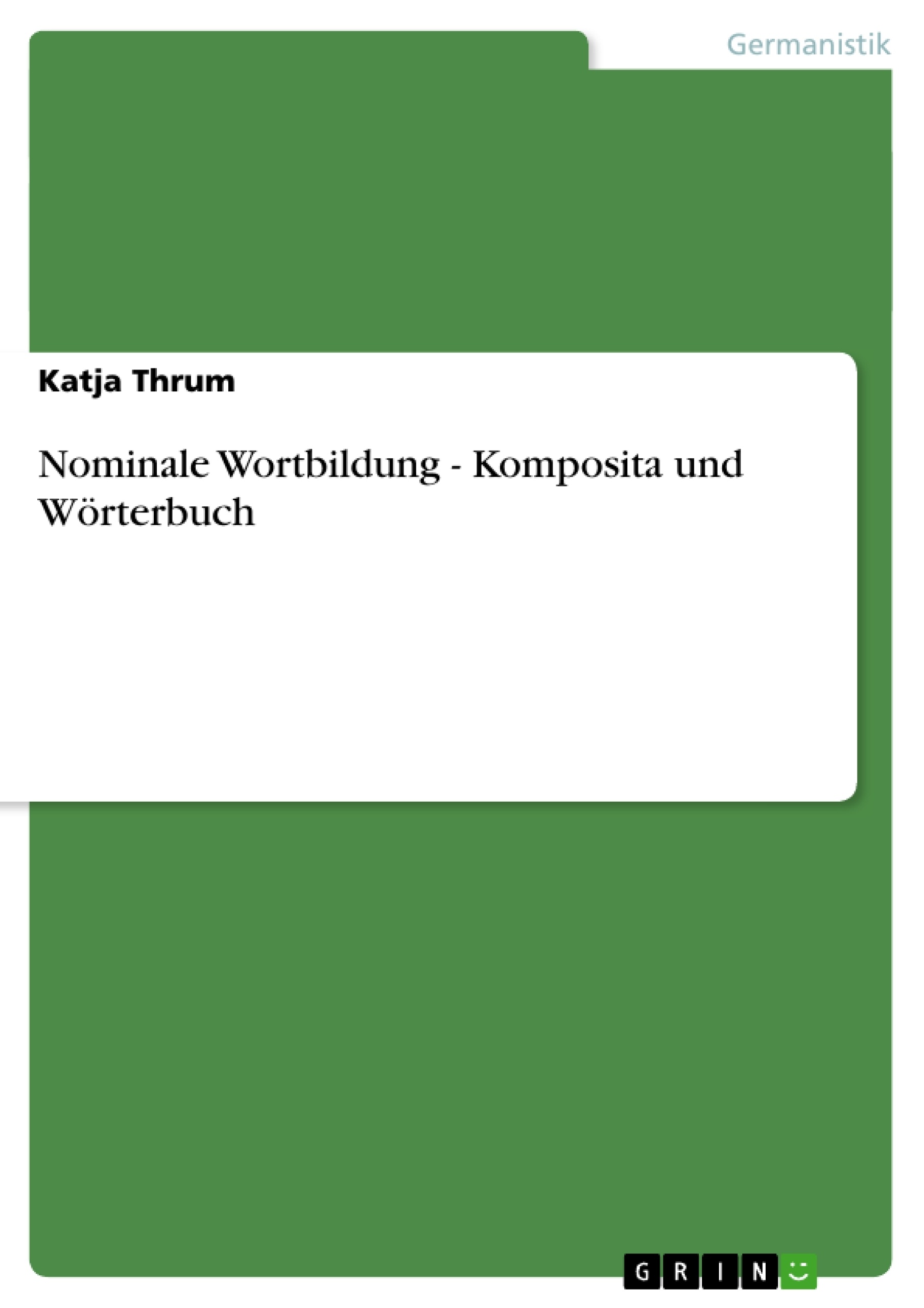Thema: Komposita und Wörterbuch
(zu Punkt 2 der Themenliste: Das Substantiv - Komposition und Allgemeines)
1. Komposita im Sprachgebrauch
- Komposita in unserem Sprachgebrauch können entweder aus dem Lexikon entnommen sein (lexikalisierte Komposita) oder ad-hoc gebildet worden sein (potentielle Komposita); im letzten Fall bilden sie entweder eine "Einheit auf beschränkte Dauer" oder sie werden in das Wörterbuch aufgenommen.
- Kürschner identifiziert lexikalisierte Komposita mit Hilfe eines Tests:
Und zwar mit Hilfe des Satztyps "(Ein-) AB sei (ein-) B"
- Komposita sind mehrdeutig.
- Bei häufigerem Gebrauch in einem bestimmten Zusammenhang mag sich eine der möglichen Interpretationen durchsetzen, was aber andere Verwendungen nicht ausschließen muß
2. Kriterien zur Auswahl der Lemmata in Wörterbüchern
- die Entscheidung darüber, welche Wortbildungen in ein Wörterbuch aufgenommen werden sollen, hängt zunächst von der angestrebten Gesamtzahl der Eintragungen ab.
- Mit der Gesamtzahl der Stichwörter steigt in der Regel nicht nur die absolute Zahl der verzeichneten Wortbildungen, sondern auch ihr prozentualer Anteil. Das gilt insbesondere für Zusammensetzungen, die im Deutschen den produktivsten Bereich der Wortbildung ausmachen. So sind im Buchstaben J beim TASCHEN-WB DT-POLN (mit rund 12000 Stichwörtern) über die Hälfte der Einträge Simplizia und weniger als ein Viertel Komposita; beim GROSSEn WB DT-RUSS (mit rund 160000 Stichwörtern) verhält es sich gerade umgekehrt. (Mugdan, S.241)
- Zwischen der Gesamtzahl der Stichwörter und dem Umfang des Wörterbuchs besteht kein unmittelbarer Zusammenhang. Daß man etwa in ULLSTEIN und WAHRIG-dtv wesentlich weniger Einträge (und speziell weniger Komposita) findet als in PEKRUN oder HERDER, liegt nicht an dem verfügbaren Platz, sondern an bewußten lexikographischen Entscheidungen
3. Kritik an der Auswahl dieser Lemmata
Die folgende Kritik bezieht sich auf 17 von Mugdan betrachtete Wörterbücher.
- Die meisten Wörterbücher bemühen sich um Quantität und legen dafür weniger Wert auf viel Information beim Einzelstichwort. Als erstrebenswert erscheint es, "den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache mit allen Ableitungen und Zusammensetzungen so vollständig wie möglich" zu erfassen, wie es im Vorwort von DUDEN-GWB heißt. Daß dieses Ziel völlig unerreichbar ist, wird schamhaft verschwiegen. Wieviel ehrlicher war da Jacob Grimm: "Die zusammensetzungsfähigkeit unserer sprache (...) ist so unermeszlich, dasz sich lange nicht alle hergebrachten, geschweige alle möglichen wortbildungen anführen lassen." (Mudgan, S.241)
- Die Auswahl der Lemmata kann nur teilweise durch ihre Häufigkeit erklärt werden.
- Es scheinen - wie in allen anderen Bereichen der Lexikographie weniger empirische Befunde als vielmehr weitgehend intuitive Urteile zu sein, die ein Wort "wörterbuchwürdig" machen.
- Aufnahmeprinzipien bei KLAPPENBACH/STEINITZ: "Aufgenommen sind alle Komposita, die als Ganzes einen neuen Bedeutungsgehalt bekommen haben, der aus den einzelnen Teilen nicht zu erschließen ist (z.B. Adamsapfel, Goldjunge). Es werden auch alle diejenigen aufgeführt, die wohl inhaltlich keine Schwierigkeiten bieten, die aber durch ihre Häufigkeit zum festen und typischen Wortschatz unserer Sprache gehören (z.B. Achsenbruch, Bühneneingang, Sporthemd). Ableitungen, die zwar gebildet werden können, aber kaum üblich sind, weden nicht aufgenommen (z.B. Abschickung, Allmählichkeit)."
- Aufnahmeprinzipien bei ULLSTEIN: "Zusammensetzungen, deren Bedeutung aus den aufgelösten Teilen eindeutig hervorgeht, wurden im allgemeinen weggelassen und nur dann gebracht, wenn besondere Gründe (z.B. semantischer Art) dies erforderten."
- Für DUDEN-GWB ist die Semantik irrelevant: "Das Wörterbuch will den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache vollständig erfassen. Es berücksichtigt aber nicht Individualsprachliches und keine Augenblicks- oder Situationsbildungen, d.h. Wörter, die jederzeit gebildet werden können, aber nicht fester Bestandteil unseres Wortschatzes sind, z.B. Autohimmel..."
- Einige Wörter kommen nicht als Lemma im Wörterbuch vor, werden jedoch im selben Wörterbuch zur Erklärung eines anderen Stichworts herangezogen. Z.B.: Lernjahr ist bei Machenstein in der Erklärung von Wanderjahre zu finden, wird aber im selben Wörterbuch nicht aufgenommen.
- Etymologische Hinweise zu Komposita sind in DUDEN-GWB und BROCKHAUS- WAHRIG in der Regel nicht vorgesehen und finden sich nur gelegentlich (etwa bei Jakobslilie, Jakobsmuschel, Johannisbeere, Johannisbrot...), während die Etymologie bei Simplizia stets genannt wird. Lediglich ULLSTEIN macht immer eine etymologische Angabe.
- Es ist auffällig, daß in manchen Wörterbüchern bestimmte Wortbildungen ohne jegliche semantische Information erscheinen, also als "Wortfriedhof".
- In all diesen Fällen steht das Prinzip der Ökonomie, unnötige Wiederholungen zu
vermeiden, gegen das Bedürfnis des Benutzers, unmittelbar beim Stichwort alle gewünschten Auskünfte zu bekommen.
- Fazit: Das Schlimme sind nicht "Lemmalücken", die man bei jedem Wörterbuch nach Belieben zu Tausenden aufzählen kann, sondern vielmehr die Tatsache, daß nirgends eine klare Vorstellung davon zu finden ist, worauf "Lexikalisierung" oder "Wörterbuchwürdigkeit" eigentlich beruhen soll, wenn nicht letztlich auf privater Intuition.
4. Empfehlungen zur Auswahl der Lemmata
- Eine Wortbildung sollte nur dann ins Wörterbuch aufgenommen werden, wenn die dazu gelieferte Information über Banales hinausgeht
- Die verzeichneten Wortbildungen sollten mit einer bestimmten Mindesthäufigkeit auftreten
- Die Interpretation von Komposita kann nicht losgelöst vom Kontext erfolgen
LITERATUR:
Fleischer, Wolfgang u. Barz, Irmhild: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen. 1992.
Herberth, Alfred: Neue Wörter: Neologismen in der deutschen Sprache seit 1945. Wien. 1977.
Kühn, Ingrid: Lexikologie: eine Einführung. Tübingen. 1994.
Kürschner, Wilfried: Zur syntaktischen Beschreibung deutscher Nominalkomposita. Tübingen. 1974.
Motsch, Wolfgang: Analyse von Komposita mit zwei nominalen Elementen. In: Lipka, L. (Hrsg.): Wortbildung.
Darmstadt.1981.
Mugdan, Joachim: Grammatik im Wörterbuch: Wortbildung. In: Germanistische Linguistik 1- 3.1983.
S.237-308.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgeführte Lexika (Mugdan, S.304ff):
BROCKHAUS-WAHRIG. Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden. Hrsg. Von Gerhard Wahrig, Hildegard Krämer, Harald Zimmermann. Wiesbaden. Stuttgart. 1980.
DAS GROSSE DEUTSCH-RUSSISCHE WÖRTERBUCH. Hrsg. von O.I. Moskal'Skaja. Moskau. 1969.
DUDEN. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden. Hrsg. Und bearb. Vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion unter Leitung von Günther Drosdowski. Mannheim/Wien/Zürich. 1965.
KLAPPENBACH/STEINITZ: Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Berlin. 1977. RICHARD PEKRUN: Neues deutsches Wörterbuch. Rechtschreibung. Sprachlehre. Erklärung des deutschen Wortschatzes. Köln.
TASCHENWÖRTERBUCH DEUTSCH-POLNISCH. Bearb. Von Ladislaus Jakowczyk und
Wilhelm Reinholz. Leipzig. 1979.
ULLSTEIN Lexikon der deutschen Sprache. Hrsg. u. bearb. Von Rudolf Köster unter Mitarbeit von H. Hahmann u.a. Frankfurt/Berlin. 1969.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über Komposita und Wörterbücher?
Dieser Text behandelt die Bildung und Verwendung von Komposita (zusammengesetzte Wörter) in der deutschen Sprache, insbesondere im Hinblick auf ihre Aufnahme in Wörterbücher. Es werden Kriterien für die Aufnahme von Lemmata (Stichwörter) in Wörterbücher diskutiert, die Kritik an der aktuellen Auswahl analysiert und Empfehlungen für eine verbesserte Lemmata-Auswahl gegeben.
Was sind Komposita und wie werden sie im Sprachgebrauch unterschieden?
Komposita sind zusammengesetzte Wörter. Im Sprachgebrauch unterscheidet man zwischen lexikalisierten Komposita (die bereits im Lexikon vorhanden sind) und ad-hoc gebildeten (potentiellen) Komposita. Letztere können entweder temporäre Bildungen sein oder dauerhaft in den Wortschatz aufgenommen werden.
Wie kann man lexikalisierte Komposita identifizieren?
Kürschner schlägt vor, lexikalisierte Komposita mit Hilfe des Satztyps "(Ein-) AB sei (ein-) B" zu identifizieren.
Warum sind Komposita mehrdeutig?
Komposita können mehrdeutig sein, da die Bedeutung der Zusammensetzung nicht immer eindeutig aus den einzelnen Bestandteilen hervorgeht.
Welche Kriterien beeinflussen die Auswahl von Lemmata in Wörterbüchern?
Die Entscheidung, welche Wortbildungen in ein Wörterbuch aufgenommen werden, hängt von der angestrebten Gesamtzahl der Eintragungen ab. Mit zunehmender Gesamtzahl der Stichwörter steigt in der Regel auch der Anteil der verzeichneten Wortbildungen, insbesondere von Komposita.
Was wird an der Auswahl der Lemmata in Wörterbüchern kritisiert?
Kritisiert wird, dass die Auswahl der Lemmata oft auf intuitiven Urteilen beruht und nicht immer durch empirische Befunde oder Häufigkeit im Sprachgebrauch gerechtfertigt ist. Außerdem wird bemängelt, dass einige Wörter nicht als Lemma geführt werden, aber zur Erklärung anderer Stichwörter verwendet werden.
Welche Aufnahmeprinzipien werden in verschiedenen Wörterbüchern angewendet?
Klappenbach/Steinitz nehmen Komposita auf, die als Ganzes einen neuen, nicht aus den Teilen erschließbaren Bedeutungsgehalt haben oder die häufig und typisch für den Wortschatz sind. ULLSTEIN lässt Zusammensetzungen weg, deren Bedeutung eindeutig aus den Teilen hervorgeht, es sei denn, es gibt besondere semantische Gründe. DUDEN-GWB will den Wortschatz vollständig erfassen, berücksichtigt aber keine Individualsprachliches oder Augenblicksbildungen.
Welche Empfehlungen werden für eine verbesserte Lemmata-Auswahl gegeben?
Empfohlen wird, eine Wortbildung nur dann ins Wörterbuch aufzunehmen, wenn die dazu gelieferte Information über Banales hinausgeht und die verzeichneten Wortbildungen mit einer bestimmten Mindesthäufigkeit auftreten. Es wird betont, dass die Interpretation von Komposita kontextabhängig ist.
Warum werden etymologische Hinweise zu Komposita in Wörterbüchern oft vernachlässigt?
Etymologische Hinweise zu Komposita werden oft vernachlässigt, da der Fokus eher auf der aktuellen Bedeutung und Verwendung der Wörter liegt und die etymologische Herleitung komplexer sein kann als bei Simplizia. Einige Lexika setzen auf Ökonomie, um Wiederholungen zu vermeiden.
Was ist das Fazit des Textes bezüglich der Lemmalücken in Wörterbüchern?
Das Fazit ist, dass die "Lemmalücken" weniger das Problem sind, als vielmehr die fehlende klare Vorstellung davon, worauf "Lexikalisierung" oder "Wörterbuchwürdigkeit" eigentlich beruhen soll, wenn nicht auf privater Intuition.
Welche Literatur wird in diesem Text zitiert?
Der Text zitiert Werke von Fleischer/Barz, Herberth, Kühn, Kürschner, Motsch und Mugdan sowie verschiedene Lexika wie BROCKHAUS-WAHRIG, DAS GROSSE DEUTSCH-RUSSISCHE WÖRTERBUCH, DUDEN-GWB, KLAPPENBACH/STEINITZ, RICHARD PEKRUN, TASCHENWÖRTERBUCH DEUTSCH-POLNISCH, ULLSTEIN Lexikon und WAHRIG-dtv.
- Quote paper
- Katja Thrum (Author), 1998, Nominale Wortbildung - Komposita und Wörterbuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97265