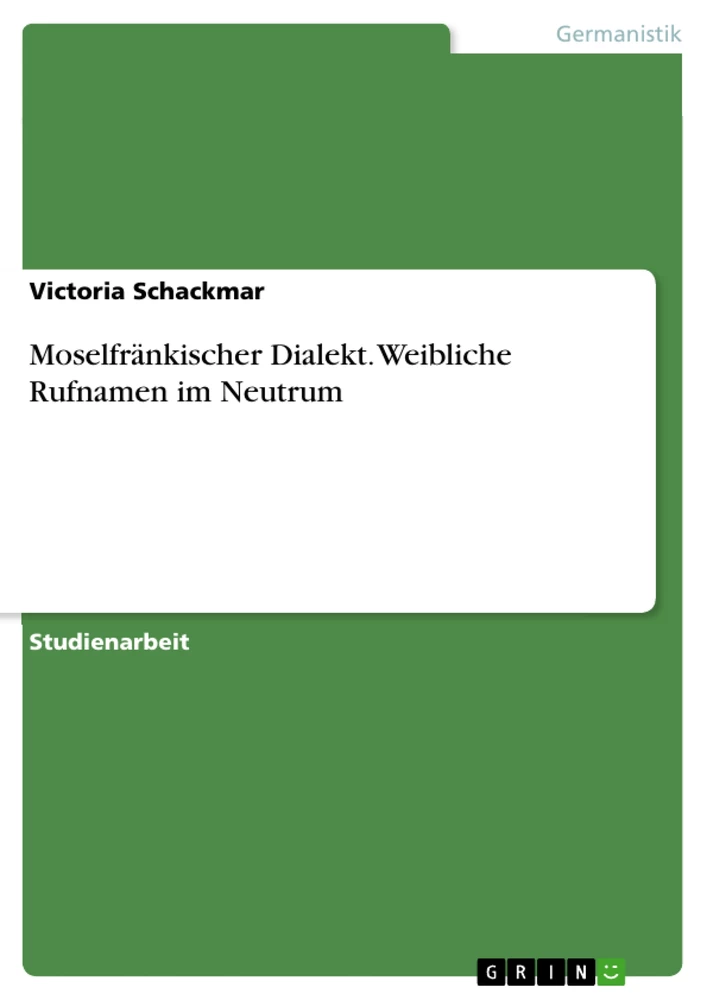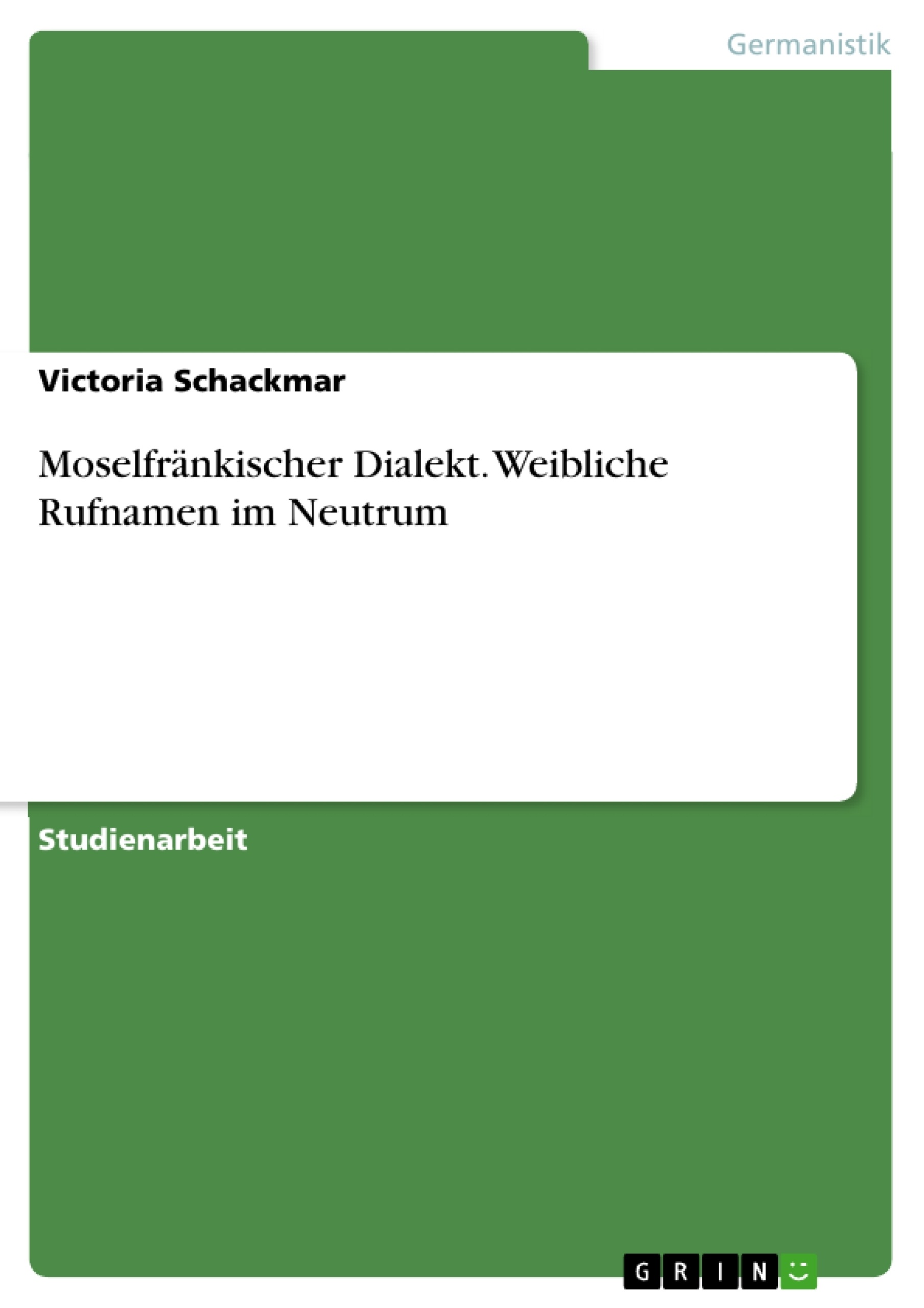In dieser Arbeit wird mithilfe eines Umfragebogens der Moselfränkische Dialekt des Saarlands bezüglich der Verwendung neutraler Artikel und Pronomen in Bezug auf Frauennamen untersucht. Da sowohl weibliche als auch neutrale Formen auftreten können, soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, welche Artikel und Pronomen verwendet werden und von welchen Faktoren die Auswahl abhängt.
Hierzu wird zunächst das derzeitige Verbreitungsgebiet der neutralen Frauennamen im Allgemeinen betrachtet, um den Fokus anschließend auf das Moselfränkische des Saarlands zu legen. Anschließend soll geklärt werden, wie es geschichtlich dazu kam, dass gerade Frauennamen von der "Neutralisierung" betroffen sind, während Männernamen davon in der Regel unberührt bleiben. Da es einen Wandel der Funktion der Femineutra vom sozialen Platzanzeiger hin zum Beziehungsanzeiger gegeben zu haben scheint, soll dieser im vierten Kapitel erläutert werden. An die Theorie soll anschließend die Studie geknüpft werden, die sich auf die Namenneutra im moselfränkischen Sprachgebrauch des Saarlands fokussiert. Die Ergebnisse werden mit der vorangegangenen Theorie abgeglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verbreitung in deutschen Dialekten
- Entstehung des sprachlichen Phänomens
- Funktionswandel des Genus
- Genus als sozialer Platzanzeiger
- Genus als Beziehungsanzeiger
- Methode
- Ergebnisse
- Diskussion
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung neutraler Artikel und Pronomen im Bezug auf Frauennamen im Moselfränkischen Dialekt des Saarlands. Ziel ist es, zu klären, welche Artikel und Pronomen verwendet werden und von welchen Faktoren die Auswahl abhängt. Die Arbeit beleuchtet die Verbreitung des Phänomens der „Femineutra“ in deutschen Dialekten und die geschichtliche Entwicklung dieses sprachlichen Merkmals.
- Verbreitung von Namenneutra in deutschen Dialekten
- Geschichtliche Entstehung der „Neutralisierung“ weiblicher Rufnamen
- Funktionswandel des Genus von sozialem Platzanzeiger zu Beziehungsanzeiger
- Empirische Untersuchung der Namenneutra im Moselfränkischen Dialekt des Saarlands
- Analyse der Faktoren, die die Genuswahl beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Verwendung neutraler Artikel vor weiblichen Rufnamen in deutschen Dialekten ein. Sie beschreibt das Genus-Sexus-Prinzip und dessen Ausnahmen, fokussiert auf das Phänomen der „Femineutra“ und deren Verbreitung, insbesondere im Moselfränkischen Dialekt des Saarlands. Die Arbeit skizziert die Forschungsfrage und die Methodik, wobei die Untersuchung der Faktoren, die die Genuswahl beeinflussen, im Mittelpunkt steht. Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende Analyse, die die Verbreitung, Entstehung und den Funktionswandel dieses sprachlichen Phänomens beleuchtet.
Verbreitung in deutschen Dialekten: Dieses Kapitel beschreibt die geografische Verbreitung des Phänomens, dass weibliche Vornamen mit neutralen Artikeln verwendet werden (z.B. "das Anna"). Es wird deutlich, dass diese Spracherscheinung vor allem im Westen Deutschlands, insbesondere im Saarland und Rheinland-Pfalz, aber auch in angrenzenden Regionen verbreitet ist. Der Vergleich mit der Deutschschweiz und Luxemburg zeigt regionale Unterschiede in der Anwendung und der Ausprägung des Phänomens. Die Kapitel veranschaulicht die Verbreitung mittels einer Karte, die die verschiedenen Artikelformen im deutschsprachigen Raum veranschaulicht, und betont die regionale Konzentration, insbesondere im Saarland.
Schlüsselwörter
Moselfränkischer Dialekt, weibliche Rufnamen, Neutrum, Genus-Sexus-Prinzip, Namenneutra, Sprachwandel, Dialektgeographie, soziolinguistische Faktoren, empirische Untersuchung, Artikelwahl.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Neutrale Artikel und Pronomen bei Frauennamen im Moselfränkischen Dialekt des Saarlands"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung neutraler Artikel und Pronomen (z.B. "das Anna", "es") vor weiblichen Vornamen im Moselfränkischen Dialekt des Saarlands. Sie beleuchtet die Verbreitung dieses Phänomens ("Femineutra" oder "Namenneutra"), seine geschichtliche Entwicklung und die Faktoren, die die Wahl des Artikels beeinflussen.
Welche Dialekte werden betrachtet?
Der Fokus liegt auf dem Moselfränkischen Dialekt des Saarlands. Die Arbeit vergleicht jedoch auch die Verbreitung des Phänomens mit anderen deutschen Dialekten, insbesondere im Westen Deutschlands (Rheinland-Pfalz) und angrenzenden Regionen, sowie der Deutschschweiz und Luxemburg, um regionale Unterschiede aufzuzeigen.
Was sind "Femineutra" oder "Namenneutra"?
„Femineutra“ oder „Namenneutra“ bezeichnen die Verwendung neutraler Artikel (das/es) vor weiblichen Vornamen, obwohl das grammatikalische Geschlecht (Genus) eigentlich feminin ist. Die Arbeit analysiert, warum und unter welchen Umständen diese grammatikalische Abweichung auftritt.
Welche Fragen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die Verbreitung der Namenneutra in verschiedenen Dialekten, ihre geschichtliche Entstehung, den Funktionswandel des grammatischen Geschlechts (von sozialem Platzanzeiger zu Beziehungsanzeiger) und die soziolinguistischen Faktoren, die die Artikelwahl beeinflussen. Eine empirische Untersuchung im Moselfränkischen Dialekt des Saarlands liefert konkrete Daten.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit beschreibt ihre Methodik im Detail in einem eigenen Kapitel. Es beinhaltet die empirische Untersuchung des Phänomens im Moselfränkischen Dialekt des Saarlands, die Analyse der gesammelten Daten und die Auswertung der Faktoren, die die Genuswahl beeinflussen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Verbreitung in deutschen Dialekten, Entstehung des sprachlichen Phänomens, Funktionswandel des Genus (inkl. Genus als sozialer Platzanzeiger und Genus als Beziehungsanzeiger), Methode, Ergebnisse, Diskussion und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Moselfränkischer Dialekt, weibliche Rufnamen, Neutrum, Genus-Sexus-Prinzip, Namenneutra, Sprachwandel, Dialektgeographie, soziolinguistische Faktoren, empirische Untersuchung, Artikelwahl.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung im Moselfränkischen Dialekt des Saarlands werden im entsprechenden Kapitel detailliert dargestellt und analysiert. Diese Ergebnisse belegen die Verbreitung der Namenneutra und geben Aufschluss über die Faktoren, die die Genuswahl beeinflussen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen fassen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und diskutieren die Bedeutung der Ergebnisse im Kontext des Sprachwandels und der soziolinguistischen Forschung. Es wird ein Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbreitung, Entstehung und den Funktionen der Namenneutra gegeben.
- Quote paper
- Victoria Schackmar (Author), 2020, Moselfränkischer Dialekt. Weibliche Rufnamen im Neutrum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/972640