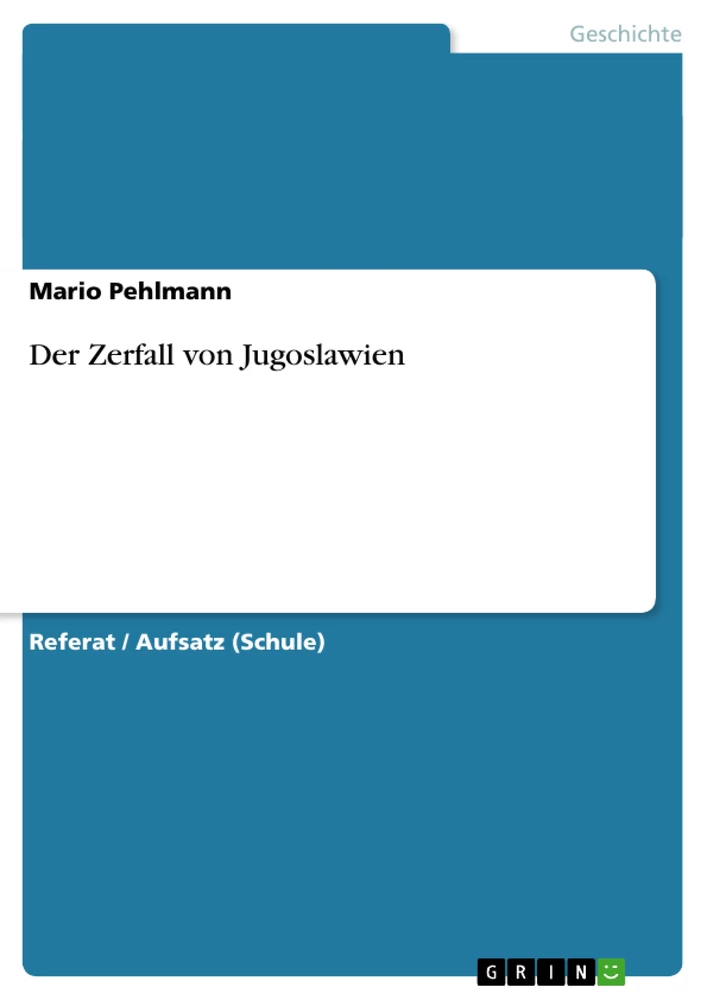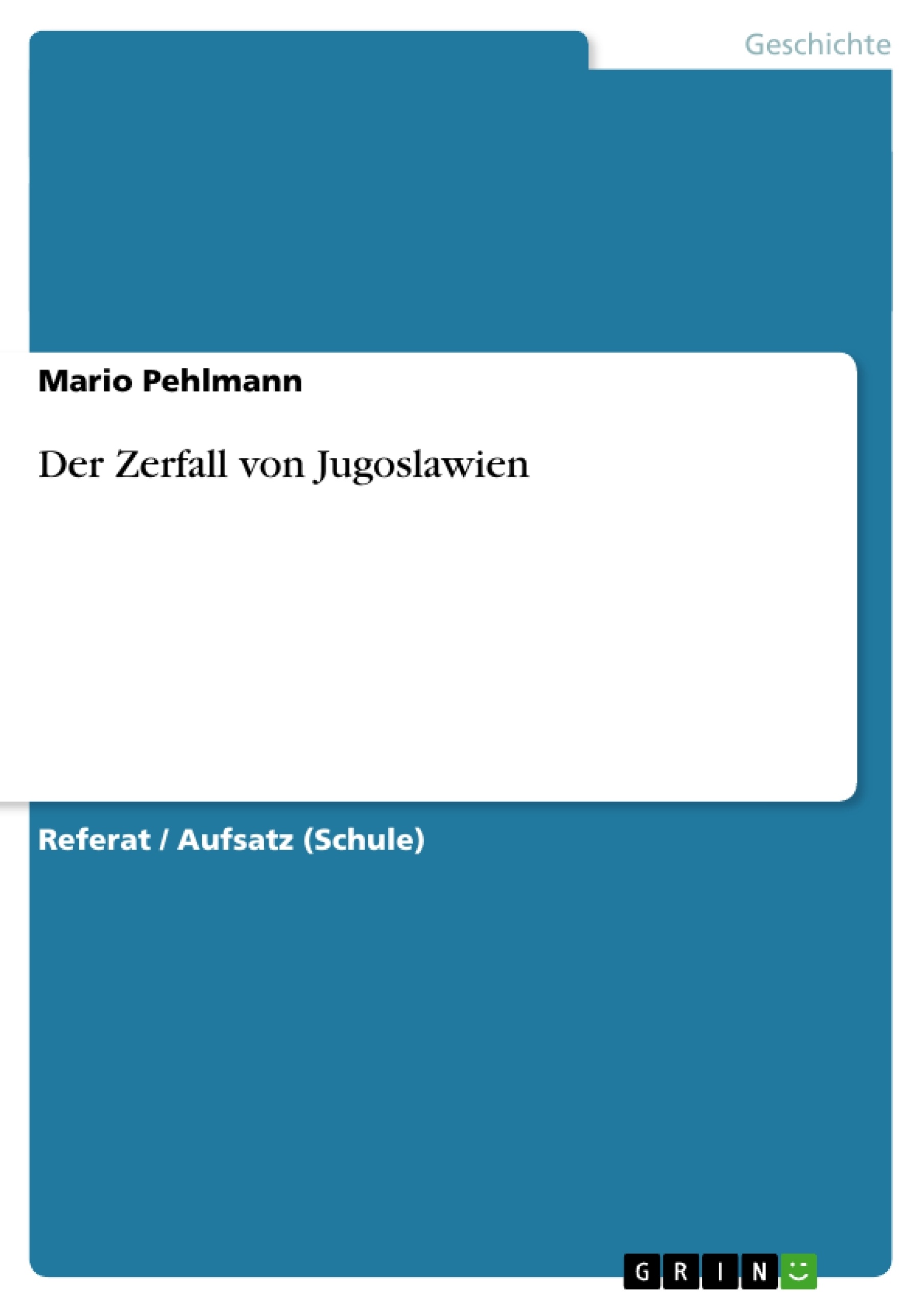Ein Vielvölkerstaat im Herzen Europas – Jugoslawien: Wie konnte ein Land, das einst für Einheit und brüderliche Verhältnisse stand, in blutigen Konflikten und schließlich im Zerfall enden? Diese packende Analyse beleuchtet die komplexen historischen, politischen und gesellschaftlichen Kräfte, die zum Untergang Jugoslawiens führten. Beginnend mit dem brisanten Attentat von Sarajevo, das den Ersten Weltkrieg auslöste, verfolgt der Autor die wechselvolle Geschichte des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen, seine Transformation in die sozialistische Föderative Republik unter Tito und die unaufhaltsamen Prozesse, die nach seinem Tod die ethnischen Spannungen neu entfachten. Im Fokus stehen die Machtbestrebungen nationalistischer Eliten, allen voran Slobodan Milošević, die den Traum eines geeinten Jugoslawiens durch den Ruf nach einem Großserbien zunichte machten. Detailliert werden die Unabhängigkeitserklärungen Sloweniens und Kroatiens, die blutigen Kriege in Bosnien und Herzegowina sowie die massiven Menschenrechtsverletzungen, insbesondere die ethnischen Säuberungen, geschildert. Das Buch analysiert die Rolle internationaler Akteure, das Versagen der Diplomatie und die Tragödie eines Landes, dessen Zerrissenheit bis heute tiefe Wunden hinterlassen hat. Eine Auseinandersetzung mit den Ursachen und Folgen des Jugoslawienkrieges, die nicht nur historisch informiert, sondern auch aktuelle Fragen nach nationaler Identität, Konfliktbewältigung und dem fragilen Frieden auf dem Balkan aufwirft. Für Leser, die die Hintergründe des Zerfalls Jugoslawiens verstehen und die Lehren aus dieser tragischen Epoche ziehen möchten, ist dieses Buch eine unverzichtbare Lektüre. Es bietet einen umfassenden Überblick über die politischen Intrigen, die militärischen Auseinandersetzungen und das menschliche Leid, das mit dem Zerfall Jugoslawiens einherging. Eine Mahnung, die Bedeutung von Dialog, Toleranz und gegenseitigem Respekt in einer Welt, die von Vielfalt und Unterschiedlichkeit geprägt ist, niemals zu vergessen. Die Konflikte, die zur Auflösung Jugoslawiens führten, sind ein mahnendes Beispiel für die Gefahren von Nationalismus und ethnischer Intoleranz.
Der Zerfall von Jugoslawien
Jugoslawien, die frühere sozialistische föderative Republik in Mittel- und Südosteuropa bestand aus den heute selbständigen Staaten Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien (mit den ehemals autonomen Provinzen Kosovo und Vojvodina) und Slowenien. Die Staatsfläche betrug etwa 255000 km², Hauptstadt war Belgrad. Jugoslawien wurde von Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Albanien und der Adria begrenzt.
Im 20. Jahrhundert wurde der serbische König Alexander I. Obrenovic 1903 ermordet und durch Peter I. Karaooroevic ersetzt. Dieser entzog Serbien dem österreichisch-ungarischen Einfluss, und unter ihm wurde wieder die Idee eines südslawisch-serbischen Staates entwickelt.
1907 forderten serbische Nationalisten , die ein großserbisches Reich errichten wollten, den Anschluss Bosniens an Serbien. Österreich eroberte daraufhin Bosnien und Herzegowina und provozierte damit eine Verschärfung des Gegensatzes zu Serbien. Als das osmanische Reich wegen innerer Unruhen, Aufständen in Albanien und dem Krieg gegen Italien geschwächt war, schlossen sich Serbien und Bulgarien 1912 zum Balkanbund gegen das Osmanische Reich zusammen. Griechenland und Montenegro traten dem Bündnis ebenfalls bei.
Aus dem ersten Balkankrieg zwischen der Türkei und den Mitgliedern des Balkanbundes ging das Bündnis als Sieger hervor. Gestärkt durch den Sieg forderte Serbien einen Zugang zur Adria, der aber von Italien und vor allem von Österreich-Ungarn verwehrt wurde, was die Feindschaft zwischen Serbien und Österreich-Ungarn noch vertiefte. Das Osmanische Reich mußte im Frieden von London alle Gebiete westlich der Linie Enos-Midia abtreten. In der Auseinandersetzung um die teritoriale Neuordnung des Balkans griff Bulgarien nun im zweiten Balkankrieg 1913 Serbien an, das von Rumänien, Montenegro, Griechenland und der Türkei unterstützt wurde.
Der Friede von Bukarest entspannte die Lage nicht, da Serbien der Zugang zur Adria weiterhin verwehrt blieb und die Fronten auf dem Balkan verfestigten.
Die instabile Lage wurde schlimmer, als am 28. Juni 1914 ein serbischer Nationalist den österreichischen Tronfolger Franz Ferdinand und dessen Frau Sophie in Sarajevo erschoß. Daraufhin erklärte Österreich-Ungarn nach Ablauf eines Ultimatums Serbien am 28. Juli 1914 den Krieg. Daraus entstand der erste Weltkrieg. Nach dem Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Doppelmonarchie am Ende des ersten Weltkrieges bildet sich aus Serbien, Montenegro und den ehemals österreichisch-ungarischen Gebieten Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina 1918 das "Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen" unter Alexander I. Das neue Königreich zeichnete sich durch eine großserbische Einheit aus. Der Autonomiegedanke hinsichtlich nichtserbischer Kultur- und Lebensgemeinschaft einer Volksgruppe und anderer Religionen blieb weitgehend unbeachtet, die ethnischen und religiösen Spannungen blieben bestehen und verschärften sich z.T. noch. Am 6. Januar 1929 hob Alexander I. die Verfassung auf und benannte den Staat in "Königreich Jugoslawien" um.
Nach der Besetzung Jugoslawiens durch deutsche Truppen im April 1941 während des 2. Weltkrieges bildeten sich verschiedene Widerstandsbewegungen, deren stärkste die der Kommunisten unter dem Kroaten Josip Broz, genannt Tito, war. In Kroatien errichtete die faschistische Ustascha (rechtsradikale Bewegung in Kroatien) unter deutschem Schutz den "Unabhängigen Staat Kroation". Die Ustascha betrieb eine brutale Politik der "ethnischen Säuberung", auf die Tito mit ähnlichen Mitteln reagierte. Im November 1943 errichtete der "Antifaschistische Rat zur Nationalen Befreiung Jugoslawiens" (AVNOJ) unter dem Vorsitz Titos eine provisorische Regierung, die von den Alliierten unterstützt wurde.
Am 10. August 1945 wurde der AVNOJ in ein provisorisches Parlament umgewandelt, das mit Gesetzen zur Bodenreform die wirtschaftliche und soziale Umstrukturierung des Landes einleitete. Die Wahlen zur Verfassung gebenden Versammlung gewann am 11. November 1945 Titos kommunistische Volksfront mit deutlicher Mehrheit, und am 29. November rief die Verfassung gebende Versammlung die Republik aus. Unter der neuen Verfassung wurde Jugoslawien in die Föderative Volksrepublik Jugoslawien umgewandelt; Bosnien und Herzegowina bildeten eine "Volksrepublik" innerhalb der Föderation, die 1963 in "Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien" umbenannt wurde. Gleichzeitig mit der Umbenennung wurden Bosnien und Herzegowina, Kroation, Slowenien, Serbien, Montenegro und Makedonien sozialistische Republiken.
1948 kam es zwischen der Sowjetunion und dem Ostblockstaat Jugoslawien zum Bruch, da Tito als Staatschef Jugoslawiens einen eigenen, von nationalem Bewustsein geprägten Kommunismus und ein eigenes Sozialismusmodell entwickelt hatte und sich die Ein- mischung der Sowjetunion in die inneren Angelegenheiten Jugoslawiens verbat. Tito näherte sich den blockfreien Staaten (lockerer Zusammenschluß von Staaten, die während des kalten Krieges keinem der beiden von den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion angeführten Machtblöcken angehörten)an, hielt gute Kontakte zum Westen und verfolgte insgesamt nach Innen und Außen einen unabhängigen Kurs.
Obwohl Jugoslawien formal ein sozialistischer Bundesstaat war, dominierten doch in Partei, Wirtschaft und Armee die Serben. Es kam wiederholt zu ethnischen Spannungen, denen u.a. durch den Ausbau von Föderalismus und Selbstverwaltung in der Ver- fassung von 1974 entgegengewirkt werden sollte.
Nach dem Tod Titos am 4. Mai 1980 übernahm das Präsidium der Republik die Regierungsgeschäfte. Die acht Mitglieder setzten sich aus je einem Vertreter der sechs Teilrepubliken und der zwei autonomen Provinzen zusammen. Nach dem Tod Titos, der dank seiner integrativen Persönlichkeit den Vielvölkerstaat zusammengehalten hatte, traten die alten Rivalitäten zwischen den Ethnien wieder stärker hervor, und die Bundesstaaten forderten ein stärkeres Mitspracherecht in der von Serben dominierten Zentralregierung.
1980 kam es zunächst zu Unruhen im Kosovo. Wie die nördliche Vojvodina war der überwiegend von Albanern bewohnte Kosovo 1974 als autonome Provinz den sechs Republiken gleichgestellt worden. Demonstrationen der albanisch-muslimischen Bevölkerung für die Unabhängigkeit wurden von Sondereinheiten der Polizei gewaltsam aufgelöst. Als die Serben versuchten, die Autonomie des Kosovo einzuschränken, verschlechterten sich die Beziehungen der einzelnen Republiken zueinander. 1989 verweigerte Slowenien, das sich auf die Seite des Kosovo gestellt hatte, Zahlungen an die jugoslawische Bundeskasse, worauf Serbien einen Handelsboykott gegen Slowenien verhängte.
Die Bestrebungen Kroatiens und Sloweniens nach staatlicherUnabhängigkeit wider- sprachen den Plänen des serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic, der ein groß- serbisches, zentralistisches Reich verwirklichen wollte. Als im Juni 1991 nach ver- schiedenen erfolglosen innerjugoslawischen Gipfeltreffen Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit erklärten, war die Jugoslawische Republik faktisch aufgelöst.
Die Auflösung Jugoslawiens war begleitet von massenhaften Menschenrechts- verletzungen. Hierzu gehörten insbesondere die ethnischen Säuberungen. Den größten Anteil an solchen Untaten hatten die von Serben dominierte "Jugoslawische Volksbefreiungsarmee" und die serbischen Milizen. Die kroatischen und bosnisch- muslimischen Kräfte hielten sich aber auch nicht an die internationalen Normen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Kontext des Zerfalls von Jugoslawien?
Jugoslawien war eine sozialistische Föderative Republik in Mittel- und Südosteuropa, bestehend aus den heutigen Staaten Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien (mit Kosovo und Vojvodina) und Slowenien. Im 20. Jahrhundert führten serbische Nationalisten und territoriale Konflikte zu Spannungen und letztendlich zum Ersten Weltkrieg, der zum Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Doppelmonarchie führte. Daraus entstand 1918 das "Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen", das später in "Königreich Jugoslawien" umbenannt wurde. Die Einheit war aber nur vordergründig, da ethnische und religiöse Spannungen fortbestanden.
Welche Rolle spielte der Zweite Weltkrieg beim Zerfall Jugoslawiens?
Nach der Besetzung Jugoslawiens durch deutsche Truppen im April 1941 bildeten sich Widerstandsbewegungen, darunter die kommunistische unter Josip Broz Tito. In Kroatien etablierte die Ustascha ein faschistisches Regime, das eine brutale Politik der "ethnischen Säuberung" betrieb, auf die Tito mit ähnlichen Mitteln reagierte. Nach dem Krieg wurde Jugoslawien unter Tito zu einer Föderativen Volksrepublik und später zur Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien.
Welche Faktoren führten nach Titos Tod zum Zerfall Jugoslawiens?
Nach Titos Tod 1980, der den Vielvölkerstaat zusammengehalten hatte, traten die ethnischen Rivalitäten wieder stärker hervor. Die Bundesstaaten forderten mehr Mitspracherecht in der von Serben dominierten Zentralregierung. Es kam zu Unruhen im Kosovo und zu Konflikten zwischen den Republiken. Slobodan Milosevic's Plan für ein großserbisches, zentralistisches Reich widersprach den Unabhängigkeitsbestrebungen von Slowenien und Kroatien, die im Juni 1991 ihre Unabhängigkeit erklärten und damit die Jugoslawische Republik faktisch auflösten.
Welche Rolle spielten ethnische Säuberungen beim Zerfall Jugoslawiens?
Die Auflösung Jugoslawiens war von massiven Menschenrechtsverletzungen begleitet, insbesondere von ethnischen Säuberungen, die hauptsächlich von der serbisch dominierten "Jugoslawischen Volksbefreiungsarmee" und serbischen Milizen verübt wurden. Aber auch kroatische und bosnisch-muslimische Kräfte hielten sich nicht an die internationalen Normen.
Welche Perspektiven gibt es für die Zukunft der Nachfolgestaaten Jugoslawiens?
Es wird eine Herausforderung bleiben, die unterschiedlichen Kultur- und Lebensgewohnheiten anzugleichen und die konfessionellen Spannungen abzubauen. Die Forderungen der einzelnen Republiken nach Unabhängigkeit und Selbständigkeit sollten politisch ausdiskutiert und nicht mit Waffengewalt geregelt werden.
- Quote paper
- Mario Pehlmann (Author), 2000, Der Zerfall von Jugoslawien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97241