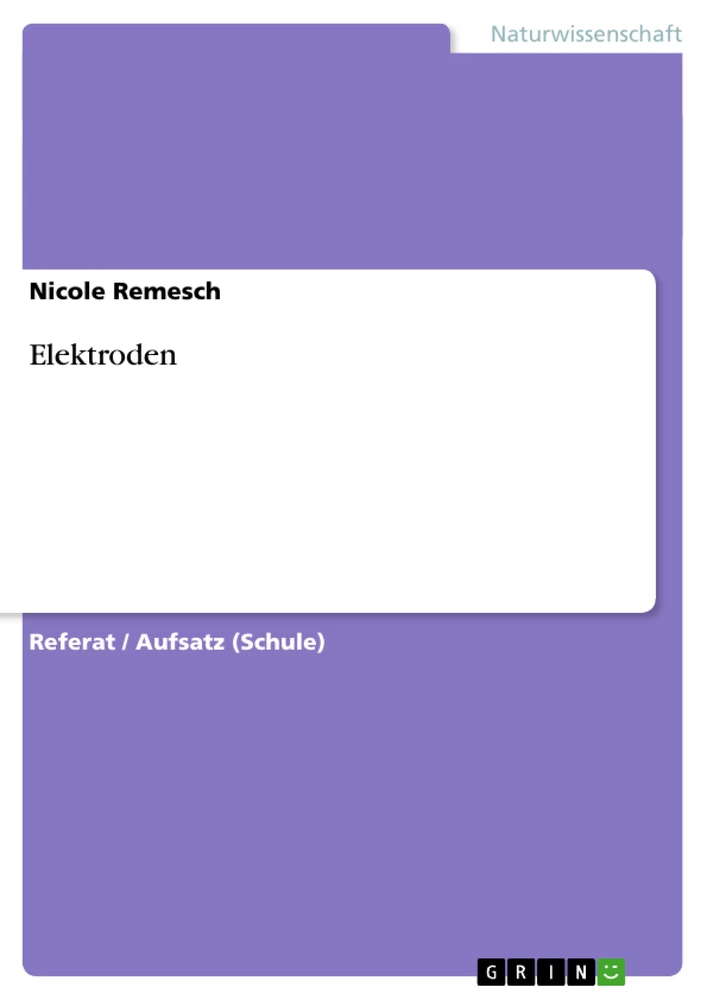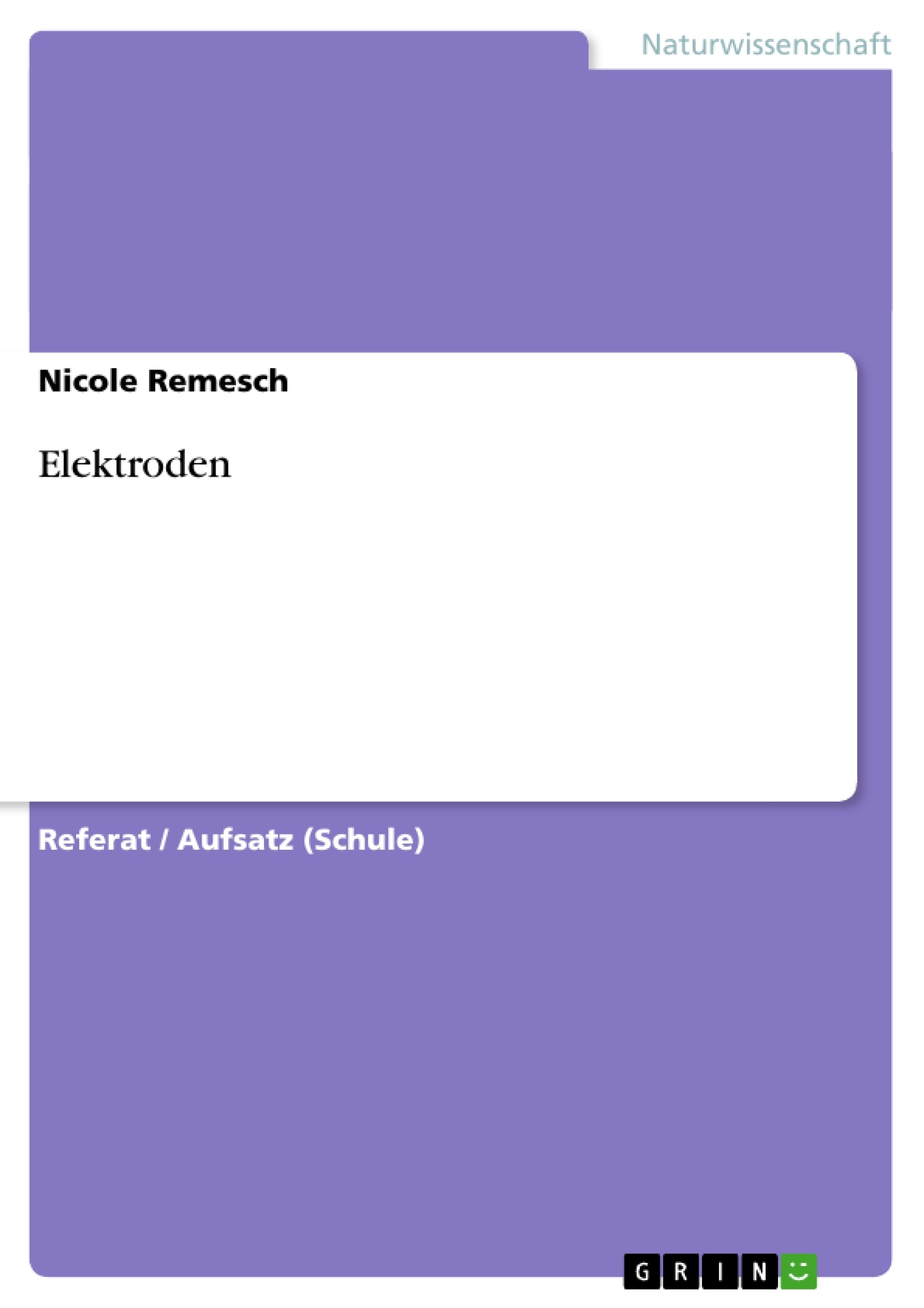Nicole Remesch:
Elektroden
Potential:
Wird eine Ladung vom ,,höheren" zum ,,tieferen" Potential gebracht, so wird chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Den Höhenunterschied nennt man Potentialdifferenz. Um die Spannung zu messen, welche von verschiedenen Reaktionspartnern stammen muß, müssen die das Redoxpaar räumlich trennen. Der geschlossene Stromkreis muß bestehen bleiben, damit Elektronen ausgetauscht werden können, dies darf jedoch nicht über das Messgerät geschehen.
Das in die Lösung eingetauchte Redoxpaar nennt man Elektroden. Ein Elektrodenpaar besteht aus:
Kathode: gibt Elektronen an die Lösung ab
Anode: nimmt Elektronen aus der Lösung auf
Bsp.:
Daniellelement:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Reduktion findet an der Kathode, die Oxidation an der Anode statt. Die Kathode negativ ist und die Anode positiv.
Die Ladung hängt von der Freiwilligkeit der Reaktion ab.
Man kann aber ein Potential wie auch eine Höhe nie absolut messen, sondern immer nur in Relation zu einer Bezugshöhe.
Im Fall der Elektroden ist dies die Normalwasserstoffelektrode:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Potential der Elektroden hängt ab von:
- Der Art des Redoxpaares und somit vom Redoxpotential
- Der Konzentration der an der Reaktion beteiligten Stoffe
- Der Temperatur
Um einen Vergleich zwischen den Potentialen möglich zu machen, wurde vereinbart für alle gelösten Stoffe eine Bezugskonzentration von 1 M anzunehmen.
Da Feststoffe das Potential nicht beeinflussen, wird für sie der rechnerische Wert von a=1 angenommen und für Gase wird ein Bezugspartialdruck von 1 gewählt. Im Falle der NWE:
In einer Lösung mit einer Aktivität von 1 mol/l H+, strömt H2 mit einem Druck von 1 bar über eine Platinelektrode. Das Potential ist per Definition 0.
Alle Potentiale die gegen diese Elektrode gemessen werden heißen Normalpotentiale. Für jede Redoxpaar gibt es ein charakteristisches Normalpotential. Hier gilt die Merkregel: Ist das Normalpotential negativ, liegt das Gleichgewicht der allgemeinen Reaktion X + e-_X- auf der Seite mit den freigesetzten Elektronen. Bei positiven Potentialen ist es umgekehrt.
Wo das Gleichgewicht liegt, hängt immer von beiden Reaktionspartnern ab.
Die Normalpotentiale kann man in der elektrochemischen Spannungsreihe zusammenfassen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus diese Tabelle kann man entnehmen, daß Elemente mit negativem Normalpotential von
H+ oxidiert wird > unedle Metalle.
Elemente mit positivem Normalpotential sind Edelmetalle.
Nernst`sche Gleichung:
Die Anwendung der Nernst`schen Gleichung setzt den reversiblen Gleichgewichtszustand der Elektrode bei eindeutig verlaufender Elektrodenreaktion voraus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sie wird zur Berechnung der Potenziale herangezogen, wenn die Konzentration der an der Reaktion beteiligten Stoffe nicht 1 mol ist.
Galvanische Zellen bzw. Zellspannung und EMK:
Galvanische Zellen bestehen aus zwei Halbzellen, deren Elektrolytlösungen leitend mit einander verbunden sind. Damit sich die Lösungen nicht vermischen, wird ihre Trennung häufig mittels Membranen vorgenommen. Mit einer elektrisch leitenden äußeren Verbindung beider Halbzellen entsteht die geschlossene Zelle. Dazu werden Feststoffphasen beider Halbzellen durch metallische Leiter(Pole der Zelle) mit einander verbunden. Zwischen den Polen können Spannung und Stromstärke gemessen werden.
Batterien sind zusammengeschaltete Galvanische Zellen.
Zellspannung:
Die Differenz zwischen Elektrodenpotentialen zweier Halbzellen ist die Zellspannung U.
Unter Beachtung der Stromrichtung wird bei Standartbedingungen die Standartzellspannung U0 aus der Differenz aus Katoden- und Anodennormalpotential berechnet. Zwischen der Zellspannung und der EMK (ElektroMotorischeKraft) besteht die Beziehung U= -E
Die EMK ist der negative Wert der Zellspannung zwischen den Polen der galvanischen Zelle.
Prinzipiell existieren 2 Arten von elektrochemischen Zellen:
- Galvanische Zellen auf Basis von Redoxreaktionen
- Galvanische Zellen auf Basis von Diffusionsvorgängen
In beiden Fällen kommt es an der Phasengrenze zur Ausbildung einer Spannung, deren Ursache entweder Redoxvorgänge mit e- und Ionen oder Diffusionsvorgänge nur mit Ionen sind.
Elektrode 1. Art:
Das Potential dieser Elektroden wird nur von ihren Redoxgleichgewichten verursacht. Sie bestehen aus einem Metall oder Nichtmetall in fester Phase und der Elektrolytlösung, die das Ion des Feststoffes in einer bestimmten Oxydationsstufe enthält. Bei gegebener Temperatur ist das Elektrodenpotential nur von der Aktivität des Elektrolytions abhängig. Mit zunehmender Ionenaktivität steigt auch das Elektrodenpotential.
Eine spezielle Art sind die Legierungselektronen. Sie werden bei der EMK Messung verwendet, um eine gleichmäßige Feststoffoberfläche zu schaffen, die den Ablauf der
Durchtrittsreaktion begünstigt. Das Elektrodenpotential ist dann auch vom Stoffmengenanteil des Elektrodenmetalls abhängig.
Elektroden 1. Art werden auch als Messelektroden bei der Bestimmung von Ionenaktivitäten in Elektrolytlösungen angewendet.
Beispiele zu Elektroden 1. Art:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Gaselektroden wird das Elektrodenpotential durch den Redoxvorgang zwischen flüssiger und gasförmiger Phase gebildet. Das Gleichgewicht der Elektronenreaktion ist vom Partialdruck der gasförmigen Elektrodenphase abhängig. Die Ableitung des Potential über den äußeren Stromkreis einer galvanischen Zelle erfolgt durch ein inertes Metall, das in die Elektrolytlösung eintaucht.
Wichtige Vertreter:
Platin-Wasserstoffelektrode:
Diese Elektrode kann zur pH-Wert Messung herangezogen werden. Jedoch ist sie extrem
störanfällig da Fremdstoffe mit reduzierender oder oxidierender Wirkung oder Kontaktgifte (Stoffe welch mit dem Platin reagieren) das Potential schon verändern. Daher wird sie in der Praxis eher selten gebraucht obwohl sie über den gesamten pH-Bereich einsetzbar wäre.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
steigt der pH-Wert der Lösung um eine Einheit, so sinkt das Potential der Elektrode um 58mV/pH. Jede gute Elektrode sollte eine Steigung von 58mV/pH aufweisen.
Redoxelektroden:
Bei vielen korrespondierenden Redoxpaaren sowie in einigen zur EMK-Messung geeigneten Elektroden stellt sich das Gleichgewicht der Elektrode innerhalb einer Phase ein. Für die Ableitung des Elektrodenpotentials benutzt man dann einen metallischen Leiter, welcher das Potential nicht beeinflusst. Es befindet sich sowohl die oxidierte als auch die reduzierte Form in der gleichen Phase. Es wird auch immer in stark verdünnten Lösungen gearbeitet, damit aH2O als 1 angenommen werden kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei Elektroden 2. Art wird die Abhängigkeit ihres Potentials von der lonenaktivität ausgeschaltet. Das geschieht mit Hilfe des Löslichkeitsgleichgewichtes schwer löslicher Salze. Wird die Anionenaktivität der Lösung festgelegt, so ist die Kationenaktivität konstant und es stellt sich ein konstantes Elektrodenpotential ein. Das heißt das Potential wird immer von zwei Gleichgewichten bestimmt: Löslichkeitsgleichgewicht und Redoxgleichgewicht.
Kalomel-Elektrode:
Kalomel-Elektrode dient meist als Bezugselektrode.
Über dem Quecksilber befindet sich eine Schicht von festem Quecksilber(1)- chlorid
(Kalomel). Der weitere Elektrodenraum ist mit Kaliumchloridlösung bekannter
Chloridionenaktivität gefällt und die Lösung ist mit Quecksilber(1)-chlorid gesättigt. Die
Potentialableitung erfolgt durch einen Platindraht, welcher in das Quecksilber eintaucht und in einen Glasstab eingeschmolzen ist. Das Elektrodenpotential wird durch die im Löslichkeitsgleichgewicht vorhandenen Hg22+ Ionen verursacht und von der Chloridionenaktivität beeinflusst. Daraus ergibt sich das Elektrodenpotential von:
Redoxgleichgewicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mit Festlegung der Cloridionenkonzentration ist das Elektrodenpotential bei gegebener
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Potential in Bezug auf Elektroden?
Wenn eine Ladung von einem höheren zu einem tieferen Potential gebracht wird, wird chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Der Höhenunterschied wird Potentialdifferenz genannt. Um die Spannung zu messen, die von verschiedenen Reaktionspartnern stammt, müssen diese Redoxpaare räumlich getrennt werden. Der geschlossene Stromkreis muss bestehen bleiben, damit Elektronen ausgetauscht werden können, aber dies darf nicht über das Messgerät geschehen.
Was sind Elektroden?
Das in die Lösung eingetauchte Redoxpaar wird Elektrode genannt. Ein Elektrodenpaar besteht aus einer Kathode (die Elektronen an die Lösung abgibt) und einer Anode (die Elektronen aus der Lösung aufnimmt).
Wo findet Reduktion und Oxidation in einer elektrochemischen Zelle statt?
Die Reduktion findet an der Kathode und die Oxidation an der Anode statt. Im Daniellelement ist die Kathode negativ und die Anode positiv. Die Ladung hängt von der Freiwilligkeit der Reaktion ab.
Was ist die Normalwasserstoffelektrode (NWE) und wozu dient sie?
Da Potentiale immer nur relativ zu einer Bezugshöhe gemessen werden können, dient die Normalwasserstoffelektrode als Bezugspunkt. In einer Lösung mit einer Aktivität von 1 mol/l H+ strömt H2 mit einem Druck von 1 bar über eine Platinelektrode. Das Potential ist per Definition 0.
Wovon hängt das Potential einer Elektrode ab?
Das Potential der Elektroden hängt von der Art des Redoxpaares (Redoxpotential), der Konzentration der beteiligten Stoffe und der Temperatur ab.
Was sind Normalpotentiale?
Alle Potentiale, die gegen die Normalwasserstoffelektrode gemessen werden, heißen Normalpotentiale. Jedes Redoxpaar hat ein charakteristisches Normalpotential. Bei negativen Normalpotentialen liegt das Gleichgewicht der allgemeinen Reaktion X + e- ⇌ X- auf der Seite mit den freigesetzten Elektronen. Bei positiven Potentialen ist es umgekehrt.
Was ist die elektrochemische Spannungsreihe?
Die elektrochemische Spannungsreihe ist eine Zusammenfassung der Normalpotentiale. Elemente mit negativem Normalpotential werden von H+ oxidiert (unedle Metalle), während Elemente mit positivem Normalpotential Edelmetalle sind.
Was besagt die Nernst'sche Gleichung?
Die Nernst'sche Gleichung wird zur Berechnung der Potentiale herangezogen, wenn die Konzentration der an der Reaktion beteiligten Stoffe nicht 1 mol ist. Sie setzt den reversiblen Gleichgewichtszustand der Elektrode bei eindeutig verlaufender Elektrodenreaktion voraus.
Woraus bestehen galvanische Zellen?
Galvanische Zellen bestehen aus zwei Halbzellen, deren Elektrolytlösungen leitend miteinander verbunden sind. Batterien sind zusammengeschaltete galvanische Zellen.
Was ist die Zellspannung und wie hängt sie mit der EMK zusammen?
Die Differenz zwischen Elektrodenpotentialen zweier Halbzellen ist die Zellspannung U. Unter Standardbedingungen wird die Standardzellspannung U0 aus der Differenz aus Kathoden- und Anodennormalpotential berechnet. Zwischen der Zellspannung und der EMK (elektromotorische Kraft) besteht die Beziehung U = -E. Die EMK ist der negative Wert der Zellspannung zwischen den Polen der galvanischen Zelle.
Welche Arten von galvanischen Zellen gibt es?
Es gibt galvanische Zellen auf Basis von Redoxreaktionen und galvanische Zellen auf Basis von Diffusionsvorgängen.
Was sind Elektroden 1. Art?
Das Potential dieser Elektroden wird nur von ihren Redoxgleichgewichten verursacht. Sie bestehen aus einem Metall oder Nichtmetall in fester Phase und der Elektrolytlösung, die das Ion des Feststoffes in einer bestimmten Oxydationsstufe enthält. Das Elektrodenpotential ist nur von der Aktivität des Elektrolytions abhängig.
Was sind Gaselektroden?
In Gaselektroden wird das Elektrodenpotential durch den Redoxvorgang zwischen flüssiger und gasförmiger Phase gebildet. Das Gleichgewicht der Elektronenreaktion ist vom Partialdruck der gasförmigen Elektrodenphase abhängig. Ein wichtiger Vertreter ist die Platin-Wasserstoffelektrode.
Was sind Redoxelektroden?
Bei Redoxelektroden stellt sich das Gleichgewicht der Elektrode innerhalb einer Phase ein. Es befindet sich sowohl die oxidierte als auch die reduzierte Form in der gleichen Phase.
Was sind Elektroden 2. Art?
Bei Elektroden 2. Art wird die Abhängigkeit ihres Potentials von der Ionenaktivität ausgeschaltet, mit Hilfe des Löslichkeitsgleichgewichtes schwer löslicher Salze. Das heißt, das Potential wird immer von zwei Gleichgewichten bestimmt: Löslichkeitsgleichgewicht und Redoxgleichgewicht. Ein Beispiel ist die Kalomel-Elektrode.
Was ist die Kalomel-Elektrode?
Die Kalomel-Elektrode dient meist als Bezugselektrode. Ihr Potential wird durch die im Löslichkeitsgleichgewicht vorhandenen Hg22+ Ionen verursacht und von der Chloridionenaktivität beeinflusst.
- Citation du texte
- Nicole Remesch (Auteur), 2000, Elektroden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97219