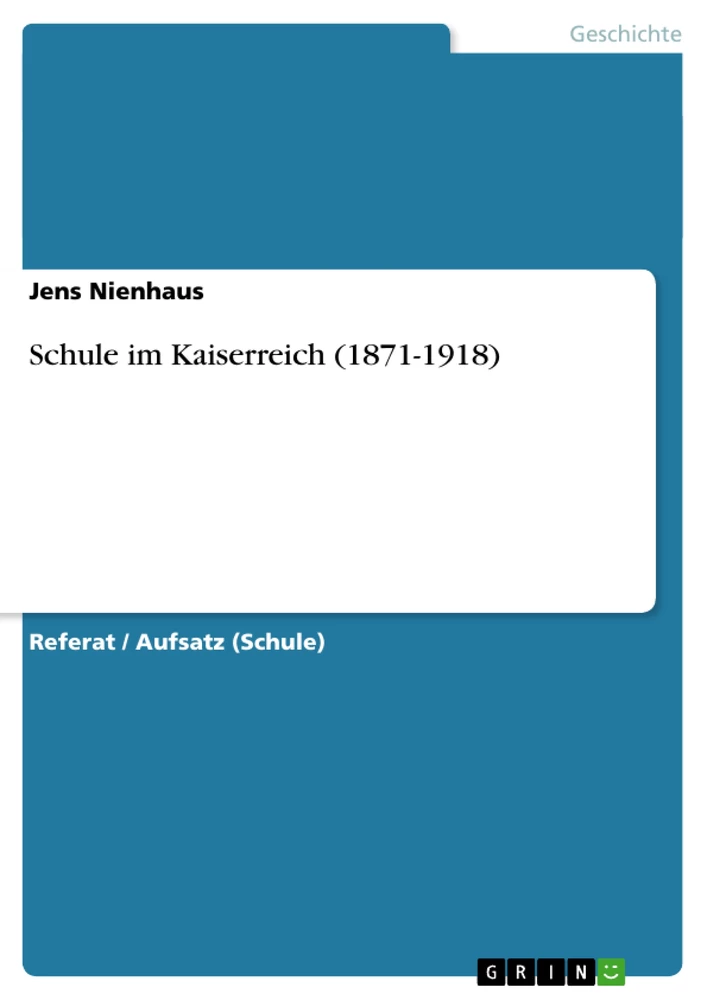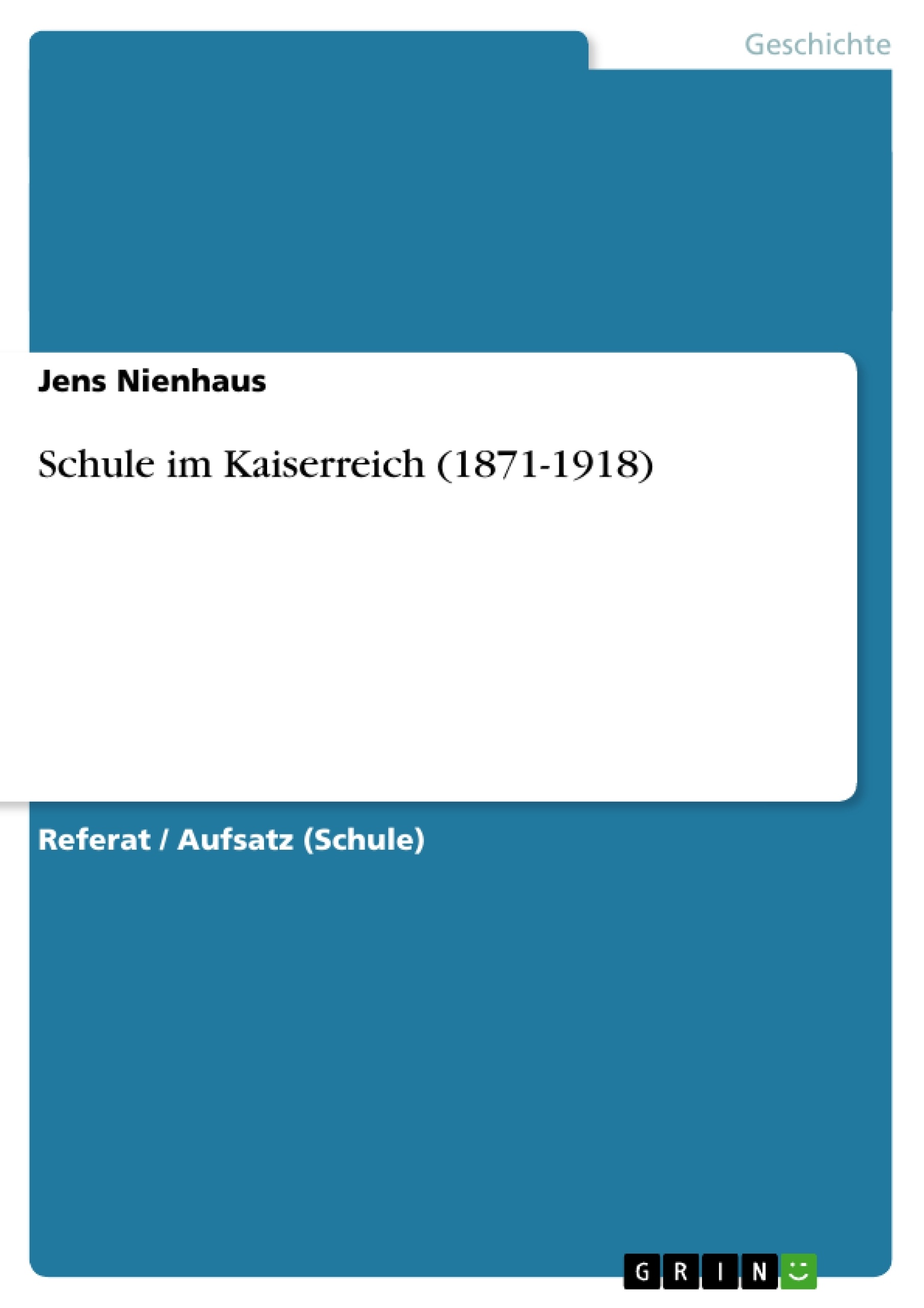Eine Zeitreise in die Klassenzimmer des Kaiserreichs (1871-1918): Vergessen Sie idyllische Vorstellungen von Zucht und Ordnung! Diese tiefgründige Analyse enthüllt eine Schullandschaft voller Kontraste, sozialer Ungleichheiten und überraschender Einblicke in eine Epoche, die unsere moderne Bildungswelt nachhaltig geprägt hat. Zwischen Dorfschulen mit unbezahlten Lehrern und Gymnasien, die auf weltfremde Ideale setzten, entfaltet sich ein vielschichtiges Bild der damaligen Erziehung. Erfahren Sie, wie der Unterricht in den Städten aussah, wo Lehrer kaum entlohnt wurden und erst staatliche Reglementierungen eine Verbesserung brachten. Entdecken Sie die Kluft zwischen Volksschule und Gymnasium, die keineswegs nur vom Schulgeld abhing, sondern von gesellschaftlichen Vorstellungen und dem Überlebenswillen der Arbeiterfamilien geprägt war. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der körperliche Züchtigung zum Schulalltag gehörte, Notenbücher detailliert über Rohrstockschläge Auskunft gaben und selbst schwerste Misshandlungen als angemessen galten. Beleuchtet wird auch die Rolle der Frau in der Bildung, von höheren Mädchenschulen, die das Bild der unterwürfigen Frau festigten, bis hin zu den ersten zaghaften Schritten zur Gleichstellung. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Schulgeschichte, Sozialgeschichte und die Wurzeln unseres heutigen Bildungssystems interessieren. Es zeigt auf erschreckende und faszinierende Weise, wie sich die Schule im Kaiserreich zwischen Drill, Standesdenken und dem Streben nach nationaler Einheit bewegte und wie wenig Raum für individuelle Förderung und freie Entfaltung blieb. Eine ebenso lehrreiche wie erschütternde Lektüre, die zum Nachdenken über unsere eigene Bildungslandschaft anregt und die Frage aufwirft, wie viel von den Idealen und Praktiken des Kaiserreichs bis heute nachwirkt. Entdecken Sie die verborgenen Geschichten hinter den Schulbänken und erfahren Sie, wie die Schule im Kaiserreich zum Spiegelbild einer Gesellschaft im Umbruch wurde. Dieses Buch ist eine fesselnde Reise in eine Zeit, in der Bildung nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch die gesellschaftliche Ordnung zementierte und die Weichen für die Zukunft des Deutschen Reiches stellte.
EW-Projektarbeit
Thema: Schule im Kaiserreich (1871-1918)
Während des Kaiserreiches kann man nicht von der Schule oder der „normalen“ Schullaufbahn sprechen. Ein sehr großer Unterschied bestand zum Beispiel zwischen den ländlichen Dörfern und den, durch die Industrialisierung wachsenden, Städten.
In den Dörfern gab es erst nur unausgebildete Lehrer, die sehr arm waren, da sie vom Staat nicht bezahlt wurden. Ihr Gehalt bekamen sie von den Eltern der Kinder. Allerdings zahlten diese fast immer in Naturalien, wie Brot oder Fleisch. Auf Grund dessen hatten diese Lehrer meist noch einen „richtigen“ Beruf. Viele von ihnen waren Handwerker und unterrichteten in ihren eigenen Werkstätten. Schulbücher oder ähnliches Unterrichtsmaterial waren nicht vorhanden. Später wurden dann überall Schulräume mit speziellen Tischen und Bänken einge- richtet, aber dort wurden oft 4 Klassen verschiedener Altersstufen von einem Lehrer in einem Raum gleichzeitig unterrichtet.
Auch in den Städten war der Unterricht besonders in den Volksschulen unsachgemäß. Die Lehrer bekamen fast kein Geld und waren in durch Seminaren ausgebildet worden. Erst durch eine Reglegementierung durch den Staat wurde für den Beruf des Volksschullehrers eine 3jährige Lehre notwendig.
Die Volksschule ging von der ersten bis zum achten Klasse und der Abschluß der Volksschule ist vergleichbar mit dem heutigen Hauptschulabschluß. Nur konnte man früher viel mehr mit diesem Schulabschluß anfangen, als heute. Der Grund dafür war, daß nur ca. 10% der Schüler versuchten, nach der vierten Klasse zur weiterführenden Schule zu gehen und der Rest blieb auf der Volksschule. Von einer Klasse mit 50 Schülern versuchten höchstens drei auf das Gymnasium zu kommen und die Hälfte dieser Anwärter fiel noch durch die schweren Auf- nahmeprüfungen. Fälschlicherweise denken viele immer noch, daß ärmere Eltern aufgrund des Schulgeldes ihre Kinder nicht zum Gymnasium hätten schicken können. Tatsächlich hätte jedoch jeder normale Arbeiter es sich erlauben können, für mindestens ein Kind das Schulgeld zu bezahlen. Ein viel größeres Problem war, daß ein Jugendlicher versorgt werden mußte, der unüblicherweise noch kein Geld verdiente. Zudem konnte sich ein Arbeiter gar nicht vorstel- len, ein Kind zum Gymnasium zu schicken, und so zog man dies trotz guter Noten des Kindes erst überhaupt nicht in Betracht.
Das Gymnasium war zu der Zeit sehr weltfremd. Es wurden hauptsächlich alte Sprachen und Religion unterrichtet, während Fächer, wie zum Beispiel Mathematik, nur sporadisch unter- richtet wurden. Es war sogar möglich das Abitur zu erlangen, ohne die Grundrechenarten rich- tig zu beherrschen. Ein weiterer Nachteil des Gymnasiums zur Kaiserzeit war, daß sich die Lehrer als Wissenschaftler ansahen. Ihre Schüler waren ihnen nicht nur völlig egal, sondern sie sahen sie sogar als störend an. Zudem lag ein riesiger Leistungsdruck auf den Schülern, weil sie im Durchschnitt wöchentlich in jedem Fach eine Klassenarbeit schrieben. Hatte man es dann aber geschafft, die Abiturprüfungen zu bestehen, war bei den meisten die berufliche Zu- kunft schon festgelegt. Aufgrund des einseitigen Lehrinhaltes wurden viele Abiturienten später selbst Lehrer oder sie studierten Theologie. Andere schlugen die hohe Militärlaufbahn ein oder studierten Jura oder Medizin. Weitere nennenswerte Berufsmöglichkeiten gab es eigentlich nicht. Ein anderer, für uns jetzige Schülern kaum vorstellbarer, Unterschied zu heute war, daß die Schule (Gymnasium) direkten Einfluß auf das private Leben nahm. Verbote des Gymnasi- ums zählten auch außerhalb der Schulzeit. Zum Beispiel war es verboten Bücher auszuleihen, wenn man ein Buch brauchte, sollte man sich dies standesgemäß kaufen. Zudem durfte man erst bei Volljährigkeit (21 Jahre) rauchen. Kontakte zu Schülern anderer Schulen waren auch strikt untersagt. Befolgte man diese Regeln nicht, wurde man von der Schule bestraft. Zum Beispiel wurde einem 20jährigen Schüler ein Schulverweis angedroht, weil er Liebesbriefe an eine gleichaltrige Schülerin einer höheren Mädchenschule geschrieben hatte. Ein Schulverweis hatte damals viel schlimmere Konsequenzen zufolge, als heute. Nach einem Schulverweis wurde man von keiner weiterführenden Schule mehr angenommen.
Im Vergleich zu heute war auch das Lehrziel ein ganz anderes. Heute wird in fast allen Staaten versucht, die Kinder und Jugendlichen zu mündigen Bürgern zu erziehen. Dies war im Natio- nalsozialismus und davor (Ausnahme: Weimarer Republik) nicht so. Im Kaiserreich war das Lehrziel auch ein gehorsamer Untertan. Zudem wurde viel Wert auf den Sportunterricht ge-legt, da man später einmal gute Soldaten haben wollte. Deswegen wurden in der Volksschule militärische Übungen gemacht: Anschleichen; Spuren lesen; Lagerleben und in Reih´ und Glied stehen. So arbeiteten das Militär und die Schule in Hand und Hand. Über diese Übungen wurde aber erst mit Näherkommen des Ersten Weltkrieges öffentlich geredet, weil zu diesem Zeitpunkt die Grundstimmung des Volkes militärischer wurde. Dies kam durch wachsenden Haß gegenüber dem „Erzfeind“ Frankreich.
Körperliche Züchtigung war in allen Schulformen zu dieser Zeit üblich. Diese Strafen wurden in allen Schichten der damaligen Gesellschaft angewandt und im Gegensatz zu heute wurde die Prügelstrafe auch in der Öffentlichkeit toleriert. Sie wurde sowohl von dem Volk als auch von den meisten Wissenschaftlern ebenso in der Schule gefordert. Zur Schule gehen wurde auch „Sul virga degere“ genannt. Diese lateinische Redewendung heißt nichts anderes als „Unter der Rute leben“. Man sprach davon, daß man den Kindern den göttliche Geist einbleu- en müßte. Aufgrund dieser Billigung roher Gewalt in der Schule wurden die Schüler von der Volksschule bis zum Gymnasium mißhandelt. Über die täglichen Stockschläge wurde vom Lehrer sogar Buch geführt, wo jeder einzelne Schlag und der Anlaß dafür aufgelistet wurde. Auch die Strafen, die wegen außerschulischen Vergehen verhängt wurden, waren dort ver- merkt. Zum Beispiel bekam ein Schüler einmal zehn Schläge mit einem Rohrstock, weil er Nachmittags über einen Acker eines Bauers gelaufen war. Aber diese Stockschläge waren nicht die einzige Art der körperlichen Züchtigung. Eine Schülerin wurde von einem Lehrer auf einen heißen Ofen gesetzt und sie zog sich schwere Verbrennungen zu. Dieser Fall wurde von dem Lehrer in das Strafen-Buch eingetragen und diese Mißhandlung wurde von allen (auch den Eltern) als angemessen betrachtet.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "EW-Projektarbeit: Schule im Kaiserreich (1871-1918)"?
Der Text behandelt das Schulsystem im Deutschen Kaiserreich (1871-1918) und vergleicht es mit der heutigen Situation. Er beleuchtet die Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Schulen, die Ausbildung der Lehrer, die verschiedenen Schulformen (Volksschule, Gymnasium) und die Lebensrealität der Schüler.
Welche Unterschiede gab es zwischen Schulen auf dem Land und in der Stadt?
Auf dem Land waren die Lehrer oft unausgebildet und wurden von den Eltern in Naturalien bezahlt. Unterrichtsmaterialien fehlten. In den Städten war der Unterricht in den Volksschulen ebenfalls oft unsachgemäß, aber durch staatliche Reglementierung wurde später eine 3-jährige Ausbildung für Volksschullehrer notwendig.
Was war die Volksschule im Kaiserreich und womit ist sie vergleichbar?
Die Volksschule umfasste die Klassen eins bis acht und ist in etwa mit dem heutigen Hauptschulabschluss vergleichbar. Allerdings bot der Volksschulabschluss damals mehr Möglichkeiten als heute.
Warum besuchten nicht mehr Kinder das Gymnasium? Lag es nur am Schulgeld?
Das Schulgeld war nicht der Hauptgrund. Arbeiter hätten es sich leisten können, für ein Kind das Schulgeld zu bezahlen. Das größere Problem war, dass ein Jugendlicher versorgt werden musste, der noch kein Geld verdiente, und dass die Idee, ein Kind aufs Gymnasium zu schicken, oft gar nicht in Betracht gezogen wurde.
Wie war das Gymnasium im Kaiserreich beschaffen?
Das Gymnasium war oft weltfremd, mit Fokus auf alten Sprachen und Religion. Mathematik wurde weniger Gewicht beigemessen. Lehrer sahen sich als Wissenschaftler und die Schüler oft als störend. Es herrschte hoher Leistungsdruck.
Welche beruflichen Perspektiven hatten Abiturienten?
Viele wurden Lehrer oder studierten Theologie, Jura oder Medizin. Eine militärische Karriere war ebenfalls eine Option.
Welchen Einfluss hatte die Schule auf das private Leben der Schüler?
Die Schule hatte direkten Einfluss auf das private Leben. Es gab Verbote, die auch außerhalb der Schulzeit galten, z.B. bezüglich des Ausleihens von Büchern oder Kontakten zu Schülern anderer Schulen.
Was war das Lehrziel im Kaiserreich im Vergleich zu heute?
Im Kaiserreich war das Lehrziel ein gehorsamer Untertan, während heute die Erziehung zu mündigen Bürgern im Vordergrund steht. Sportunterricht wurde betont, um gute Soldaten heranzuziehen.
Wie war die körperliche Züchtigung an Schulen im Kaiserreich?
Körperliche Züchtigung war üblich und gesellschaftlich toleriert. Lehrer führten sogar Buch über die Schläge, die sie austeilten.
Wie war die Situation für Mädchen in der Schule?
Mädchen besuchten entweder die Volksschule oder die höhere Mädchenschule. Die höhere Mädchenschule bereitete nicht auf Berufe vor, sondern unterstrich eher das Bild der unterwürfigen Frau. Berufsausbildungen für Frauen gab es erst ab 1901.
Was brachte die Mädchenschulreform von 1908?
Die Mädchenschulreform ermöglichte es Frauen, Lehrerinnen an Gymnasien zu werden. Allerdings änderte sich wenig an der gesellschaftlichen Rolle der Frau.
- Quote paper
- Jens Nienhaus (Author), 1999, Schule im Kaiserreich (1871-1918), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97131