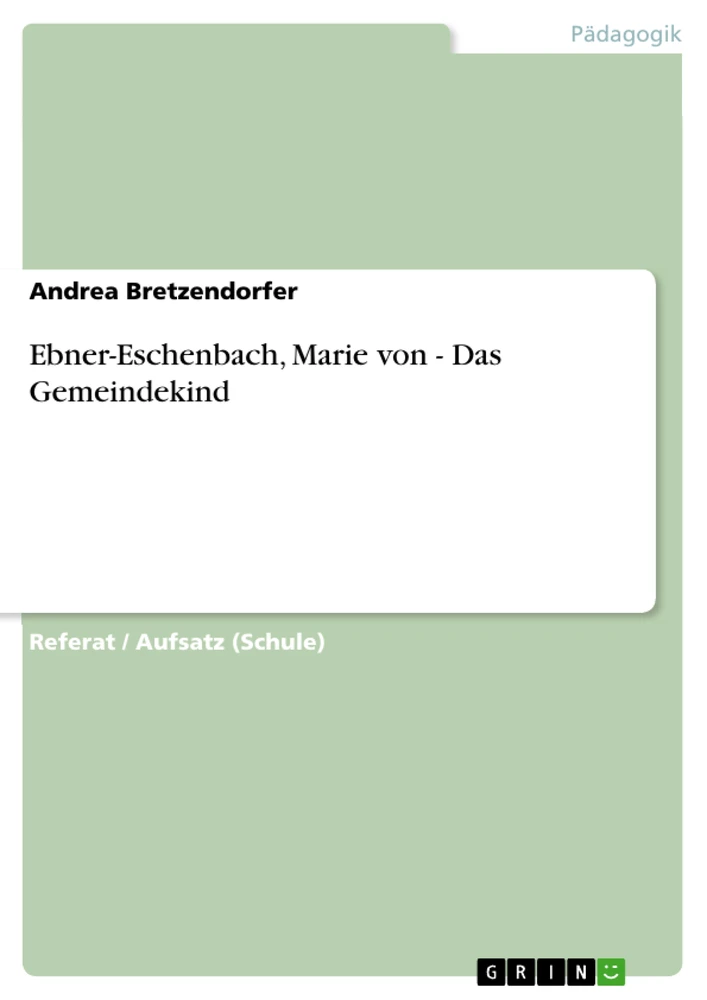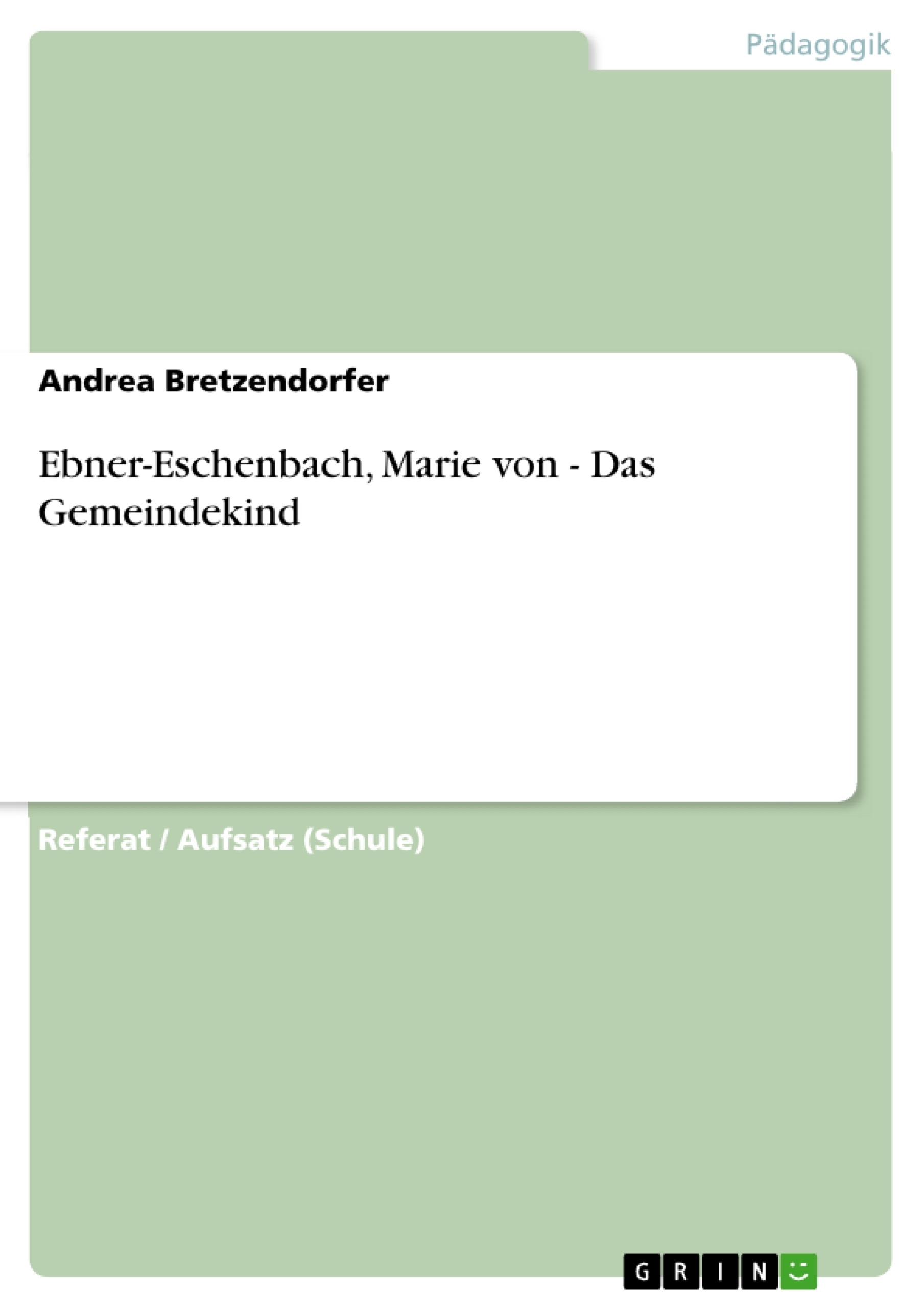Nachdem der Vater der Sinti-und-Roma-Familie Holub, ein Alkoholiker, den Pfarrer der mährischen Gemeinde Soleschau ermordet hat, wird dieser mit dem Tod bestraft. Indem er noch versucht, die Schuld seiner treuergebenen Frau zuzuschieben, wird auch diese, da sie sich aus Ehrfurcht nicht äußern will und kann, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.
Die beiden Kinder, Pavel und Milada, bleiben in Soleschau zurück, wobei ihnen ein sehr unterschiedliches Schicksal widerfährt. Die Baronin findet Gefallen an der kleinen Milada und schickt sie ins Kloster der Nachbarstadt, um sie dort erziehen zu lassen. Für den 13-jährigen Pavel übernimmt die Gemeinde widerwillig die Fürsorge. Er kommt zur Familie des Hirten Virgil, dessen Frau als Hexe verschrien ist und die ganze Familie zu den verachtetsten Menschen im Dorf zählt. So kommt es, dass Pavel stolz ist auf seinen schlechten Ruf und seine Diebstähle. Sein Hass und Trotz gegenüber den Leuten im Dorf, erzeugt durch Hunger, Prügel und Beschimpfungen wächst von Tag zu Tag. Nur der hübschen Tochter des Hirten, Vinska, fühlt er sich ergeben, obwohl er fühlt, dass sie ihn nur ausnutzt und verspottet, da sie eigentlich Peter, den Sohn des Bürgermeisters, heiraten will. Als der Bürgermeister, der gegen diese Heirat ist, stirbt, wird Pavel als ,,Giftmischer" verleumdet, da er dem Bürgermeister heimlich ein schmerzstillendes Mittel von der Frau des Hirten überbringen musste. Er wird zwar unschuldig gesprochen, doch der Schimpfname und der Hass der Leute bleiben ihm.
Nach jahrelanger Trennung darf Pavel seine Schwester im Kloster besuchen. Durch das Aufeinandertreffen der beiden bahnt sich eine Wende in Pavels Verhalten an. Milada ist voll Entsetzen über Pavels Einstellung und redet auf ihn ein, ein braver Mensch zu werden. Pavel ist daraufhin der festen Überzeugung seinen Ruf verbessern zu wollen, arbeitet fleißig, vermeidet Prügeleien, geht zur Schule und erkennt im Lehrer Habrecht seine einzige Bezugs- und Vertrauensperson. Trotzdem zeigt die Dorfjugend und v.a. Peter, dem er sogar das Leben bei einem Unfall mit dem Mähdrescher gerettet hat, keine Einsicht: sie zerstören das kleine Häuschen, das er sich mühevoll aufgebaut hat, wobei sich Pavel sehr beherrschen muss, es ihnen nicht wieder mit Prügeln zu vergelten.
Das Gemeindekind
I. Lebenslauf der Autorin
- 13. September 1830 geboren in Zdislawic (Mähren) als Baronin Marie Dubsky
- Tochter von Baron Franz Dubsky und dessen zweiter Frau Marie
- Mutter starb bei Geburt --> gutes Verhältnis zu den zwei Stiefmüttern
- 1848 Heirat mit Cousin Moritz von Ebner-Eschenbach
- Leben in Zdislawic und Wien
- Interesse v.a. für Literatur und Zeitgeschehen
- Verbindung zu zeitgenöss. Autoren wie Grillparzer, Nestroy, Stifter, Anzengruber, von Saar
- 1889 erste Frau mit dem Ehrenkreuz für Kunst und Literatur
- 1910 erste Frau mit dem Ehrendoktortitel der Wiener Universität
- 12. März 1916 Tod in Wien, begraben in Zdislawic
- Werke: Romane (Das Gemeindekind, Krambambuli, Unsühnbar),
- Autobiografien (Aus einem zeitlosen Tagebuch), Dramen (Maria Stuart in Schottland)
II. Inhaltsangabe
Nachdem der Vater der Sinti-und-Roma-Familie Holub, ein Alkoholiker, den Pfarrer der mährischen Gemeinde Soleschau ermordet hat, wird dieser mit dem Tod bestraft. Indem er noch versucht, die Schuld seiner treuergebenen Frau zuzuschieben, wird auch diese, da sie sich aus Ehrfurcht nicht äußern will und kann, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt.
Die beiden Kinder, Pavel und Milada, bleiben in Soleschau zurück, wobei ihnen ein sehr unterschiedliches Schicksal widerfährt. Die Baronin findet Gefallen an der kleinen Milada und schickt sie ins Kloster der Nachbarstadt, um sie dort erziehen zu lassen. Für den 13-jährigen Pavel übernimmt die Gemeinde widerwillig die Fürsorge. Er kommt zur Familie des Hirten Virgil, dessen Frau als Hexe verschrien ist und die ganze Familie zu den verachtetsten Menschen im Dorf zählt. So kommt es, dass Pavel stolz ist auf seinen schlechten Ruf und seine Diebstähle. Sein Hass und Trotz gegenüber den Leuten im Dorf, erzeugt durch Hunger, Prügel und Beschimpfungen wächst von Tag zu Tag. Nur der hübschen Tochter des Hirten, Vinska, fühlt er sich ergeben, obwohl er fühlt, dass sie ihn nur ausnutzt und verspottet, da sie eigentlich Peter, den Sohn des Bürgermeisters, heiraten will. Als der Bürgermeister, der gegen diese Heirat ist, stirbt, wird Pavel als ,,Giftmischer" verleumdet, da er dem Bürgermeister heimlich ein schmerzstillendes Mittel von der Frau des Hirten überbringen musste. Er wird zwar unschuldig gesprochen, doch der Schimpfname und der Hass der Leute bleiben ihm.
Nach jahrelanger Trennung darf Pavel seine Schwester im Kloster besuchen. Durch das Aufeinandertreffen der beiden bahnt sich eine Wende in Pavels Verhalten an. Milada ist voll Entsetzen über Pavels Einstellung und redet auf ihn ein, ein braver Mensch zu werden. Pavel ist daraufhin der festen Überzeugung seinen Ruf verbessern zu wollen, arbeitet fleißig, vermeidet Prügeleien, geht zur Schule und erkennt im Lehrer Habrecht seine einzige Bezugs- und Vertrauensperson. Trotzdem zeigt die Dorfjugend und v.a. Peter, dem er sogar das Leben bei einem Unfall mit dem Mähdrescher gerettet hat, keine Einsicht: sie zerstören das kleine Häuschen, das er sich mühevoll aufgebaut hat, wobei sich Pavel sehr beherrschen muss, es ihnen nicht wieder mit Prügeln zu vergelten. Erst nach einer ungerechten Geldforderung des Gemeinderates kommt es zu einer Prügelei im Wirtshaus. Pavel behauptet sich zwar, aber sie neuen Umstände machen ihn einsam, da mittlerweile auch der Lehrer in eine andere Stadt abberufen wurde. Bald folgt ein neuer Schicksalsschlag: der Tod der Schwester, die durch Buß- und Fastenübungen völlig aufgezehrt war. Als Pavel von der Beerdigung zurückkehrt, findet er seine Mutter vor.
Sie will eigentlich nur nach ihren Kindern sehen und gesteht Pavel, dass sie unschuldig war. Um ihn vor dem schlechten Gerede der Leute zu verschonen, will sie nicht bei ihm bleiben, sondern im Krankenhaus des Gefängnisses arbeiten. Pavel allerdings lässt die Mutter nicht mehr fort, egal was die Leute auch sagen werden.
III. Personenkonstellation.
a.) Ausgangskonstellation Baronin
Virgil
Vinska+Peter PAVEL Milada
Bürgermeister
+ Lehrer Mutter Gemeinde
b.) Konstellation nach dem Treffen mit Milada Virgil+Vinska Baronin
Milada
Gemeinde
PAVEL Mutter
Lehrer
Arnost
IV. Einordnung in die Literaturepoche
obwohl der Zeit nach eher schon Romantik , Einordnung und Prägung des Begriffes des Spätrealismus
- authentische Schilderung sozialer Umstände
- Autorin geprägt von der österr. Spätaufklärung (Bauernbefreiung,
- ufhebung der Fronpflichten)
- ironische Zitate von ,,Naturalisten" und ,,falschen Liberalisten"
V. ,,Zigeunerfiguren" im Spätrealismus
- ,,Zigeunerleben" nicht mehr im Wald --> Verlagerung an den Dorf- bzw. Stadtrand
- erstmals ,,Zigeuner" als Menschen mit eigenen Bedürfnissen und Gedanken dargestellt
- meist aber Handlung von zum dichterischen Ideal umerzogenen ,,Zigeunerkindern"
> JEDOCH: keine Entkräftung von Vorurteilen
VI. Entwicklung der Sprachanteile Pavels
- anfangs als stumm beschrieben (unpersönlicher Bericht)
- Übergangsformen: Verbindung zwischen Pavel als Objekt und Subjekt
- am Ende: Schlusswort Pavels
- Sprachanteile proportional mit Selbstständigkeit Pavels zunehmend
VII. Aussageabsichten und Wirkung des Romans
- Schilderung der Situation der ländlichen Unterschicht, Darstellung der Zeitproblematik
- sozialkritische Tendenzen, Kritik am österr. Adel durch Ironie
- Abwendung vom Determinismus
- Verbesserung der eigenen Lage nur durch Eigeninitiative
- nur Individuen als Entwicklungsförderer
Andrea Bretzendorfer, LK D 12/2
Quellen:
v. Ebner-Eschenbach, Marie, Das Gemeindekind. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co. 1998
Killy, Walther, Literaturlexikon (Band 3). Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag 1989 Internet: http://www.lpb.bwue.de/publikat/sinti
1.
Mein Thema heute dreht sich um Marie von Ebner-Eschenbachs Roman ,,Das Gemeindekind" Zuerst ein kurzer Lebenslauf der Autorin:
- Geboren wurde sie am 13.September 1830 als Baronin Marie Dubsky auf Schloss Zdislawic in Mähren.
- Sie war die Tochter von Baron Franz Dubsky und dessen 2. Frau Marie
- Insgesamt hatte ihr Vater 4 Frauen und dadurch, dass Maries Mutter schon bei ihrer Geburt starb, wuchs Marie mit der 3. und 4. Frau ihres Vaters auf. Zu beiden pflegte sie eine sehr enge Beziehung.
- 1848 heiratete sie ihren 15 Jahre älteren Cousin Moritz von Ebner- Eschenbach, welcher sie schon früh in ihrem Bildungs- und Produktionsdrang unterstützte.
- Marie von Ebner-Eschenbach lebte abwechselnd im Sommer auf dem Schloss ihrer Familie in Zdislawic, den Winter verbrachte sie meist in Wien.
- Ihr großes Interesse für Literatur und v.a. Zeitgeschehen war grundlegend für viele ihrer Werke.
- Es bestanden Verbindungen zu zeitgenössischen österreichischen Autoren wie Franz Grillparzer, Johann Nestroy, Adalbert Stifter, Ludwig Anzengruber und Ferdinand von Saar. Sie alle hatten sich zum Ziel gemacht, mit ihren Werken auf Probleme ihrer Zeit hinzuweisen.
- 1889 wurde Marie von Ebner-Eschenbach als erster Frau das Ehrenkreuz für Kunst und Literatur verliehen.
- Ebenso war sie 1910 die erste und lange Zeit die einzige Frau mit dem Ehrendoktortitel der Wiener Universität. Beide dieser Titel zeigen die stark ausgeprägte Emanzipation, die zu dieser Zeit noch eher eine Seltenheit war.
- Am 12. März 1916 starb Marie von Ebner-Eschenbach in Wien und wurde in Zdislawic begraben, was die Bindung an beide Orte widerspiegelt.
- Marie von Ebner-Eschenbach brachte viele verschiedene Textarten hervor, war allerdings mit ihren Romanen, wie z.B. ,,Krambambuli, Unsühnbar oder eben dem Gemeindekind" am erfolgreichsten. Es entstanden auch autobiographische Schriften wie ,,Aus einem zeitlosen Tagebuch" und Dramen. Ein Beispiel hierfür ist ,,Maria Stuart in Schottland".
Zu erwähnen wäre auch die wichtige Stellung des Romans ,,Das Gemeindekind" im Leben Marie von Ebner-Eschenbachs. Vergleicht man die Entstehungsdauer mit der Dauer anderer Werke, so zog sich die Entwicklung des Romans über Jahre hin. 1881 tauchte der Titel erstmals in ihren Tagebucheinträgen auf, der Roman wurde aber erst 1887 veröffentlicht. Für andere Werke waren höchstens ein Jahr die übliche Dauer, und sogar ,,Krambambuli", ihr wohl bekanntestes Werk, schrieb von Ebner- Eschenbach mit den Gedanken bei der Handlung des Gemeindekindes.
2.
Nachdem der Vater der Sinti-und-Roma-Familie Holub, ein Alkoholiker, den Pfarrer der mährischen Gemeinde Soleschau ermordet hat, wird dieser zum Tod verurteilt. Weil er noch versucht, seiner Frau, die ihm quasi untertänig war, die Schuld zuzuschieben, wird auch diese, da sie sich aus Ehrfurcht nicht äußern will und kann, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die beiden Kinder, Pavel und Milada, bleiben in Soleschau zurück. Beiden widerfährt allerdings ein sehr unterschiedliches Schicksal. Die Baronin findet Gefallen an der kleinen Milada und schickt sie ins Kloster der Nachbarstadt, um dort für ihre Erziehung sorgen zu lassen. Für den 13-jährigen Pavel übernimmt die Gemeinde widerwillig die Fürsorge. Er kommt zur Familie des Hirten Virgil, dessen Frau als Hexe verschrien ist und die ganze Familie eigentlich zu den verachtetsten Menschen im Dorf gezählt wird. So kommt es, dass Pavel stolz ist auf seinen schlechten Ruf, seine Diebstähle und Prügeleien. Sein Hass und Trotz gegenüber den Leuten im Dorf, erzeugt eben durch Hunger, Prügel und Beschimpfungen wächst von Tag zu Tag. Nur der hübschen Tochter des Hirten, Vinska, ist er in seiner Treue verfallen, obwohl er fühlt, dass sie ihn nur ausnutzt und verspottet, da sie eigentlich Peter, den Sohn des Bürgermeisters, heiraten will. Als der Bürgermeister, der gegen diese Heirat ist, stirbt, wird Pavel als ,,Giftmischer" verleumdet. Er musste dem Bürgermeister heimlich ein schmerzstillendes Mittel von der Frau des Hirten überbringen. Er wird zwar unschuldig gesprochen, dass es also kein Gift war, doch der Schimpfname und der Hass der Leute bleiben ihm erhalten. Nach jahrelanger Trennung darf Pavel seine Schwester Milada im Kloster besuchen. Durch das Aufeinandertreffen der beiden bahnt sich eine Wende in Pavels Verhalten und Einstellung an. Milada ist voll Entsetzen über Pavels Lebensweise und beschwört ihn, ein braver Mensch zu werden. Pavel ist daraufhin der festen Überzeugung seinen Ruf verbessern zu wollen. Deshalb arbeitet er fleißig, vermeidet Prügeleien, geht zur Schule und erkennt im Lehrer Habrecht seine einzige Bezugs- und Vertrauensperson. Dennoch zeigt die Dorfjugend und v.a. Peter, dem er sogar das Leben bei einem Unfall mit dem Mähdrescher gerettet hat, keine Einsicht: sie zerstören das kleine Häuschen, das er sich mühevoll auf seinem harterarbeitetem Grund aufgebaut hat. Pavel muss sich sehr beherrschen, es ihnen nicht wieder mit Prügeln zu vergelten. Erst nach einer ungerechten Geldforderung des Gemeinderates kommt es zu einer Prügelei im Wirtshaus. Pavel wird unterstellt er hätte einen Zaun mit dem Mähdrescher kaputt gemacht. Er behauptet sich zwar, aber sie neuen Umstände machen ihn einsam, da mittlerweile auch der Lehrer in eine andere Stadt abberufen wurde. Bald folgt ein neuer Schicksalsschlag: der Tod der Schwester, die durch Buß- und Fastenübungen völlig am Ende ihrer Kräfte war. Als Pavel von der Beerdigung zurückkehrt, steht seine Mutter vor seiner Türe. Sie will eigentlich nur nach ihren Kindern sehen und gesteht Pavel, dass sie damals unschuldig war. Um ihn vor dem schlechten Gerede der Leute zu bewahren, will sie nicht bei ihm bleiben, sondern im Krankenhaus des Gefängnisses arbeiten. Pavel allerdings lässt die Mutter nicht mehr fortgehen, egal, was die Leute auch sagen werden.
3.Personenkonstellationen
4.
Bei einer Einordnung in eine bestimmte Literaturepoche ist zu sagen, dass das Werk in die Epoche des Spätrealismus eingeordnet wird und diesen Begriff auch mitgeprägt hat. Obwohl es, betrachtet man das Thema eher schon zum Naturalismus gezählt werden müsste.
Auf den Spätrealismus oder auch Idealrealismus genannt, deuten bestimmte Elemente hin:
- Der Roman gibt eine authentische Schilderung sozialer Umstände wieder.
- Die Autorin war geprägt von der österreichischen Spätaufklärung, was sich in den zwar nur am Rande angerissenen Themen, wie die Probleme, die die Bauernbefreiung, die Aufhebung der Fronpflichten und die Gemeindeautonomie nach sich zogen, zeigt.
- Ebenso sind im Roman ironisch angehauchte Elemente bzw. Zitate von
,,Naturalisten" und ,,falschen Liberalisten", also Figuren, die liberal reden, aber nicht danach handeln.
5.
Im Zusammenhang mit dem Roman interessant wäre es auch zu betrachten, wie ,,Zigeunerfiguren" in der Literatur des Spätrealismus behandelt wurden.
- Das ,,Zigeunerleben" spielte sich erstmals nicht mehr nur im Wald ab, sondern wurde an den Dorf- bzw. Stadtrand verlagert.
- Von diesem Zeitpunkt an wurden diese Menschen als Menschen mit eigenen Bedürfnissen und Gedanken dargestellt.
- Ein Defizit war allerdings, dass sich die Handlung meist um ,,Zigeunerkinder" drehte, die so lange umerzogen wurden, bis sie dem dichterischen Ideal entsprachen.
Allerdings ist dazu abschließend zu sagen, dass auch durch die Bilder eines guten, in die Gemeinschaft integrierbaren ,,Zigeuner", die Vorurteile der Gesellschaft von der Andersoder Abartigkeit des ,,Zigeunerstammes" nicht entkräftet werden konnten.
6.
Des weiteren auffällig ist die Entwicklung der Sprachanteile der Hauptfigur Pavel.
- Anfangs als stumm beschrieben, wird die Gestalt Pavels mehr oder weniger vom Erzähler bevormundet.
- Im Fortgang der Handlung tritt der Erzähler immer mehr in den Hintergrund. Pavel wird langsam vom Objekt zum Subjekt. Ein Gespräch mit anderen bewirkt in Pavel eine positive Erfahrung und damit einen weiteren Schritt in seiner Sprachmächtigkeit.
- In den letzten Sätzen des Roman bleibt Pavel das Schlusswort überlassen, was eben diesen Gedanken der fertigen Entwicklung, verglichen mit dem Beginn des Romans darstellen soll.
Marie von Ebner-Eschenbach benutzt also die Sprachanteile Pavels für die Aussage der Selbstständigkeit. Sprich: die Sprachanteile nehmen proportional mit der Selbstständigkeit Pavels zu.
7.
Zuletzt noch zu den Aussageabsichten und der Wirkung des Romans.
- Marie von Ebner-Eschenbach schildert die Situation der ländlichen Unterschicht und trifft damit den Nerv der Zeitproblematik.
- Im Roman sind klare sozialkritische Tendenzen zu erkennen, v.a. die Kritik am veraltet denkenden österr. Adel, welche die Autorin meist durch ironische Elemente einfließen lässt.
- von Ebner-Eschenbach wendet sich mit der Figur des Pavel deutlich von den Ansichten des Determinismus ab. Der einzelne bleibt nicht starr in seiner Lage, sondern kann sich selbst ohne Verbesserung der Verhältnisse entfalten.
- Diese Verbesserung der eigenen Lage ist nur möglich durch die Eigeninitiative der jeweiligen Person, wie hier also Pavel.
- Allerdings ist es auch wichtig, nach von Ebner-Eschenbach, dass sich
Individuen, wie z.B. der Lehrer, im Gegensatz zu der nur blass gezeichneten Masse der Gemeinde, um die sich entwickelnde Person annehmen und sie in schwierigen Situationen begleiten.
a.) Ausgangskonstellation
Baronin
Virgil
Vinska + Peter PAVEL Milada Bürgermeister
+ Lehrer Mutter Gemeinde
b.) Konstellation nach dem Treffen mit Milada
Virgil + Vinska Baronin
Milada
Gemeinde
PAVEL Mutter Lehrer
Häufig gestellte Fragen zu "Das Gemeindekind"
Worum geht es in Marie von Ebner-Eschenbachs Roman "Das Gemeindekind"?
Der Roman handelt von Pavel, einem Kind einer Sinti-und-Roma-Familie in Mähren. Nachdem sein Vater den Pfarrer ermordet und seine Mutter fälschlicherweise verurteilt wird, wächst Pavel unter schwierigen Bedingungen auf. Er kämpft mit Vorurteilen, Armut und sozialer Ausgrenzung. Seine Schwester Milada wird im Kloster erzogen. Nach einem Treffen mit seiner Schwester versucht Pavel, sein Leben zu ändern und seinen Ruf zu verbessern. Trotz Rückschlägen und dem Tod seiner Schwester findet er am Ende Trost und Unterstützung bei seiner zurückkehrenden Mutter.
Wer sind die Hauptfiguren in "Das Gemeindekind"?
Die Hauptfiguren sind Pavel, Milada (Pavels Schwester), Virgil (der Hirte, bei dem Pavel aufwächst), Vinska (Virgils Tochter), der Lehrer Habrecht und die Mutter von Pavel und Milada. Ebenso sind die Baronin und der Bürgermeister erwähnenswerte Figuren.
Welche Themen werden in "Das Gemeindekind" behandelt?
Der Roman behandelt Themen wie soziale Ausgrenzung, Vorurteile gegenüber Sinti und Roma, Armut, Kriminalität, die Suche nach Identität, Buße und Sühne, die Bedeutung von Bildung und die Möglichkeit zur Veränderung des eigenen Lebenswegs trotz schwieriger Umstände. Er thematisiert ebenfalls die sozialen Probleme nach der Bauernbefreiung.
In welche Literaturepoche wird "Das Gemeindekind" eingeordnet?
Obwohl der Roman thematisch an den Naturalismus grenzt, wird er hauptsächlich dem Spätrealismus (oder Idealrealismus) zugeordnet. Dies begründet sich durch die authentische Schilderung sozialer Umstände, die Prägung der Autorin durch die österreichische Spätaufklärung und ironische Anspielungen auf Naturalisten und falsche Liberalisten.
Wie werden "Zigeunerfiguren" im Spätrealismus dargestellt, insbesondere in "Das Gemeindekind"?
Im Spätrealismus werden "Zigeunerfiguren" erstmals als Menschen mit eigenen Bedürfnissen und Gedanken dargestellt, wobei ihr Leben sich oft am Rande der Gesellschaft, z.B. am Dorfrand, abspielt. Allerdings werden häufig "Zigeunerkinder" so lange umerzogen, bis sie dem Idealbild der Gesellschaft entsprechen. Trotz dieser Darstellung von Integration werden die Vorurteile der Gesellschaft gegenüber "Zigeunern" nicht vollständig ausgeräumt.
Wie entwickelt sich die Sprache Pavels im Laufe des Romans "Das Gemeindekind"?
Anfangs wird Pavel als stumm und von der Erzählinstanz bevormundet dargestellt. Im Laufe der Handlung wird er immer selbstständiger und seine Sprachanteile nehmen proportional zu seiner wachsenden Unabhängigkeit zu. Am Ende des Romans erhält Pavel das Schlusswort, was seine Entwicklung zu einem selbstbestimmten Individuum symbolisiert.
Welche Aussageabsichten verfolgt Marie von Ebner-Eschenbach mit "Das Gemeindekind"?
Die Autorin möchte die schwierige Situation der ländlichen Unterschicht und die damit verbundenen Probleme aufzeigen. Sie übt Sozialkritik, insbesondere am veralteten Denken des österreichischen Adels, und wendet sich vom Determinismus ab. Sie betont die Bedeutung der Eigeninitiative und der Unterstützung durch einzelne Individuen (wie den Lehrer) für die Verbesserung der eigenen Lebensumstände.
Was sind die wichtigsten Aspekte der Personenkonstellation in "Das Gemeindekind"?
Die Ausgangskonstellation zeigt Pavel als isoliertes Gemeindekind. Die Konstellation verändert sich nach dem Treffen mit seiner Schwester Milada, was Pavels Leben beeinflusst und zur Annäherung an seine Mutter und den Lehrer führt, was ihm neue Orientierungspunkte gibt.
- Quote paper
- Andrea Bretzendorfer (Author), 2000, Ebner-Eschenbach, Marie von - Das Gemeindekind, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97090