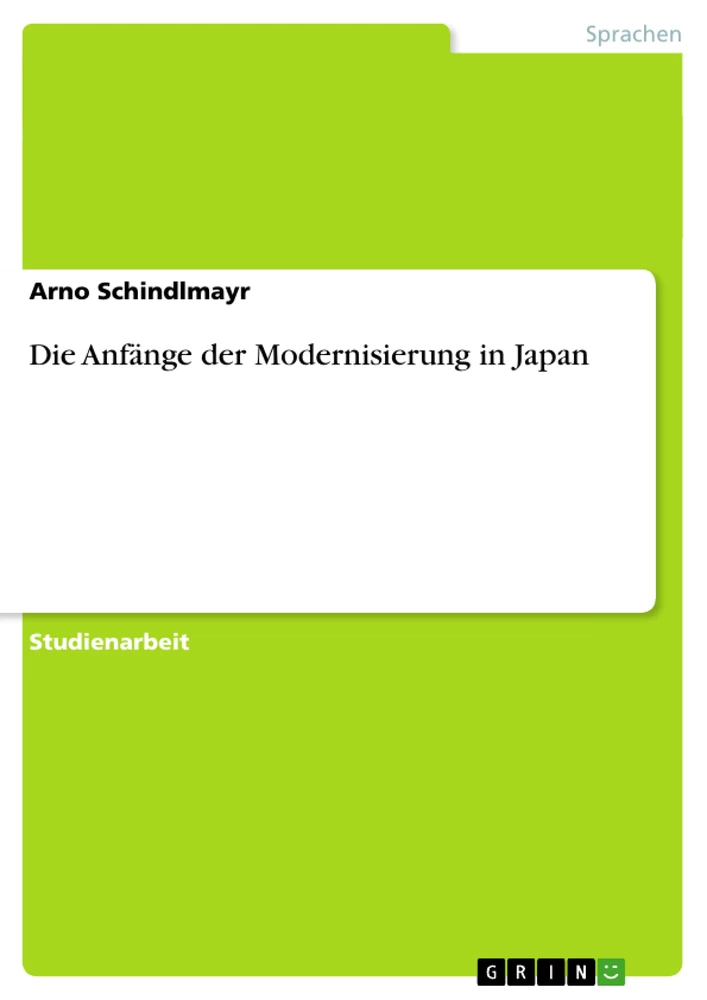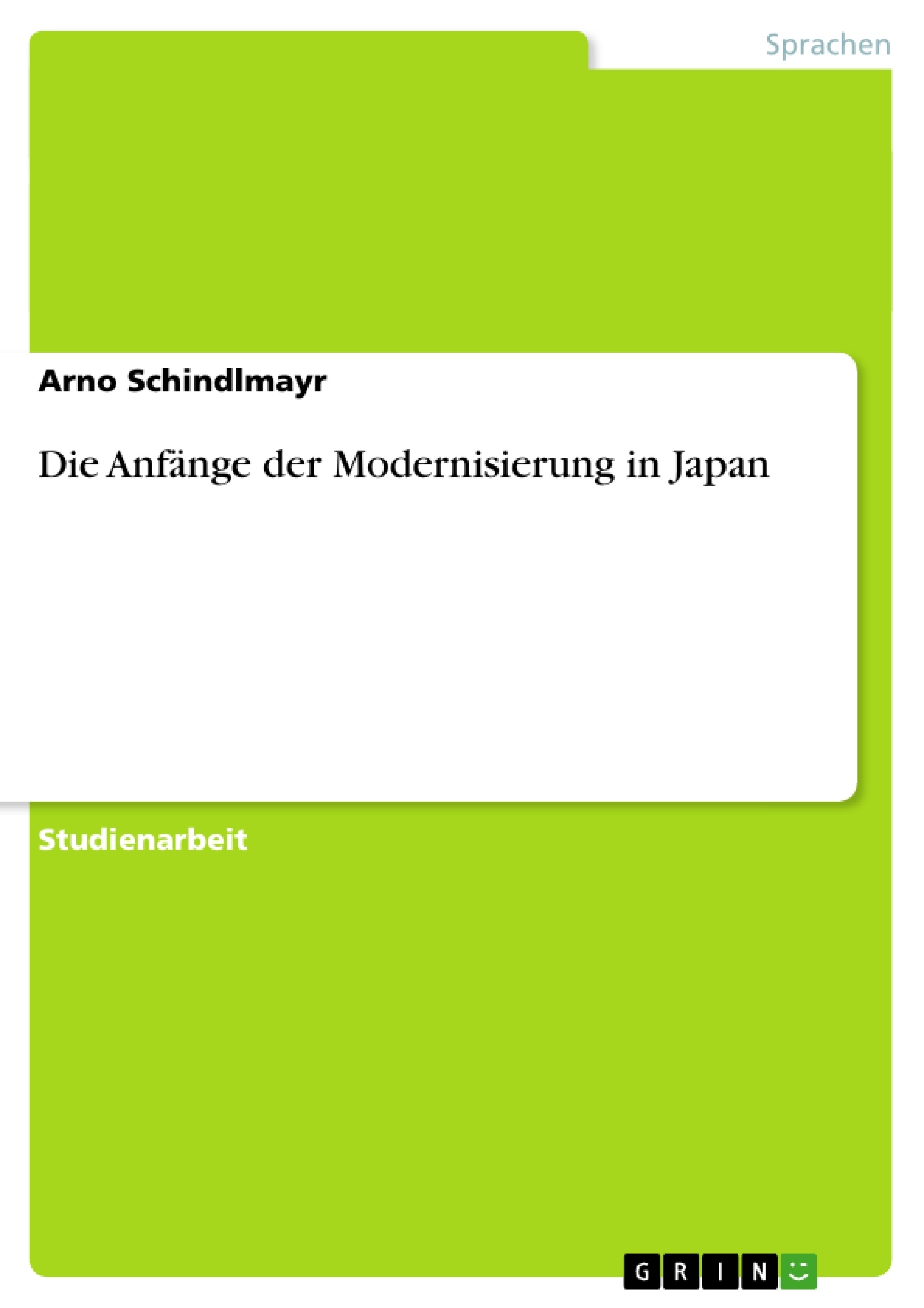In einer Epoche des Umbruchs, als der Ruf nach Veränderung Japans traditionelle Mauern erschütterte, entfaltet sich eine intriguevolle Erzählung von Anpassung und Widerstand. Diese tiefgründige Analyse enthüllt die komplexen Kräfte, die Japans bemerkenswerte Transformation von einem isolierten Inselstaat zu einer modernen Weltmacht im Angesicht des westlichen Imperialismus prägten. Tauchen Sie ein in die Anfänge der japanischen Modernisierung, eine Periode, die von Samurai-Kultur, wirtschaftlichem Wandel und dem Zusammenprall von Tradition und Fortschritt geprägt war. Untersuchen Sie die Edo-Periode, eine Ära strikter sozialer Hierarchien, und entdecken Sie, wie das Tokugawa-Regime die Fäden der Macht zog, während gesellschaftliche und wirtschaftliche Spannungen unter der Oberfläche brodelten. Erleben Sie die erzwungene Öffnung Japans durch Commodore Perry und die daraus resultierenden politischen Turbulenzen, die das Land in eine Zerreißprobe zwischen Isolation und Engagement stürzten. Erkunden Sie die Ideologien der nationalistischen Schulen, die von der Rückbesinnung auf nationale Stärken bis zur kompromisslosen Ablehnung ausländischer Einflüsse reichten, und verstehen Sie, wie diese unterschiedlichen Strömungen die Meiji-Restauration befeuerten. Verfolgen Sie, wie eine kleine Koalition von Reformern die Macht ergriff und einen beispiellosen Modernisierungsprozess nach westlichem Vorbild einleitete, der Japans Wirtschaft, Politik und Militär revolutionierte. Entdecken Sie die Schlüsselstrategien, mit denen Japan seine Souveränität wiedererlangte und sich als gleichwertiger Akteur auf der Weltbühne etablierte, und erfahren Sie, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Diese fesselnde historische Untersuchung bietet nicht nur eine detaillierte Chronik der Ereignisse, sondern auch ein tiefes Verständnis der kulturellen, sozialen und politischen Dynamiken, die Japans Weg zur Moderne so einzigartig und faszinierend machten. Es ist eine Geschichte von Konflikten und Kompromissen, von Tradition und Innovation, die bis heute nachwirkt.
Die Anfänge der Modernisierung in Japan
Die japanische Entwicklung in Folge der Konfrontation mit den westlichen Kolonialmächten stellt in mehrfacher Hinsicht einen Sonderfall dar. Obwohl die Öffnung Japans unter militärischem Druck und vergleichsweise spät stattfand, setzte sie sofort eine energisch vorangetriebene Modernisierung in Gang, die das Land innerhalb weniger Jahrzehnte zum gleichberechtigten Verhandlungspartner des Westens aufsteigen ließ und das Abtreten von Konzessionsgebieten vermied. Rückblickend wird das konstruktive Aufgreifen westlicher Technik und Kultur in Japan daher oft als eine Option gesehen, die Nachbarländern wie China oder Korea ebenso offen stand und ihnen bei rechtzeitiger Erkenntnis der sich daraus ergebenden Chancen eine lange Phase der Kolonisierung und territorialen Konzessionen erspart hätte. Hierbei wird die mögliche Bedeutung landesspezifischer Unterschiede in der historischen Situation jedoch weitgehend ausgeblendet. Im folgenden sollen daher die Faktoren analysiert werden, die für Japans Reaktion auf das Zusammentreffen mit dem Westen entscheidend waren.
Vorgeschichte bis zur Abschließung Japans
Die Aneignung fremder Technik und Kultur nach der Öffnung Japans gegenüber dem Westen im 19. Jahrhundert stellt keinen neuen historischen Präzedenzfall dar, vielmehr waren ausländische Einflüsse bereits seit dem Neolithikum für nahezu alle wichtigen zivilisatorischen Impulse verantwortlich gewesen: Reisanbau, Staatswesen, Schrift, Buddhismus, Kunst und Architektur gehen direkt auf chinesische Vorbilder zurück und entwickelten erst im Lauf der Zeit mehr oder weniger ausgeprägte eigenständige Formen. Auch das politische System orientierte sich zunächst am großen Nachbarn. Im Gegensatz zu den chinesischen Herrschern gelang es den japanischen tennô (Himmelsprinz) aber nicht, eine langfristige politische Hegemonie zu errichten. Der sich emanzipierende Adel gewann zunehmend Einfluß auf den kaiserlichen Hof, während der Kamakura-Periode (1185-1333) und der Muromachi-Periode (1336-1573) lag die tatsächliche Macht schließlich auch offiziell in den Händen eines shôgun (Großmarschall) aus den Reihen des Erbadels. Aus Gründen der Legalität und seiner zentralen Bedeutung für die einheimische shintô-Religion wurde das entmachtete Kaisertum jedoch als Institution formal beibehalten. Da es im folgenden auch den shôgun nicht gelang, die erstarkenden daimyô (lokale Fürsten) wirksam zu kontrollieren, mündete die Muromachi-Periode in eine Epoche des Bürgerkriegs, die nacheinander von Oda Nobunaga (1534-1582), Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) und Tokugawa Ieyasu (1542-1616) entscheidend geprägt wurde. Dem Geschick, dem Glück und der Skrupellosigkeit dieser drei Männer, die nach und nach ihre Konkurrenten ausschalten und immer größere daimyô- Verbände um sich versammeln konnten, verdankt Japan seine erneute Einigung unter einer zentralen Gewalt.
Mitten in diese unruhige Epoche des Bürgerkriegs fiel Japans erster Kontakt mit portugiesischen Seefahrern, die ihre Handelsrouten entlang der ostasiatischen Küsten kontinuierlich ausbauten und 1543 erstmals an der südlich vorgelagerten Insel Tanegashima landeten. Nur wenige Jahre später stießen Erkundungsschiffe bis zum japanischen Mutterland vor. Obwohl sich in der Folgezeit auch Handelsbeziehungen entwickelten, bildete die christliche Missionierung doch eindeutig den Schwerpunkt der portugiesischen Aktivitäten in Japan. Begünstigt vom Auseinanderbrechen der einheimischen politischen Strukturen gewann vor allem der neu gegründete Jesuitenorden unter dem seit 1549 in Japan tätigen St. Francis Xavier (1506-1552) eine große Anhängerschaft. Auf der anderen Seite hatte der Kontakt mit dem Westen aber auch unmittelbare Auswirkungen auf den Verlauf des Bürgerkriegs, da mit den portugiesischen Seefahrern europäische Schußwaffen ins Land kamen, die von den streitenden Parteien auf Grund ihrer überlegenen Feuerkraft begierig angenommen wurden. Beide Faktoren beunruhigten die siegreichen militärischen Führer in erheblichem Maße, als sich der Bürgerkrieg seinem Ende zuneigte, weil sie Widerstandszellen gegen die sich neu formierende Zentralgewalt begünstigten. Die christliche Mission konnte darüber hinaus als mögliche Vorhut eines umfassenderen europäischen Engagements in Japan gesehen werden, so wie sie zuvor in Amerika Eroberung und Kolonisation nach sich gezogen hatte. Dieser Zusammenhänge war sich Toyotomi Hideyoshi durchaus bewußt, als er 1587 ein Verbot der Missionierung und im Folgejahr auch die Konfiszierung aller Schußwaffen verfügte.
Die Ernennung von Tokugawa Ieyasu, der sich nach Hideyoshis Tod in der Schlacht von Sekigahara 1600 gegen seine Rivalen durchsetzen kann, zum shôgun markiert das Ende des Bürgerkriegs und den Beginn der Edo-Periode (1603-1867), die wie die vorhergehenden Phasen der japanischen Geschichte nach dem Sitz der jeweiligen Militärregierung benannt ist (Edo wurde 1868 zu Tôkyô). Nach der offiziellen Anerkennung seines Machtanspruchs bestand Ieyasus Absicht darin, das Land unter seine absolute Kontrolle zu bringen und die Herrschaft seiner Familiendynastie auf diese Weise dauerhaft zu sichern. Mit der Präsenz einer aggressiven und intoleranten fremdländischen Religion wie dem Christentum jener Zeit wäre dieses Ziel nicht zu verwirklichen gewesen, so daß die schon früher in Kraft getretenen Sanktionen nun verschärft und rigoros durchgesetzt wurden. Der Ausweisung aller Missionare 1614 folgen bald Pogrome und staatliche Zwangsmaßnahmen, die schließlich zur nahezu vollständigen Auslöschung des Christentums in Japan führten. Den Schlußpunkt dieser Politik markierte die vom dritten shôgun der Tokugawa-Dynastie, Iemitsu, verfügte Isolation Japans im Jahr 1639. Den einzigen Kontakt zur Außenwelt bildeten fortan chinesische und niederländische Händler, die ihre Geschäfte unter strengen Auflagen und ausschließlich über die eigens hierfür künstlich aufgeschüttete Insel Deshima in der Bucht von Nagasaki durchführen durften. Letztere wurden toleriert, weil sie als reformierte Calvinisten nicht mit den ausgewiesenen katholischen Orden in Verbindung gebracht wurden und ihrerseits keine Missionierungsabsichten zeigten.
Die Doktrin von der destabilisierenden Wirkung westlich-christlicher Einflüsse prägte die japanische Außenpolitik während der gesamten Edo-Periode. Die Isolation konnte über zwei Jahrhunderte lang funktionieren, weil Japan geographisch nur an der Peripherie europäischer Interessen lag und sämtliche Exportwaren (Rohseide, Tee, Kupfer, Lackwaren, Fischereiprodukte) auch in anderen Ländern der Region, namentlich China, ohne den erbitterten Widerstand der dortigen Regierungen zu erwerben waren. Erst als Rußland und die USA am Ende des 18. Jahrhunderts zu pazifischen Seemächten aufstiegen und Japan auf Grund dieser geopolitischen Verschiebung eine neue strategische Bedeutung zukam, änderte sich die Situation.
Gesellschaftliche Entwicklung während der Edo-Periode
Während die japanische Führungselite zur Sicherung der eigenen Machtposition feindselige Vorstellungen des Fremden konservierte und das Land isolierte, betrieb sie in Abgeschiedenheit von der Außenwelt den Aufbau jener sozialrestaurativen Feudalgesellschaft, die sich am Ende der Edo-Periode erneut mit amerikanischer und europäischer Intervention auseinandersetzen mußte. Als oberster Lehnsherr fungierte der shôgun, dessen Titel innerhalb des Hauptzweigs der Tokugawa-Familie vererbt wurde. Die von der Verwandtschaft des shôgun direkt regierten Ländereien umfaßten strategisch bedeutsame und ertragreiche Regionen im Zentrum der Hauptinsel Honshu, die insgesamt fast ein Viertel der gesamten Reisernte Japans lieferten und die Vormachtstellung der Dynastie sicherten. Wie schon in früheren Epochen wurde die Fiktion der kaiserlichen Herrschaft aus Legalitätsgründen weiter beibehalten, die tatsächliche Marginalisierung des Hofes in Kyôto drückt sich aber in nichts so deutlich aus wie in der Errichtung eines neuen nationalen Regierungsapparats um die Burg des shôgun im weit entfernten Edo. Um eine koordinierte Opposition gegen das Regime zu verhindern, war anderen Fürsten der Besuch am kaiserlichen Hof untersagt. Dies betraf insbesondere die lokal regierenden daimyô, deren Zahl 295 zu Beginn des 17. Jahrhunderts und 276 am Ende der Edo-Periode betrug. Obwohl als direkte Lehnsempfänger per Eid an den shôgun gebunden, wurden zusätzlich umfangreiche Maßnahmen zu ihrer politischen und wirtschaftlichen Kontrolle implementiert. Hierzu zählten insbesondere eine persönliche Residenzpflicht in Edo in jedem zweiten Jahr und eine Entsendung engster Familienangehöriger zu anderen Zeiten sowie die Heranziehung zu militärischen und administrativen Dienstleistungen und Infrastrukturprojekten. Als Lehnsherr besaß der shôgun das Recht, Ländereien zu entziehen oder neu zuzuteilen, familiäre Verbindungen zwischen daimyô-Clans bedurften seiner ausdrücklichen Genehmigung. Trotz dieser Maßnahmen und einer strategisch-politischen Klassifizierung nach Grad ihrer Verbundenheit mit der Tokugawa-Dynastie, die den Zugang zu politischer Macht am Hof des shôgun regelte, blieben die daimyô auf Grund ihrer militärischen Hausmacht stets der größte potentielle Risikofaktor für das Regime.
Die Gesellschaft der Edo-Periode zeichnet sich durch eine strikte Gliederung in samurai, Bauern, Handwerker und Händler aus, die jeweils strengen Verhaltens- und Beschäftigungsauflagen unterworfen waren. Ausgestoßene und Unreine standen noch außerhalb dieser Klassifizierung, die sich an der wirtschaftlichen Bedeutung der jeweiligen Bevölkerungsgruppen innerhalb des Agrarsystems orientierte. Die samurai bildeten als Kriegerstand und Vasallen der daimyô das Rückgrat des Feudalstaats, als Bildungselite besetzten sie gleichzeitig wichtige Führungsposten in der Verwaltung. Landesweit zählte gegen Ende der Edo-Periode jeder achtzehnte Japaner zum Kriegerstand, wobei das Verhältnis regional stark variierte. Im Lauf der Zeit geriet das sozialrestaurative Feudalsystem jedoch in immer größeren Gegensatz zu der sich ausbreitenden markt- und profitorientierten Geldwirtschaft. Steigende Ausgaben für Repräsentations- und Militärpflichten sowie Mißwirtschaft sorgten bald für ein chronisches Defizit in den Kassen aller Ebenen der Feudalhierarchie, obwohl sich die landwirtschaftliche Produktion bei einer gleichbleibenden Bevölkerungszahl von etwa 26 Millionen stetig erhöhte. Wenngleich einige Bauern von dieser Entwicklung auch profitierten und selbst zu wohlhabenden Grundbesitzern aufstiegen, nahmen Landflucht und Unruhen wegen wachsender Abgabenlasten zu. Diese Proteste blieben jedoch sporadisch und unkoordiniert, somit auch nicht systemgefährdend. Ein großes Problem stellte hingegen die Verarmung der gebildeten und zum Teil politisch ambitionierten samurai dar, die finanziell von ihren daimyô abhingen.
Die vom Tokugawa-Regime unterstützte konfuzianische Schule, die sich auf den chinesischen Gelehrten Chu Hsi (1130-1200) der Sung-Dynastie berief, entwickelte sich im Lauf der Edo- Periode zur offiziellen Staatsphilosophie. Neben das zentrale Vater-Sohn-Verhältnis trat in der japanischen Interpretation jedoch mindestens gleichberechtigt die Beziehung zwischen Regierenden und Regierten, die von den gleichen Idealen wie Fürsorgepflicht und Loyalität geprägt sein sollte. Hierdurch wurde nicht nur die existierende politische und gesellschaftliche Hierarchie gestärkt, sondern auch eine Zurückstellung von Individual- gegenüber Gruppeninteressen eingefordert - ein Leitmotiv, das sich ebenso im Buddhismus wie auch im Kodex der samurai, dem bushidô, findet und das die Edo-Periode weit überlebte. Trotz eines Verbots aller heterodoxen Philosophien von 1790 fanden alternative Denkschulen angesichts der wachsenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme jedoch immer größeren Anklang. Obwohl diese selten als homogene Gruppen auftraten, lassen sich doch vier Hauptströmungen ausmachen, die alle auf verschiedene Weise die Isolation Japans unterminierten: Die niederländische Schule (rangaku), die pragmatischen Kritiker der herrschenden Ordnung, die dem Konfuzianismus nahe stehenden Nationalisten der Mito- Schule und die ultrareaktionäre Nationale Schule.
Die niederländischen Schule, die von der teilweisen Aufhebung des Importverbots ausländischer Bücher im Jahr 1720 erheblich profitierte, hatte sich der Verbreitung westlichen Wissens in Japan verschrieben. Als solche unpolitisch, stand sie einer weitergehenden Öffnung des Landes jedoch positiv gegenüber und erzwang durch ihre praktischen Erfolge eine anhaltende Auseinandersetzung mit diesem Thema. Disziplinen wie Astronomie, Landvermessung oder Kartographie genossen die offizielle Unterstützung staatlicher Stellen. Die größte Umwälzung fand jedoch in der Medizin statt, wobei der Aufenthalt des deutschen Philipp Franz von Siebold (1796-1866) als Faktoreiarzt der niederländischen Handelsniederlassung auf Deshima von 1823 bis 1828 und die Eröffnung seiner Praxis in Nagasaki in besonderer Weise zur Propagation westlicher medizinischer Kenntnisse beitrugen.
Vordenker und pragmatische Kritiker der herrschenden Ordnung befaßten sich neben westlicher Wissenschaft auch mit zentralen politischen Themen wie Japans Verhältnis zum Ausland und Fragen der nationalen Verteidigung. Als Katalysator fungierten die beunruhigende Zunahme ausländischer Schiffssichtungen vor der japanischen Küste seit dem späten 18. Jahrhundert und insbesondere die chinesische Niederlage gegen die westlichen Kolonialmächte im Opiumkrieg 1839-1842. Verteidigungsfähigkeit erforderte nach Ansicht dieser Gruppe die zielgerichtete Sanierung der Wirtschaft und Stärkung der Nation (fukoku kyôhei), die sich nur durch eine starke Zentralregierung und die Aneignung moderner westlicher Militärtechnik erreichen lasse.
Die Anhänger der Mito-Schule, benannt nach ihrer Hochburg in der Region Mito, ebenso wie der Nationalen Schule sahen die Lösung der aktuellen Probleme dagegen in einer Rückbesinnung auf nationale Stärken und Traditionen. In beiden Gruppen fand die Verbindung des Kampfes gegen die ausländischen Barbaren mit der Verehrung des Kaiserhauses als Symbol Japans (sonnô jôi) immer mehr Anklang. Während die Nationalisten der Mito-Schule jedoch konfuzianisch ausgerichtet waren und vordringlich westliche Ideen bekämpften, forderte die ultrareaktionäre Nationale Schule eine kompromißlose Ausrottung aller ursprünglich ausländischen Einflüsse einschließlich Konfuzianismus und Buddhismus. Zentrales Thema ihrer im shintô verwurzelten, ethnozentrischen und häufig offen xenophobischen Philosophie war die göttliche Schöpfung und Auserwähltheit Japans, das dazu bestimmt sei, die Welt zu beherrschen. Eigene Expansion und Kolonisation über die Landesgrenzen hinaus wurden folglich als natürliche Mission betrachtet.
Die Öffnung Japans
Die Kolonisation Sibiriens und der Westküste der USA im 18. Jahrhundert veränderte die strategische Lage Japans grundlegend. Die russische und amerikanische, aber auch die englische Marine verstärkte ihre Aktivitäten im Nordpazifik, und vermehrt näherten sich nun Schiffe japanischen Häfen in der Absicht, Handelsbeziehungen einzuleiten. Die Regierung reagierte 1825 mit dem Befehl, alle ausländischen Schiffe gewaltsam aus japanischen Küstengewässern zu vertreiben, hob diesen aber 1842 angesichts der chinesischen Niederlage im Opiumkrieg teilweise wieder auf, um keine militärische Intervention der Kolonialmächte zu provozieren. Grundsätzlich blieb die Isolationspolitik jedoch weiterhin in Kraft und änderte sich auch nicht, als der niederländische König Wilhelm II dem shôgun zwei Jahre später in einem Brief die weltpolitische Lage erläuterte und ihm eine Öffnung der Grenzen nahe legte. Um den anhaltenden japanischen Widerstand zu brechen, entsandten die USA schließlich einen Flottenverband unter Commodore Matthew Calbraith Perry, der am 8.7.1853 in der Bucht von Edo einlief und unter Androhung militärischer Strafmaßnahmen ein entsprechendes Ultimatum überbrachte.
Dieses Ultimatum stürzte Japans Regierung, die die Außenwelt Jahrhunderte lang ignoriert hatte, in ihre bisher größte Krise und spaltete die Berater des shôgun. Der Versuch, unter Einbeziehung der Fürsten und des Kaiserhauses einen nationalen Konsens hinsichtlich des weiteren Vorgehens zu bilden, scheiterte an mehrheitlich unrealistischen Positionen. Während zahlreiche Pragmatiker für ein Spiel auf Zeit und eine möglichst behutsame Öffnung plädierten, forderten einflußreiche daimyô wie Tokugawa Nariaki (1800-1860), der Fürst von Mito und Sponsor der dortigen nationalistischen Denkschule, die Fortsetzung der Isolation unter Inkaufnahme einer militärischen Auseinandersetzung. Da die Aufwertung der daimyô am Ende nicht mit einer einheitlichen Strategie einher ging, schwächte sie den shôgun nur politisch. Als noch verhängnisvoller erwies sich, daß der unter den Einfluß nationalistischer Berater gekommene Kaiser Kômei (1831-1866) zum Fokus der Opposition aufstieg. Das Dilemma der Regierung zwischen mehrheitlich befürworteter Isolation und Realpolitik verschärfte sich, als Perrys Rückkehr mit einer nochmals verstärkten Flotte sie im Frühjahr 1854 zwang, den von den USA vorgelegten Vertragsentwurf ohne Konsens mit den Fürsten zu unterzeichnen. Kernpunkte waren die Öffnung der Häfen Hakodate und Shimoda zur Versorgung amerikanischer Schiffe mit Kohle und Proviant, die wohlwollende Behandlung gestrandeter Seeleute, die Zusicherung von Exterritorialitätsrechten für Ausländer und die Residenz eines amerikanischen Konsuls in Shimoda. Schon bald folgten ähnliche Verträge mit England, Frankreich, Rußland und den Niederlanden sowie 1858 ein Handelsvertrag mit den USA, der gleichzeitig die Öffnung weiterer Häfen und Zollbestimmungen regelte.
Im Streit um die Nachfolge von shôgun Iesada (1824-1858) trat die innenpolitische Spannung offen zutage. Ii Naosuke (1815-1860) verhinderte als Führer der pragmatischen Fraktion zwar die Ernennung von Nariakis Sohn Yoshinobu (1837-1913) und ebnete den Weg für den jungen Iemochi (1850-1866), einen Cousin des Verstorbenen, fiel dafür aber bald einem politischen Attentat zum Opfer. Der nach dieser ersten Eskalation begonnene Versuch einer Annäherung von Thron und Militär (kôbu gattai), durch die Heirat Iemochis mit einer kaiserlichen Prinzessin symbolisch besiegelt, mußte jedoch scheitern, da sich die erpreßte Zusage der Regierung, die vertraglich bereits zugesicherte Öffnung Japans wieder aufzuheben, nicht realisieren ließ. Die Enttäuschung der Anhänger von sonnô jôi führte so zu einer Extremisierung, in der nationalistische Gruppen nicht mehr nur mit politischen, sondern auch mit gewaltsamen Mitteln gegen die Regierung vorgingen.
Zu den radikalisierten Anhängern von sonnô jôi, den shishi, die mit terroristischen Taktiken sowohl gegen Funktionäre der Regierung als auch gegen Ausländer von sich reden machten, zählten vorwiegend niederrangige, junge samurai aus Randgebieten Japans, insbesondere Satsuma und Chôshû im Süden, die sich durch hervorragenden Schwertkampf, Betonung des bushidô, Intoleranz und hohe Gewaltbereitschaft auszeichneten. Obwohl sie selbst in ihren Heimatregionen eine Minderheit darstellten, übten sie auf Grund ihres rücksichtslosen Vorgehens großen Einfluß auf die lokale Politik aus und konnten oft unbehelligt eigene Machtzentren aufbauen. Der offene Kampf gegen die Fremden durch Überfälle und den Beschuß passierender Schiffe vom Land aus war jedoch zum Scheitern verurteilt, weil ihnen Strafexpeditionen der westlichen Mächte dank überlegener Feuerkraft unverhältnismäßig hohe Verluste zufügten und sie damit auch in ihrem innenpolitischen Kampf gegen die Regierung entscheidend zu schwächen drohten. Weitsichtigere politische Führer der shishi, die die Überlegenheit westlicher Technik nunmehr am eigenen Leib erfahren hatten, schwenkten nach dieser Feuertaufe auf einen neuen Kurs ein und rüsteten gezielt auf, gerade auch durch Aufkauf moderner westlicher Waffen. Die Mittel hierfür stammten im Fall Chôshûs aus einem über mehrere Jahre für Notfälle angesparten Reservefonds und im Fall Satsumas aus der finanziellen Ausbeutung des Monopols für Zuckerrohr von den südlich vorgelagerten Inseln.
Pläne der Regierung, der anhaltenden Krise mit einer stärkeren Machtkonzentration zu Ungunsten der daimyô zu begegnen, führten zur Einigung der oft unkoordinierten und von Eigeninteressen getragenen Opposition, die das politische Vakuum nach Iemochis Tod zum entscheiden Schlag nutzte. Um einen drohenden, desaströsen Bürgerkrieg abzuwenden, der die westlichen Mächte auf den Plan gerufen und die Unabhängigkeit Japans gefährdet hätte, gab der nunmehr unumstrittene Yoshinobu im November 1867 als letzter shôgun seine Machtbefugnisse offiziell an den jungen Kaiser Meiji zurück und besiegelte damit das Ende der Edo-Periode. Trotzdem kam es im Folgejahr durch gezielte Provokation noch zum militärischen Showdown, weil die siegreichen daimyô eine starke Rolle des nach wie vor einflußreichen Tokugawa-Clans in der neuen Ordnung nicht hinzunehmen bereit waren. Seiner politischen Macht beraubt und von Verbündeten weitgehend allein gelassen, unterlag Yoshinobu in der Schlacht von Toba-Fushimi wie von seinen Gegnern erwartet.
Das neue Vordringen der westlichen Kolonialmächte und die erzwungene Öffnung Japans hatten so zu einer Polarisierung des innenpolitischen Konflikts geführt, die der lange von politischer Macht am Hof des shôgun ausgeschlossenen daimyô-Fraktion immer mehr Zulauf bescherte und sie so in ihrer fundamentalistischen Opposition bestärkte. Gleichzeitig erfuhr sie als erste am eigenen Leib die Überlegenheit der westlichen Kriegstechnik und zog daraus entsprechende Konsequenzen, indem sie mit Hilfe europäischer Waffenhändler eine massive Aufrüstung forcierte, die ihr im innenpolitischen Konflikt schließlich entscheidende Vorteile verschaffte. Ihr hoher Durchsetzungswille, der auch vor extremer Gewaltanwendung nicht zurückschreckte, und die Fanatisierung vieler shishi taten ein Übriges. Das Ausbleiben westlicher Interventionen trotz zahlreicher Provokationen seitens der shishi verdankt Japan nicht zuletzt der Geduld der Kolonialmächte, die auch bereit waren, Verzögerungen bei der Umsetzung vertraglicher Zugeständnisse hinzunehmen. Das geringe wirtschaftliche Interesse am Handel mit Japan, in direktem Kontrast zu China, war hierfür wohl der ausschlaggebende Faktor. Die USA, die von Anfang an eine Vorreiterrolle bei der Öffnung Japans spielten, waren in erster Linie an der Versorgung ihrer Kriegs-, Handels- und Walfangflotten in japanischen Häfen interessiert und neigten für die Durchsetzung dieses Ziels nur begrenzter militärischer Eskalation zu.
Meiji-Restauration und Modernisierung
Obwohl die Restauration den jungen Kaiser Meiji formal als direkten Herrscher einsetzte, wurde die politische Richtung nach 1867 tatsächlich von einer relativ kleinen und homogenen Koalition aus Hofadligen und Vertretern der siegreichen Provinzen, namentlich Chôshû und Satsuma, bestimmt. Obwohl diese Gruppe, zuerst aus ideologischer Überzeugung und später, als sie bereits selbst mit ausländischen Waffenhändlern und Beratern kooperierte, vornehmlich opportunistisch, mit ihrem Eintreten gegen die Öffnung Japans polarisierte, bewies sie nach ihrem Sieg einen pragmatischen Realitätssinn und leitete eine rasche Modernisierung Japans nach westlichem Vorbild ein. Diese Kehrtwende war möglich, weil es nach der Schlacht von Toba-Fushimi keine nennenswerte rivalisierende Gruppierung mehr gab, die durch Ausnutzung dieser augenscheinlichen Widersprüche eine Gegenfront von Unzufriedenen hätte bilden können. Ausschlaggebend hierfür wiederum war die, im Vergleich zu China, geringe Größe Japans. Natürlich zeigten sich viele radikalisierte shishi enttäuscht über diese Entwicklung, aber trotz anhaltender Protestaktionen stellten sie ohne wirksame Lenkung durch eine politische Führung keine existentielle Gefährdung für den neuen politischen Kurs dar. Für die neuen Machthaber dienten Modernisierung und Industrialisierung allerdings vor allem Absichten, in denen sie durchaus Kontinuität bewies:
Die Sanierung der Wirtschaft und Stärkung der Nation (fukoku kyôhei) sowie das Streben nach einer weltpolitischen Rolle, die ihrer Idee von der göttlichen Auserwähltheit Japans Rechnung trug. Vor allem dieser zweite Punkt stand in direkter Tradition der Nationalen Schule. Zum wichtigsten symbolischen Ziel avancierte die Revision der ungleichen Verträge mit den westlichen Kolonialmächten, die Japans untergeordneten Rang dokumentierten. Paradoxerweise erwies sich also gerade der gegen den Westen gerichtete Nationalismus als entscheidende Triebfeder für die Modernisierung.
Die ersten Maßnahmen der Regierung zielten sich vor allem auf eine Förderung des Wirtschaftswachstums ab und beinhalteten die Abschaffung des gesellschaftlichen Vierklassensystems mit seinen strengen Berufseinschränkungen, die Auflösung der früheren Feudalterritorien mit finanzieller Entschädigung der daimyô und staatliche Infrastrukturprojekte. Schon 1869 ging die erste Telegraphenleitung zwischen Tôkyô und Yokohama in Betrieb, drei Jahre später verkehrte die erste Eisenbahn zwischen den beiden Städten und ein landesweites Postsystem entstand. Als Wissensvermittler fungierten sowohl japanische Studenten, die mit Stipendien ins Ausland entsandt wurden oder aus eigener Initiative diesen Weg beschritten (1873 insgesamt 373), als auch von staatlichen oder privaten Unternehmen verpflichtete ausländische Berater, deren Zahl im Spitzenjahr 1874 insgesamt 524 betrug. Selbst Regierungsangehörige bereisten Amerika und Europa, um sich aus erster Hand über die verschiedenen Staats- und Wirtschaftsformen zu informieren und die erfolgreichsten Modelle anschließend zur Übernahme in Japan zu empfehlen. Als deutlich wurde, daß die westlichen Länder trotz Anerkennung der japanischen Modernisierungsanstrengungen nicht bereit waren, ohne garantierte Rechtssicherheit auf die Exterritorialität ihrer Staatsangehörigen zu verzichten, erweiterte die Regierung ihr Reformprogramm auf das Justizsystem. Am Ende dieser Entwicklung stand 1889 eine Verfassung nach preußisch-deutschem Vorbild, die Japan als konstitutionelle Monarchie definierte. Ein Durchbruch in Pilotverhandlungen mit England ermöglichte schließlich die lange ersehnte Revision der Verträge: 1899 gewann Japan die Souveränität der Jurisdiktion über ausländische Staatsbürger und zehn Jahre später seine Zollautonomie zurück, zu einer Zeit, als das Land durch militärische Operationen in Korea und China faktisch schon längst selbst in den Kreis der Kolonialmächte aufgestiegen war.
Quellen
Mikiso Hane, Modern Japan (Westview Press, Boulder, 1986).
John H. Gubbins, The Making of Modern Japan (New World Book Manufacturing, Hallandale, 1922; Nachdruck: Books for Libraries, Freeport, New York, 1971).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Die Anfänge der Modernisierung in Japan"?
Der Text analysiert die japanische Modernisierung nach der Konfrontation mit westlichen Kolonialmächten. Er untersucht, warum Japan im Vergleich zu anderen Ländern in der Region so schnell modernisierte und eine Kolonisierung vermied. Der Text beleuchtet die historischen Faktoren, die Japans Reaktion auf den Westen beeinflussten.
Welche historischen Präzedenzfälle der Aneignung fremder Kultur werden genannt?
Der Text erwähnt, dass ausländische Einflüsse, insbesondere aus China, seit dem Neolithikum in Japan präsent waren. Beispiele hierfür sind Reisanbau, Staatswesen, Schrift, Buddhismus, Kunst und Architektur.
Wie gestaltete sich die politische Situation vor der Öffnung Japans?
Im Gegensatz zu China gelang es den japanischen Kaisern (tennô) nicht, eine langfristige politische Hegemonie zu errichten. Die Macht verlagerte sich zunehmend zum Adel und später zu den Shôgunen. Die Muromachi-Periode mündete in eine Epoche des Bürgerkriegs, die von Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu geprägt wurde, die Japan wieder einigten.
Welche Rolle spielte der Kontakt mit portugiesischen Seefahrern?
Portugiesische Seefahrer landeten 1543 erstmals in Japan und brachten europäische Schusswaffen ins Land. Dies beeinflusste den Verlauf des Bürgerkriegs. Gleichzeitig begann die christliche Missionierung, insbesondere durch den Jesuitenorden, was von den militärischen Führern mit Sorge betrachtet wurde.
Warum wurde Japan isoliert (Sakoku)?
Tokugawa Ieyasu isolierte Japan, um das Land unter seine absolute Kontrolle zu bringen und die Herrschaft seiner Familiendynastie zu sichern. Das Christentum wurde als destabilisierende fremdländische Religion angesehen. Die Isolation erfolgte 1639, wobei nur chinesische und niederländische Händler unter strengen Auflagen Handel treiben durften.
Wie sah die Gesellschaft während der Edo-Periode aus?
Die Gesellschaft war strikt in samurai, Bauern, Handwerker und Händler gegliedert. Der Shôgun fungierte als oberster Lehnsherr. Das Feudalsystem geriet jedoch in Gegensatz zur wachsenden Geldwirtschaft, was zu Verarmung der samurai und Unruhen unter den Bauern führte.
Welche alternativen Denkschulen gab es trotz des Verbots heterodoxer Philosophien?
Es gab vier Hauptströmungen, die die Isolation Japans unterminierten: die niederländische Schule (rangaku), pragmatische Kritiker der herrschenden Ordnung, die dem Konfuzianismus nahe stehenden Nationalisten der Mito-Schule und die ultrareaktionäre Nationale Schule.
Was war die niederländische Schule (Rangaku)?
Die niederländische Schule verbreitete westliches Wissen in Japan. Sie profitierte von der teilweisen Aufhebung des Importverbots ausländischer Bücher im Jahr 1720. Besonders die Medizin erfuhr große Fortschritte, unterstützt durch den deutschen Arzt Philipp Franz von Siebold.
Wie kam es zur Öffnung Japans?
Die Kolonisation Sibiriens und der Westküste der USA veränderte die strategische Lage Japans. Commodore Matthew Calbraith Perry erzwang 1853 mit einem Flottenverband die Öffnung Japans, indem er ein Ultimatum unter Androhung militärischer Strafmaßnahmen überbrachte.
Welche Folgen hatte die erzwungene Öffnung?
Die erzwungene Öffnung stürzte die japanische Regierung in eine Krise und spaltete die Berater des Shôgun. Es wurden Verträge mit den USA, England, Frankreich, Russland und den Niederlanden geschlossen, die die Öffnung weiterer Häfen und Zollbestimmungen regelten.
Was war die Meiji-Restauration?
Die Meiji-Restauration setzte den Kaiser Meiji formal als direkten Herrscher ein, aber die politische Richtung wurde von einer Koalition aus Hofadligen und Vertretern der siegreichen Provinzen bestimmt. Sie leiteten eine rasche Modernisierung Japans nach westlichem Vorbild ein.
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen der Meiji-Restauration ergriffen?
Zu den Maßnahmen gehörten die Abschaffung des gesellschaftlichen Vierklassensystems, die Auflösung der Feudalterritorien, staatliche Infrastrukturprojekte, die Einführung von Telegraphen- und Eisenbahnlinien sowie ein Postsystem. Es wurden japanische Studenten ins Ausland entsandt und ausländische Berater engagiert. 1889 wurde eine Verfassung nach preußisch-deutschem Vorbild eingeführt.
Was waren die Ziele der Modernisierung unter Meiji?
Die Hauptziele waren die Sanierung der Wirtschaft und Stärkung der Nation (fukoku kyôhei) sowie das Streben nach einer weltpolitischen Rolle. Ein wichtiges Ziel war auch die Revision der ungleichen Verträge mit den westlichen Kolonialmächten.
- Quote paper
- Arno Schindlmayr (Author), 2000, Die Anfänge der Modernisierung in Japan, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97069