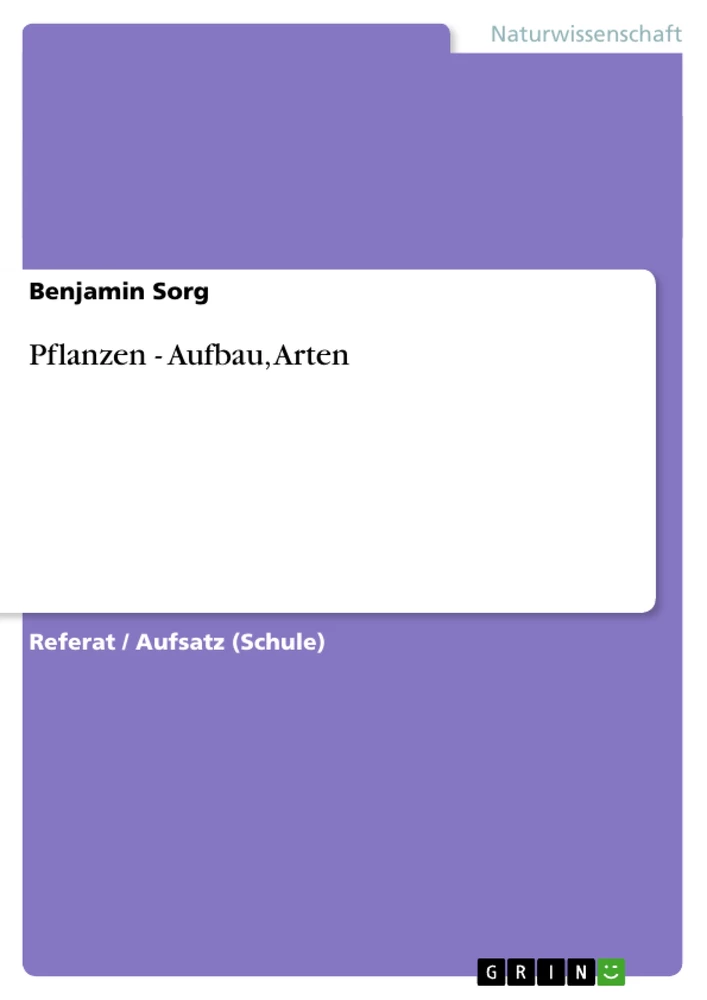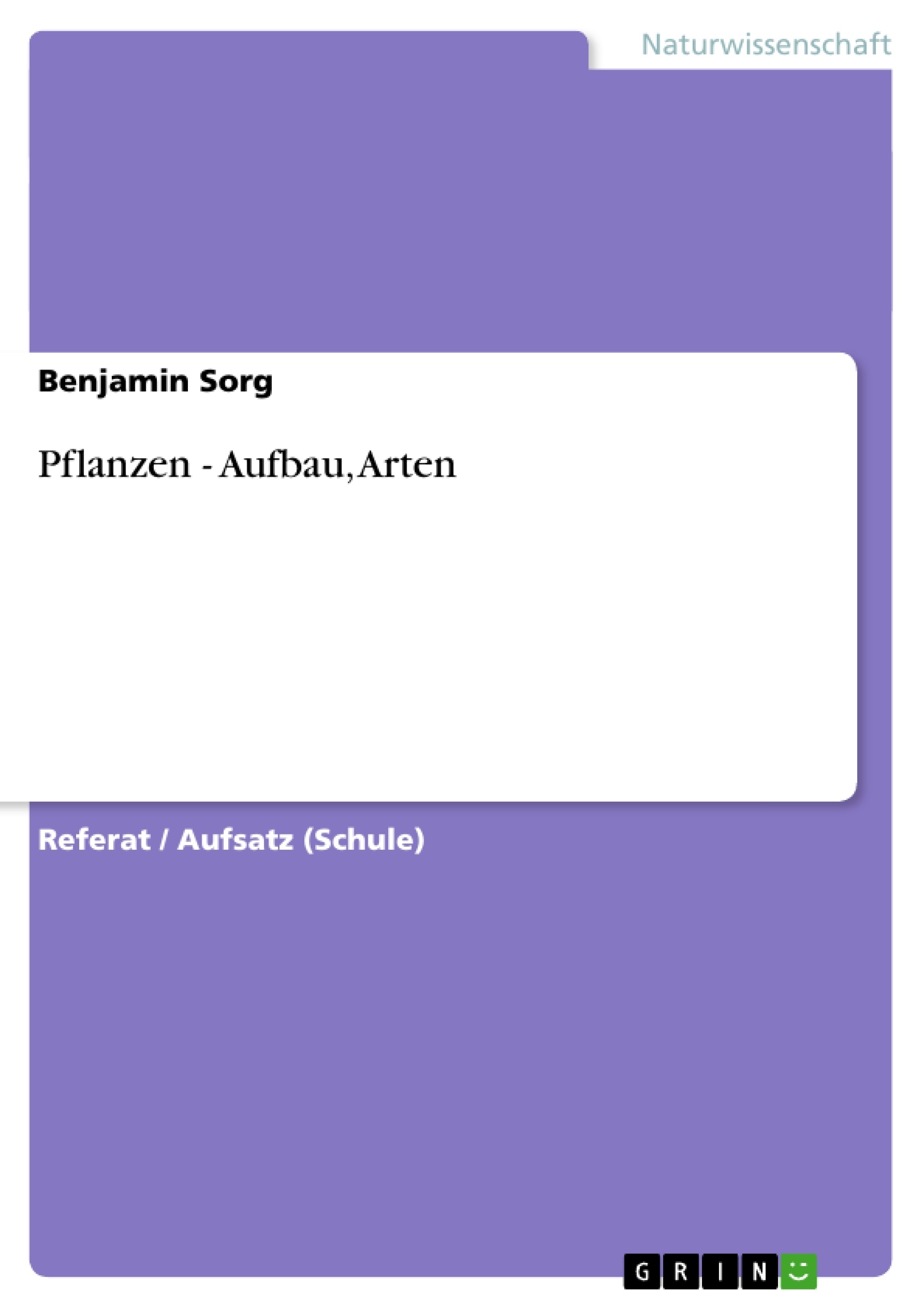Enthülle die verborgenen Wunder des Lebens! Tauche ein in die faszinierende Welt der Zelle, der kleinsten Baueinheit allen Lebens, und entdecke die komplexen Prozesse, die sich in ihrem Inneren abspielen. Diese Reise durch die Grundlagen der Biologie, speziell der Zell- und Pflanzenbiologie, offenbart die erstaunlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen pflanzlichen und tierischen Zellen. Erforsche die Aufgaben der einzelnen Zellorganellen – von der stabilisierenden Zellwand und der wasserregulierenden Vakuole bis hin zu den energieerzeugenden Mitochondrien und den photosynthetisch aktiven Chloroplasten. Lerne, wie die Kompartimentierung in der Zelle Stoffwechselvorgänge optimiert und wie semipermeable Membranen die Grundlage für Osmose bilden. Entdecke den Aufbau eines Laubblattes, von der schützenden Epidermis bis zum photosynthetisch aktiven Palisadengewebe, und wie Spaltöffnungen den Gasaustausch regulieren. Untersuche die Anpassungen von Blättern an extreme Standorte, von Sonnen- und Schattenblättern bis hin zu den Überlebensstrategien von Pflanzen in trockenen Umgebungen. Verstehe die Photosynthese, die lichtabhängigen und lichtunabhängigen Reaktionen, den Calvin-Zyklus und die Bedeutung der Photosynthese für Mensch und Umwelt. Erfahre mehr über die Gefahren des Waldsterbens durch Schadstoffe wie Schwermetalle und Schwefel. Erkunde die Zellatmung, von der Glykolyse bis zur Endoxidation, und die alternativen Stoffwechselwege der Gärung. Schließlich beleuchten wir den Wasserhaushalt der Pflanze, die Transportmechanismen und die Anpassungen verschiedener Pflanzengestalten an ihre jeweiligen Lebensräume, von Hydrophyten bis Xerophyten. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Schüler, Studenten und alle, die sich für die Geheimnisse des Lebens interessieren. Es bietet einen klaren und verständlichen Einblick in die komplexen Prozesse, die das Leben auf unserem Planeten ermöglichen, von der mikroskopischen Ebene der Zelle bis hin zu den globalen Auswirkungen der Photosynthese und des Waldsterbens, einschließlich relevanter Themen wie Stoffwechsel, Photosyntheseleistung, Chloroplastenaufbau, Zellatmungsprozesse, Gärungsprozesse, Wasseraufnahme, Transportmechanismen und Osmose.
Biologie-KA am 22.12.99
Zell- und Pflanzenaufbau
Unterschiede zwischen pflanzlicher und tierischer Zelle:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgaben der einzelnen Bauelemente:
Zellwand: Stabilität
Vakuole: Stabilität und Wasserspeicherung
Zellgrenzmembran: Abgrenzung zur Außenwelt mit selektiver Durchlässigkeit
Mitochondrien: Zellatmung · Energiegewinnung
Chloroplasten: Aufbau energiereicher Stoffe
Zellkern: Steuerzentrale der Zelle, jede Zelle ist prinzipiell omnipotent; je nach Differenzierungszustand wird nur der für die Aufgabe notwendige Informationsanteil abgerufen.
Zellplasma: Füllmaterial, Pufferaufgabe, Zellatmung
Je nach Zelldifferenzierung erhalten bestimmte Zellbausteine verschieden starke Bedeutung
Kompartimentierung:
Zellkern, Mitos und Chloros (Zellorganellen) sind durch Zellmembranen vom Plasma getrennt, damit Stoffwechselvorgänge nicht gestört werden.
Stärke:
Photosynthese · Stärke · Pflanze gewinnt für Stoffwechsel notwendige Stoffe; die dazu notwendige Energie stammt aus der Zellatmung.
Semipermiable Membran · Voraussetzung für Osmose:
Trennschicht zw. 2 Medien, die in Abhängigkeit der Porengröße bestimmte Stoffe durchläßt.
Aufbau eines Laubblattes (von oben nach Unten):
Epidermis (ohne Chloros) mit Kutikula (Wachsschicht)
Pallisadengewebe (80% der Chloros des Blattes)
Schwammgewebe mit Interzellularen
Untere Epidermis mit Spaltöffnungen
Spaltöffnungen:
Regulierung des Gasaustauschs durch unterschiedliche Öffnungszustände, je nach Wasserversorgung und Grad der Sonneneinstrahlung abhängig · Kompromiss zw. Wasserverlust _ Gasaustausch
Bau: 2 Epidermiszellen mit nach innen verstärkten Zellwänden und Chloros
Anpassungen des Blattes an extreme Standorte:
Sonnenblatt: dicker, mehr Chloros, wenig Spaltöffungen
Schattenblatt: dünner, weniger Chloros, mehr Spaltföffnungen
Trockene Standorte: je trockener, desto kleiner die Blattfläche und weniger Spaltöffnungen (Extremfall: Kakteenstacheln)
Photosyntheseleistung ist abhängig von:
1.) Lichtintensität:
Schneller Leistungsanstieg · Annäherung an Grenzwert da max. Auslastung der Chloros
2.) Kohlenstoffdioxidgehalt der Umgebung:
Ähnliche Kurve wie bei ,,1.)"; Bei Normalbedingungen ist Leistung unter 50%
3.) Temperatur der Umgebung:
Ansteigender Anteil: RGT-Regel (pro 100 steigt Stoffwechselleistung um 2-4fache) Absteigender Anteil: Irreversible Zerstörung d. Enzyme (Eiweiß)
Chloroplastenaufbau: Doppelmembran durch Endo-symbiontentheorie (Beweis: untersch. Aufbau der beiden Membranen & Bakterienerbmaterial in Chloros);äußere Membran = Eucytenmembran, innere Membran = Bakterienmembran; Thylakoide mit Chloros (dritte, in Matrixraum eingebettete Membran mit Abschnürungen und Auffaltungen
Photosynthese:
Lichtabhängige Reaktion:
Bestrahlung des Chlorophyls · instabiler energie-reicher Zustand · Rückfall mit Energiefreisetzung · Energie wird in Form von ATP gebunden · Spaltung von Wasser in H2 und ½O2 ·H2 wird an Wasserstoffträger NADP gebunden · NADPH2 · Endprodukte: ATP und NADPH 2
Lichtunabhängige Reaktion:
Mit Hilfe von ATP und NADPH² erfolgt Aufbau energiereicher Kohlenwasserstoffe; Kohlenstoff aus CO2 der Atmosphäre · Reduktion:
CO2 wird an Akzeptormoleküle gebunden · Aufbau von Glukose durch mehrschrittigen, energiereichen Prozess · ATP und NADPH2 wird benötigt · Akzeptormoleküle werden wieder freigesetzt · außerdem entsteht Wasser
- Calvin Zyklus
- Gesamtreaktionsgleichung beider Reaktionen:
6CO2 +12H2O _ C6 H12 O6 + 6O2 + 6H2 O
C6-Körper wird weiterverarbeitet oder in Stärke(Speicherkohlen-hydrat) /Sacharrose (Transportkohlenhydrat) umgewandelt
Bedeutung der Photosynthese:
Mensch nutzt Pflanzenmasse aus d. Nettoproduktion d. Fotosyn.:
Ernährung, Holz (fos. Brennstoffe), Baumaterial, Genußmittel, Lebensraum für Tiere, Bannwälder
Waldsterben:
Ursache: Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden
Verschiedene Schadstoffe
Schwermetalle (Blei, Quecksilber) · Ausstoss über Abgase und Nebenprodukte der Ind. · Aufnahme mit Nahrung und Wasser · Akkumulation beim Menschen wegen Nahrungskette · Enzymhemmung · Beinträchtigung des Stoffwechsels
Schwefel · Abgabe bei Verbrennung fossiler Brennstoffe · i. d. Luft: Schwefeloxid; Bei Kontakt mit Wasser: Saurer Regen ·ätzende Wirkung auf Blatt &Wurzel; Atemwegsbelastung bei Tieren
Zellatmung:
Lebewesen benötigen Energie für aufbauenden Stoffwechsel und Energiegewinnung des Betriebsstoffwechsel.
Erster Schritt (im Zellplasma): Glykolyse:
Spaltung von Glukose (C6-Körper) unter Abspaltung von jeweils 2 Wasserstoffatomen, die auf NAD übertragen werden · 2NADH2, 2ATP und 2 C3-Körper (Brenztraubensäure)
Zweiter Schritt (in Mitos): Bildung der aktivierten Essigsäure:
Abspaltung des Säurerestes und Bindung des Coenzyms A · aktivierte Essigsäure; Produkte: 2NADH2 und 2CO2
Dritter Schritt: Tricarbon-/Zitronensäurezyklus:
Bindung des 2C-Restes an ein Trägermolekül unter Abspaltung des Coenzyms A · 8 NADH2,
2 ATP, 4 CO2
Vierter Schritt: Endoxidation/Atmungskette:
Mit Hilfe des Luftsauerstoffs erfolgt in den Mitos eine ,,Knall-gasreaktion" in vielen kleinen Teilschritten. Der Wasserstoff stammt aus dem vorher gebildeten NADH2 · frei werdende Energie wird chem. Gebunden · 34 ATP pro C6-Körper
Gesamtbilanz: Glykolyse (2 ATP) + TCZ (2 ATP) +Endoxidation (34 ATP) = 38 ATP C6H12O6 + 6H2O + 6O2 _ 6CO2 +12H2O
Milchsäuregährung:
Wenn nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung steht · Zellatmung blockiert nach Glykolyse, da aufgrund der nicht mehr ablaufenden Atmungskette der NAD-Pool nach einer Zeit ausgeschöpft ist. Der Stoffwechselausweg ist die Milchsäurebildung: NADH2 wird zu NAD · das freigewordene H2 wird der Brenztraubensäure angehängt · Milchsäure entsteht · sie reichert sich in der Zelle und im Blut an · ab einer best. Konz. werden die Stoffwechselenzyme in ihrer Tätigkeit beeinträchtigt · keine Kontraktion der Muskeln mehr
Alkoholische Gärung durch Hefepilze:
C6 H12 O6 _ 2CH5 OH + 2CO2
Während der Gärung muss bestimmte Temp vorliegen (RGT)
Bei Anwesenheit von O2 können die Pilze auf norm Zellatmung umstellen Anwendungen:
Bierhefe: Umwandlung des Malzzuckers
Weinhefe: Umwandlung des Fruchtzuckers, Weiterverarbeitung zu Champagner
Bäckerhefe: Auflockerung des Teiges wegen des CO2, Alkohol verdampft in der Backhitze Milchsäurebakterien führen zur Säuerung vieler Lebensmittel · höhere Haltbarkeit, da die Entwicklung von Fäulnisbakterien gehemmt wird (Bsp. Milchverarbeitungsprodukte) Je nach Bakterienart verändert sich die Geschmacksrichtung (Bsp. Sauerkraut, Silo-Futter)
Wasserhaushalt der Pflanze
Zellen der Pflanze wirken als osmothischen System zusammen Aufnahme über die Wurzeln, Verteilung über Wasserleitungs-bahnen (Holzteil, Leitbündel der Blätter), Wasserabgabe haupt-sächlich über Blattfläche.
Wasseraufnahme: In den versch. Zellschichten der Wurzeln er-folgt ausgehend von der Wurzelhaarzelle die Wasseraufnahme über nach innen steigende osmothische Druckverhältnisse.
Transportmechanismen:
1.) Transpirationssog: Voraussetzung ist ein ununterbrochener Wasserfaden zw. Blatt und Wurzel · Wasser wird nachgesaugt.
2.) Wurzeldruck: Wasser wird durch Osmose in die Leitungs-bahnen gedrückt. Ein hoher Wurzeldruck entsteht dann, wenn durch aktive Transportvorgängen osmothisch wirk-same Substanzen in die Leitgefäße transportiert werden · hoher osmothischer Druck; Wurzeldruck nur nachweisbar, wenn Zellatmung i. d. Wurzelzellen nachweisbar ist, da aktive Transportvorgänge Energie verbrauchen.
Diffusion: Konzentrationsausgleich aufgrund der Brownschen Molekularbewegung· passiver Vorgang ohne Energieverbrauch
Osmose: Diffusion durch eine semipermeable Membran; sie läuft solange ab bis eine vorhandene Gegenkraft so groß ist wie der osmoth. Druck
Plasmolyse: Wasserausstrom mit Membranablösung von der Zellwand
Deplasmolyse: Wiederherstellung
Casparischer Streifen: Wasserundurchlässige Schicht, die unkontrollierte Wasseraufnahme über Zellzwischen-räumen bzw. durch die Zellwände verhindert.
Pflanzengestalten:
Hydrophyten (Wasserpflanzen):
Spaltöffnungen: wenige oder gar fehlend; nur an Blatt-oberflächen;
Wurzelsystem: schwach oder fehlend
Hygrophyten (Feuchtpflanzen):
Spaltöffnungen: viele; oft von den Blättern hervorgehoben
Wurzelsystem: schwach ausgebildet; niedrige osmoth. Werte
Mesophyten (Mischung):
Spaltöffnungen: mäßig viele; an der Blattunterseite
Wurzelsystem: stark ausgebildet; oft auch als Speicherorgan (z.B. Wurzelstock)
Xerophyten (Trockenpflanzen)
Spaltöffnungen: sehr viele; schnell schließend; oft versenkt
Wurzelsystem: sehr gut ausgebildet; hohe osmoth. Werte
Feigenkaktus (Ausnahme der Xerophyten)
Häufig gestellte Fragen zu Biologie-KA am 22.12.99
Was sind die Hauptunterschiede zwischen pflanzlichen und tierischen Zellen?
Die Tabelle in der Leseprobe, die nicht angezeigt wird, illustriert die Unterschiede. Pflanzliche Zellen haben Zellwände, Vakuolen und Chloroplasten, die in tierischen Zellen nicht vorhanden sind.
Welche Aufgaben haben die einzelnen Zellbauelemente?
Zellwand: Stabilität. Vakuole: Stabilität und Wasserspeicherung. Zellgrenzmembran: Abgrenzung zur Außenwelt mit selektiver Durchlässigkeit. Mitochondrien: Zellatmung und Energiegewinnung. Chloroplasten: Aufbau energiereicher Stoffe. Zellkern: Steuerzentrale der Zelle. Zellplasma: Füllmaterial, Pufferaufgabe, Zellatmung.
Was bedeutet Kompartimentierung und warum ist sie wichtig?
Kompartimentierung bedeutet, dass Zellkern, Mitochondrien und Chloroplasten durch Zellmembranen vom Plasma getrennt sind, damit Stoffwechselvorgänge nicht gestört werden.
Wie funktioniert Photosynthese und welche Rolle spielt Stärke dabei?
Photosynthese ermöglicht der Pflanze, die für den Stoffwechsel notwendigen Stoffe zu gewinnen. Die dazu notwendige Energie stammt aus der Zellatmung. Stärke ist ein Produkt der Photosynthese.
Was ist eine semipermeable Membran und welche Bedeutung hat sie für Osmose?
Eine semipermeable Membran ist eine Trennschicht zwischen zwei Medien, die in Abhängigkeit der Porengröße bestimmte Stoffe durchlässt. Sie ist Voraussetzung für Osmose.
Wie ist ein Laubblatt aufgebaut?
Von oben nach unten: Epidermis (ohne Chloroplasten) mit Kutikula (Wachsschicht), Palisadengewebe (80% der Chloroplasten des Blattes), Schwammgewebe mit Interzellularen, untere Epidermis mit Spaltöffnungen.
Welche Funktion haben Spaltöffnungen?
Spaltöffnungen regulieren den Gasaustausch durch unterschiedliche Öffnungszustände, abhängig von Wasserversorgung und Grad der Sonneneinstrahlung. Es ist ein Kompromiss zwischen Wasserverlust und Gasaustausch.
Wie passen sich Blätter an extreme Standorte an?
Sonnenblatt: dicker, mehr Chloroplasten, wenig Spaltöffnungen. Schattenblatt: dünner, weniger Chloroplasten, mehr Spaltöffnungen. Trockene Standorte: je trockener, desto kleiner die Blattfläche und weniger Spaltöffnungen (Extremfall: Kakteenstacheln).
Von welchen Faktoren ist die Photosyntheseleistung abhängig?
Lichtintensität, Kohlenstoffdioxidgehalt der Umgebung, Temperatur der Umgebung.
Wie ist ein Chloroplast aufgebaut?
Doppelmembran (äußere Membran = Eucytenmembran, innere Membran = Bakterienmembran) und Thylakoide mit Chlorophyll (dritte, in Matrixraum eingebettete Membran mit Abschnürungen und Auffaltungen).
Welche Reaktionen finden während der Photosynthese statt?
Lichtabhängige Reaktion: Bestrahlung des Chlorophylls, Energiefreisetzung, ATP-Bindung, Wasserspaltung in H2 und ½O2, H2 wird an Wasserstoffträger NADP gebunden (NADPH2). Lichtunabhängige Reaktion: Aufbau energiereicher Kohlenwasserstoffe mit Hilfe von ATP und NADPH2; Kohlenstoff aus CO2 der Atmosphäre (Calvin-Zyklus).
Welche Bedeutung hat die Photosynthese?
Ernährung, Holz (fossile Brennstoffe), Baumaterial, Genussmittel, Lebensraum für Tiere, Bannwälder.
Welche Ursachen hat das Waldsterben?
Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden, wie Schwermetalle (Blei, Quecksilber) und Schwefel.
Wie funktioniert die Zellatmung?
1. Glykolyse (im Zellplasma): Spaltung von Glukose. 2. Bildung der aktivierten Essigsäure (in Mitochondrien). 3. Tricarbon-/Zitronensäurezyklus. 4. Endoxidation/Atmungskette.
Was ist Milchsäuregärung und wann tritt sie auf?
Wenn nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung steht, wird die Zellatmung blockiert nach Glykolyse. Milchsäurebildung ist ein Stoffwechselausweg: NADH2 wird zu NAD · das freigewordene H2 wird der Brenztraubensäure angehängt · Milchsäure entsteht.
Was ist alkoholische Gärung und welche Anwendungen hat sie?
Alkoholische Gärung wird von Hefepilzen durchgeführt (C6 H12 O6 _ 2CH5 OH + 2CO2). Anwendungen: Bierhefe, Weinhefe, Bäckerhefe.
Wie funktioniert der Wasserhaushalt der Pflanze?
Aufnahme über die Wurzeln, Verteilung über Wasserleitungsbahnen (Holzteil, Leitbündel der Blätter), Wasserabgabe hauptsächlich über die Blattfläche. Wasseraufnahme durch steigende osmothische Druckverhältnisse in den Zellschichten der Wurzeln.
Welche Transportmechanismen gibt es bei der Wasseraufnahme durch Pflanzen?
Transpirationssog, Wurzeldruck, Diffusion, Osmose.
Was ist Plasmolyse und Deplasmolyse?
Plasmolyse: Wasserausstrom mit Membranablösung von der Zellwand. Deplasmolyse: Wiederherstellung des vorherigen Zustands.
Was ist der Casparische Streifen?
Eine wasserundurchlässige Schicht, die unkontrollierte Wasseraufnahme über Zellzwischenräumen bzw. durch die Zellwände verhindert.
Welche Pflanzengestalten gibt es und wie unterscheiden sie sich?
Hydrophyten (Wasserpflanzen), Hygrophyten (Feuchtpflanzen), Mesophyten (Mischung), Xerophyten (Trockenpflanzen). Sie unterscheiden sich in Bezug auf Spaltöffnungen, Wurzelsystem und osmothische Werte.
- Quote paper
- Benjamin Sorg (Author), 2000, Pflanzen - Aufbau, Arten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97043