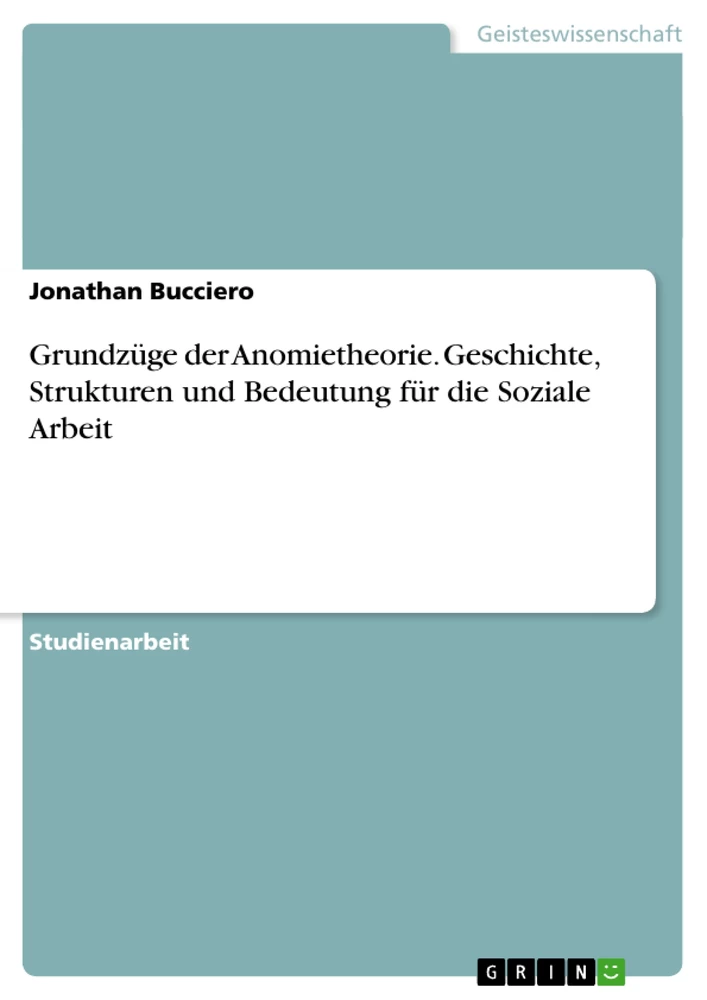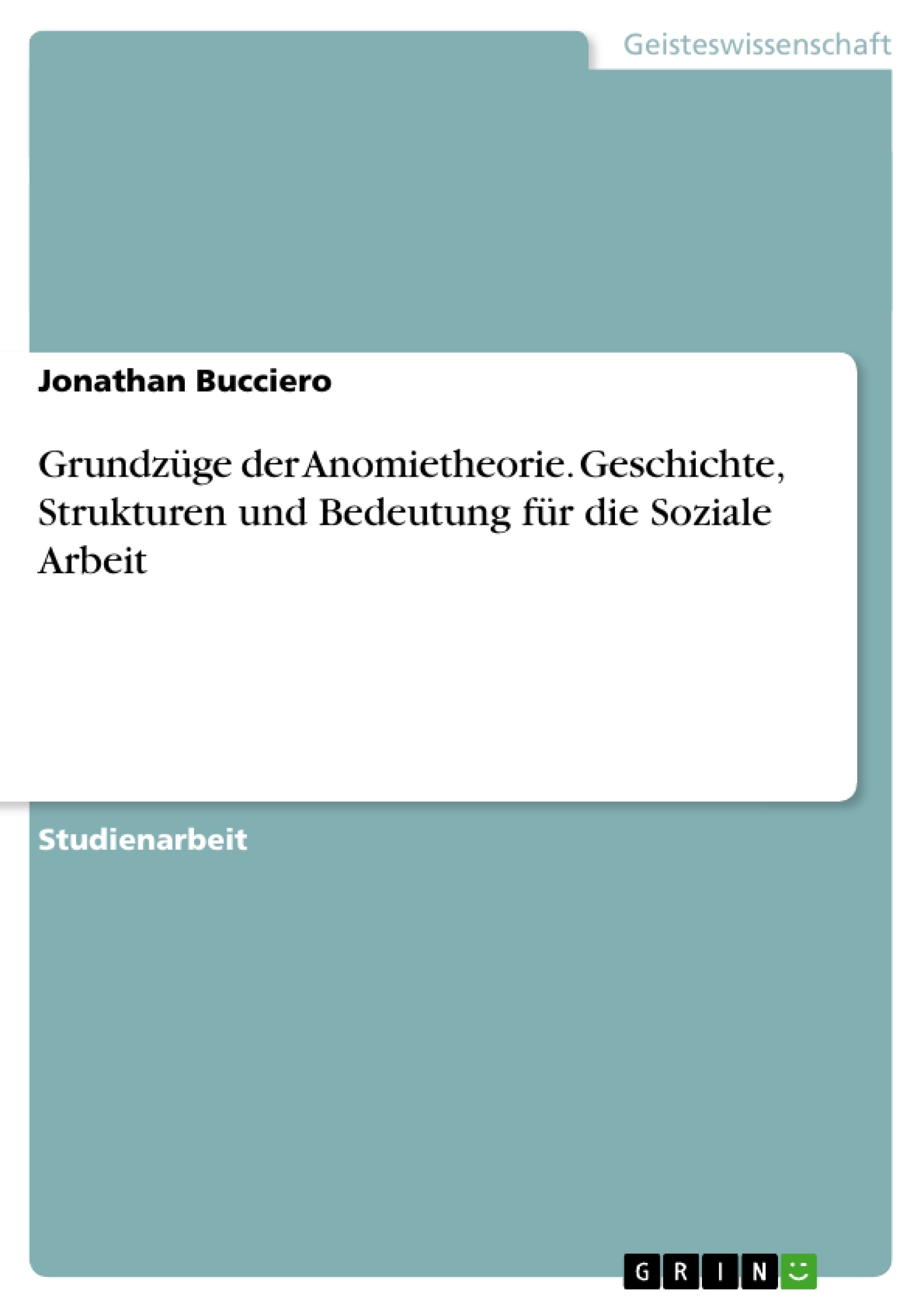Was, wenn die Regeln selbst das Problem sind? Diese Frage durchdringt die Anomietheorie, ein faszinierendes Gedankengebäude, das die Wurzeln gesellschaftlicher Desorientierung und abweichenden Verhaltens ergründet. Tauchen Sie ein in die Welt von Émile Durkheim und Robert K. Merton, den Begründern dieser Theorie, die uns zeigen, wie soziale Strukturen und individuelle Anpassungsstrategien in einem komplexen Wechselspiel stehen. Von den historischen Ursprüngen im Zuge der industriellen Revolution bis zu den modernen Interpretationen beleuchtet dieses Werk die verschiedenen Facetten der Anomie: von der Kohäsionskrise, die das soziale Gefüge zerreißt, über die Regulationskrise, die den Einzelnen in einem Meer unstillbarer Bedürfnisse zurücklässt, bis hin zur Strukturkrise, die Chancenungleichheit und soziale Ungerechtigkeit offenbart. Entdecken Sie, wie Durkheim die Arbeitsteilung und ökonomische Krisen als Auslöser identifizierte, während Merton den Fokus auf den amerikanischen Traum und die Diskrepanz zwischen kulturellen Zielen und verfügbaren Mitteln legte. Doch was bedeutet das für die Soziale Arbeit? Kann die Anomietheorie helfen, Täter nicht nur als solche zu sehen, sondern auch als Opfer gesellschaftlicher Umstände zu verstehen? Und welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei der Aufdeckung und Behandlung pathologischer Strukturen, die zu abweichendem Verhalten führen? Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die Anomietheorie und ihre wichtigsten Vertreter, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung mit ihren Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen. Es ist eine Einladung, über die komplexen Zusammenhänge zwischen Individuum und Gesellschaft nachzudenken und neue Perspektiven für das Verständnis und die Bewältigung sozialer Probleme zu entwickeln. Eine unverzichtbare Lektüre für Studierende und Praktiker der Sozialen Arbeit, Soziologie und Pädagogik, die nach neuen Wegen suchen, um die Welt ein Stück gerechter zu gestalten. Lassen Sie sich von den revolutionären Ideen Durkheims und Mertons inspirieren und entdecken Sie das Potenzial der Anomietheorie für eine zukunftsweisende Soziale Arbeit.
Gliederung
A. Einleitung
B. Historischer Zugang
C. Strukturen der Anomie
1. Émil Durkheim und Anomie
2. Robert K. Mertons Anomiebegriff
3. Fazit
D.Anomie und Soziale Arbeit
E.Literaturliste
F.Anhang
A. Einleitung
Die Grundzüge der Anomietheorie werden Bestandteil dieser Hausarbeit sein. Die Inhalte dieser Arbeit werden im Folgenden kurz vorgestellt, um ein verständlicheres Lesen zu ermöglichen.
- Welche gesellschaftlichen Faktoren haben die Anomietheorie begünstigt?
Ein kurzer historischer Rückblick soll dem Leser helfen, den gesellschaftlichen und historischen Kontext dieser Theorie besser zu verstehen. Zu den Betrachtungen der wirtschaftlichen Entwicklung der europäischen Gesellschaft, soll der wissenschaftliche Zusammenhang integriert werden. Im Kapitel B wird also die Frage nach der Entstehung dieser Theorie behandelt.
- Wie und wer hat den Anomiebegriff mitgestalltet?
Nach dem historischen Überblick, soll der Begriff der Anomie inhaltlich behandelt werden. Hier werden die zwei wichtigsten Begründungsansätze (C1-C2) beschrieben. Die Autoren dieser Theorien sind Durkheim und Merton.
- Was kann die Soziale Arbeit mit der Anomie anfangen?
Da die Ausarbeitung dieses Referates im Rahmen des Studiums der Sozialen Arbeit aufgetragen worden ist, soll im letztem Kapitel der Anomiebegriff für die Soziale Arbeit greifbarer gemacht werden. Hierzu werden die methodischen Vorteile aufgezeigt, die dieses Theorem für die Soziale Arbeit mit sich bringen kann.
B. Historischer Zugang
Im Laufe der Jahrtausende, haben sich die verschiedenen menschlichen Gesellschaftsformen, auf individueller Weise, weiterentwickelt. Durch den industriellen Wachstum kam es in Europa, und auch zeitlich versetzt in anderen Kontinenten, zu einer Umschichtung im Arbeitssektor. Die Bedeutung des Primärsektors wurde durch den Sekundärsektor relativiert; die Landwirtschaft und die damit verknüpften gesellschaftliche Strukturen wurden von der damals modernen „Arbeitsteilung“ (Durkheim) abgelöst. Aus wirtschaftlichen Gründen wanderten viele Bauern mit ihren Familien zu den Industriestandorten. Sie versprachen sich ein wirtschaftliches gesichertes Leben, das in der Landwirtschaft wegen Dürreperioden, hohe Abgaben an den Großgrundbesitzer und Ausbeutungen während der Kriege, nicht immer möglich war.
Infolge von diesem neu entstandenen Arbeitssektors, haben sich in dieser Zeit neue gesellschaftliche Probleme ergeben, die zur Kritik der wirtschaftlichen Struktur und wirtschaftlichen Idealvorstellungen (wie z.B. der Kapitalismus) führte. Die Kritikebenen reichten von soziale Absicherung für die Arbeiterklasse (Sozialgesetze/Bismarck) bis hin zu Theorien der wirtschaftlichen Revolution (Marx /Engels). Dieser gesellschaftliche Wandel beschäftigte auch die Pädagogik, „die bis dahin traditionell den geisteswissenschaftlichen Anspruch erhoben hatte, über den Menschen die Gesellschaft gestalten zu wollen.“(Böhmisch 1999, S. 28) Böhmisch erläutert außerdem, daß mit dem „Niedergang des Menschen in der industriellen Moderne [die Pädagogik ( Anm. des Verf.)] ihre eigene diziplinäre Statuskrise erlebte“(ebenda). Daher habe sich die Pädagogik nicht in dieser Zeit mit den gesellschaftlichen Problemen ausgiebig beschäftigen können. An ihre Stelle konnte die Soziologie die beobachtende und analysierende Rolle übernehmen, da die wissenschaftliche Ausrichtung auf gesellschaftliche Strukturen gerichtet war. Die Soziologie war daher nicht mit eigenen diziplinären Krisen beschäftigt, sondern konnte sich auf die gesellschaftlichen Krisenerlebnisse konzentrieren. Aufgrund dieser Vorgeschichte zwischen den beiden wissenschaftlichen Disziplinen, konnte die Pädagogik, die von der Soziologie aufgestellte Anomietheorie annehmen. Die Pädagogik formulierte von ihrerseits, die Subjekttheorie, die die Ursache des abweichenden Verhaltens nicht in den Strukturen erkennt. Diese Theorie wurde wiederum von seiten der Soziologie nicht angenommen.
Zum Schluß kann gesagt werden, daß die ...
... industrielle Entwicklung und die damit verbundene Arbeitsteilung neue soziale Probleme hervorgebracht hat.
... neuen Probleme von der Soziologie durch den Anomiebegriff erklärt wurden, und daß die Pädagogik zu jener Zeit in einer eigenen diziplinären Krise sich befand.
C. Strukturen der Anomie
Wie schon oben erwähnt, werden in diesem Kapitel die Anomiebegriffe von Durkheim und Merton vorgestellt. Durkheim hatte die Hypothese der Anomie eingeleitet, Merton hat sie weiter entwickelt. Seine Theorie wurde wiederum von anderen Wissenschaftlern erweitert. Die folgende Graphik soll den wissenschaftlichen Verlauf der Anomietheorie, anhand der verschiedenen Autoren zeigen. Unteranderem kann aus der Graphik erschlossen werden, wer sich mit diesem Theorem auseinandergesetzt hat.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Lamnek 1999, S. 109
1. Émil Durkheim und Anomie
Durkheim hat in seinen Veröffentlichungen (Selbstmord“ und Krisenbewußtsein) den Begriff der Anomie definiert. Um seinen Ansatz besser verstehen zu können, wird dieser Ansatz systhematisch erklärt.
a. Zuerst soll das Menschenbild von Durkheim vorgestellt werden, das in seiner Theorie eine große Rolle Spielt.
b. Nach Behandlung des Menschenbildes, sollen Durkheims Vorstellungen von einer gesicherten Gesellschaft erläutert werden.
c. Die Folgen der Arbeitsteilung werden nun dargestellt. Aus dieser Argumentationskette wird Durkheims Bild der Anomie verständlicher. Zwei Anomievarianten werden hier definiert.
Zu a. Das Menschenbild Durkheims
Durkheim geht von der Vorstellung aus, daß der Mensch starke Bedürfnisse/Wünsche besitzt, die daraufhin drängen, befriedigt zu werden. Der Mensch sei nicht in der Lage sich aus eigenen Kräften diesen Wünschen entgegenzustellen. Deshalb braucht der Mensch von außen vorgegebene Regeln, die ihn damit domestizieren. Diese Konstellation wird in der folgenden Graphik nochmals verdeutlicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dieses Modell läßt an die psychoanalytische Sicht Freuds des Menschen denken. Die Wünsche werden bei Freud als Triebe (ES) definiert. Die Regeln sind bei Freud die verinnerlichten, von außen vorgegebenen, Normen (ÜBER-ICH). Durkheim hat nicht den freien Willen der einzelnen Person näher betrachtet, die bei Freud die wichtige Ich-Instanz bildet. Diese steht zwischen dem Es und dem Über-ich und reguliert diese Kräfte. Da Durkheim aber strukturell die Ursachen des abweichenden Verhaltens analysiert, bleibt sein Ansatz auf dieser Ebene der individuellen, von Strukturen losgelösten Entscheidungen, blind. Genau an diesem Punkt versucht Böhmisch diese soziologische Sicht mit psychoanalytischen und pädagogischen Überlegungen zu Kombinieren. Das ist auch der Versuch die wissenschaftlichen Disziplienen (Soziologie und Pädagogik) in diesem Punkt dialektisch zu vereinen.
Wichtig ist in dieser Überlegung noch, daß Durkheim nicht den absoluten Verzicht der Wünsche haben will, sondern lediglich eine Einschränkung. Diese Einschränkungen können von der Ehe bis zu ökonomischen Wünschen reichen. Dieser Ansatz erscheint vorerst übertrieben zu sein, aber Durkheim begründet die Notwendigkeit der Einschränkung damit, daß das Individuum sich nur in seinen Grenzen sicher vor der existentiellen Desorientierung fühlen könne. (siehe hierzu Bohle, H. H.; u.a. 1997, S. 33+34).
Zu b. Die gesicherte Gesellschaft Das Modell des Homo Duplex erweitert Durkheim auf die Gesellschaft. Die Individuen in der Gesellschaft brauchen kulturelle Normen. Diese Normen sollten nach Durkheim positiv motivierend und zugleich durch Sanktionen normativ gehalten werden. Durkheim befürwortet auch, daß in der Gesellschaft hoch anerkannte Institutionen, diese Regulation ausüben. Im Mittelalter war die Kirche eine solche Instanz, die die Rollen der Armen und der Reichen auf unterschiedliche Weise normierte. Erst mit einer solchen Struktur, sei die Gesellschaft gesichert. Siehe hierzu nachfolgende Graphik:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zu c. Strukturelle Folgen der Arbeitsteilung (A/T)
Durkheim hat erkannt, daß die neuen wirtschaftlichen Richtlinien, vor allem die A/T, zu einer Desorientierung der Gesellschaft und damit auch des Einzelnen führen. Diesen Zustand der gesellschaftlichen Regellosigkeit (Kohäsionskrise) und der der persönlichen (Regualtionskrise) sind beide Ursachen der jeweiligen Anomievariante.
Durch die folgende Argumentationskette, sollen diese zwei Anomievarianten verdeutlicht werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die moderne A/T führe dazu, daß die einzelnen Menschen in der Gesellschaft weniger miteinander kommunizieren. Durch diesen sozialen und kulturellen Bindungsverlust der Einzelnen zueinander, fällt das Kollektivbewußtsein, auch der im Bereich von gesellschaftlichen Normen. Dieser Traditionsverlust ist das Fundament einer regellosen Gesellschaft. Das ist die Kohäsionskrise. Die Kohäsionskrise ist vom Bindungsverlust der Gesellschaft gekennzeichnet (Verlust der gesicherten Gesellschaft). Diese Kohäsionskrise führt beim Individuum zur Regulationskrise. Die Regulationskrise ist die Diskrepanz zwischen menschlichen Bedürfnissen und realen Möglichkeiten (Verlust des Homo Duplex). Der Mensch kann in diesem Zustand, seine Wünsche nicht mehr kontrollieren. Die immer ansteigenden Wünsche, können wegen der realen Möglichkeit, meist nicht erfüllt werden. Hier entsteht abweichendes Verhalten. Die extremste Form von abweichendem Verhalten ist der aus der defizitären Gesellschaftsstruktur resultierende anomische Selbstmord. Durkheim sieht nicht die A/T als Ursache der Anomie, sondern ökonomische Krisen (überhitzte Konjunktur -Rezession). Daher erhofft er sich eine stabile Gesellschaft, die sowohl eine notwendige A/T hat aber auch einen festen Regelkanon. Durkheim kommt zum Schluß zur Auffassung, daß eine moderne industrielle Gesellschaft nie ohne Anomie erreicht werden kann. Allerdings kann diese mit bestimmten Instrumenten (z.B. Regelkanon) kontrolliert werden.
2. Robert K. Mertons Anomiebegriff
„Ausgangspunkt der Überlegungen von Robert K. Merton, die erstmals 1938 publiziert wurden, war die Frage : ‚Wie ist es zu erklären, daß die Häufigkeit abweichenden Verhalten in verschiedenen sozialen Strukturen variiert, und warum nehmen die Abweichungen in verschiedenen sozialen Strukturen unterschiedliche Formen an?‘ (Merton, 1968a, S. 185)“ (Amelang, M. 1986,. 153).
Um diese Fragestellung beantworten zu können, ist es wichtig seine Prämissen zu dem Thema zu kennen.
a. Prämissen
Mertons Überlegungen basieren auf zwei Grundannahmen, die sich speziell auf die amerikanische Gesellschaft beziehen.
Die erste Prämisse die Merton hat, ist, daß die gesamte amerikanische Gesellschaft, d.h. alle Schichten, vor allem ein Ziel verfolgen, und zwar: Erfolg /Reichtum. Die Bereich die diesen Wert der amerikanische Gesellschaft aufsetzen, sind Familie, Schule, Arbeit und die Massenkommunikationsmittel. Die Kultur schärfe die Annahme dreier Axiome:
„Erstens, alle sollen nach denselben hochgeschraubten Ziel streben, da sie für alle erreichbar sind.
Zweitens, ein gegenwärtiger scheinbarer Fehlschlag ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Erfolg.
Und drittens, ein echter Fehlschlag liegt nur im Nachlassen oder aufgeben des Ehrgeizes begründet“ (SS & A, S. 193).“ (Bohle, H.H. 1975, S. 6).
Die zweite Grundannahme bezieht sich auf die „Kriminalitätsbelastung der Unterschicht (besser: der lower class)“ (ebenda). Merton übernimmt amtliche Daten, die diese Prämisse stützen, obwohl ihm bewußt ist, daß andere Arten von Delikten, die in von höheren Schichten begangen werden, nicht in diesen Daten erfaßt sind. In diesem Punkt wird er heftig von Bohle kritisiert (ebenda). Bohle zählt auch andere Wissenschaftler auf, die seine Meinung zu dieser Prämisse Merton auch vertreten.
b. Kultur und Struktur
Die nach den Prämissen auffallende Grundfragestellung, versucht Merton damit zu erklären, daß zwei gesellschaftliche Strukturformen existieren, und daß zwischen diesenStrukturformen eine Diskrepanz vorherrscht.
Die erste Strukturform, die eine Gesellschaft stark beeinflußt, ist die Kultur. Merton trennt diesen Begriff, in zwei Unterpunkte:
- Ziele: Das sind allgemeingeltende Werte für die Gesamtgesellschaft. Am Beispiel seines Heimatlandes war das gesellschaftliche Ziel Erfolg.
- Mittel: Das sind die von der Gesellschaft legitimierten Mittel zur Erreichung der gesellschaftlichen Ziele.
Bereits in dieser Unterscheidung kann es zu einer Anomie kommen, wenn bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die fokussierten Ziele erreichen zu können. Kennzeichnend für diese Krise ist ein Druck bei diesen Menschen, die die gesellschaftlich vorgeschriebenen Ziele nicht erfüllen können.
Merton übernimmt inhaltlich die Feststellungen von Durkheim, der diese Krisen als Köhäsions- und Regulationskrise beschreibt.. Anders als Durkheim, unterscheidet Merton jedoch das abweichende Verhalten.
Diese Gliederung beschreibt er als „Typologie der Arten individueller Anpassung“. Die Differenzierung der einzelnen Formen der Anpassung ergeben sich mit der Zustimmung oder Ablehnung der kulturellen Ziele und der institutionalisierten Mittel (Siehe Anhang Nr. 1). Sanders hat diese Anpassungsformen graphisch erklärt (Siehe Anhang Nr. 2). Merton unterscheidet hier zwischen Konformität und abweichendes Verhalten. Erscheinungsformen des abweichenden Verhaltens sind Innovation, die kulturelle Ziele (k.Z.) ohne instituionalisierten Mittel (i.M.), erreichen wollen, Ritualismus, der die k.Z. außer acht läßt und nur die i. M. verfolgt, Rückzug, der beide Strukturen ablehnt, und zuletzt Rebellion, die die herrschenden Werte energisch verändern will, um neue einführen zu können. Auffallend ist, daß Merton den wertneutralen Begriff Innovation verwendet und nicht den negativ belasteten Begriff abweichendes Verhalten. An diesem Punkt setzen viele weitere Wissenschaftler an, um Mertons Typologien zu verändern. Die Hauptkritik ist, daß diese Typologien sehr allgemein gehalten und undifferenziert sind. Die verschiedenen Erweiterungsansätze können aus der Graphik am Anfang dieses Kapitels ersehen werden. Grundsätzlich ist zu den Erweiterungen zu sagen, daß sie sich mit den Typologien beschäftigen.
Die zweite Strukturform ist die Sozialstruktur in der Gesellschaft, die bestimmte Positionen, Rollen und Schichten beschreibt. Das ist eine Erweiterung des Durkheimischen Anomiebegriffs. Jetzt bringt Merton die Klassenunterschiede in der Gesellschaft zur Sprache, und versucht damit zu erklären, daß zur Erreichung bestimmter gesellschaftlicher Zielen, auch die stukturelle Gelegenheit (legitime Mittel) vorhanden sein muß. Diese Strukturkrise ist die Ursache einer anomischen Diskrepanz, zwischen Sozialstrukturen und kulturellen Strukturen. Damit hat Merton eine neue Anomievariante beschrieben, die von Durkheim nicht erkannt worden ist. Folgende Graphik soll nochmals die Strukturkrise visualisieren:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zuletzt ist es Merton noch wichtig zu erklären, daß die Art und die Intensität abweichenden Verhaltens von ...
... der Intensität der Ziele
... der Intensität legitimer Mittel
... der Intensität illegitimer Mittel
... dem Grad der legitimen Möglichkeiten ... dem Grad der illegitimen Möglichkeiten ...
...abhängig ist.
3. Fazit
Abschließend kann von der Anomie gesagt werden, daß drei
Varianten existieren:
a. Anomie aus einer Kohäsionskrise
b. Anomie aus einer Regulationskrise
c. Anomie aus einer Strukturkrise
D. Anomie und Soziale Arbeit
Im folgendem Teil soll noch kurz auf die Bedeutung der Anomietheorie für die Soziale Arbeit eingegangen werden.
a. Täter oder Opfer?
Die Anomietheorie gibt dem Sozialarbeiter die Möglichkeit sich vom Klienten zu lösen. Bei der Arbeit mit Tätern ist dies aus emotionaler Sicht sicherlich sehr hilfreich, da nicht mehr der Täter fokussiert wird, sondern seine Tat im Zusammenhang zu der gesellschaftlichen Struktur. Aus anomischer Sicht können damit Täter auch teils entlastet werden, da sie ja auch Opfer von anomischen Verhältnissen sein könnten. Das darf aber kein Freispruch für die Täter sein, da sie für ihr direktes Handeln verantwortlich sind. Dieses Modell ermöglicht es, sich vom Komplex „abweichendes Verhalten“ sich zu distanzieren, um damit ein differenzierteres und reelleres Bild, im Sinne Georg Simmels, erreichen zu können.
Unteranderem kann die S.A. den Klienten helfen, verschiedene Bewältigungstrategien zu lernen, die die anomische Situation legitim begegnen.
b. Klient Gesellschaft?
Erkennt man eine Teilschuld der Gesellschaftsstrukturen für abweichendes Verhalten an, dann muß es auch Aufgabe der Sozialen Arbeit sein, diese zu erkennen und erkennen zu lassen. Soziale Arbeit muß auch den Ursachen von Problemen begegnen, d.h. Soziale Arbeit muß auch pathologische Strukturen, die zu abweichendes Verhalten führen, behandeln. Ein Interventionsmittel ist sicherlich das Aufdecken von defizitären Strukturen (wie z.B. die 13. Shell Jugendstudie). Fraglich erscheint es mir, ob die Gesellschaft bereit wäre, ökonomische Einschränkungsmaßnahmen zu akzeptieren.
Die strukturelle Sicht ist sicherlich eine Bereicherung im diagnostischem Repertoir, aber es darf nur eine Sicht von vielen sein.
E. Literaturliste
Häufig gestellte Fragen zur Anomietheorie
Was ist das Thema dieser Hausarbeit zur Anomietheorie?
Die Hausarbeit behandelt die Grundzüge der Anomietheorie. Sie untersucht die gesellschaftlichen Faktoren, die die Entstehung der Theorie begünstigten, analysiert den Anomiebegriff anhand der Ansätze von Durkheim und Merton, und diskutiert die Bedeutung der Anomie für die Soziale Arbeit.
Welche gesellschaftlichen und historischen Hintergründe werden beleuchtet?
Die Arbeit gibt einen historischen Überblick über die gesellschaftliche Entwicklung, insbesondere den industriellen Wachstum und die damit verbundene Umschichtung im Arbeitssektor in Europa. Sie betrachtet dieEntstehung neuer gesellschaftlicher Probleme und die Kritik an wirtschaftlichen Strukturen, die zur Entwicklung der Anomietheorie beitrugen.
Wer sind die wichtigsten Theoretiker, die behandelt werden?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf Émile Durkheim und Robert K. Merton, die zentrale Beiträge zur Anomietheorie geleistet haben. Durkheims Hypothese und Mertons Weiterentwicklung des Anomiebegriffs werden detailliert dargestellt.
Was sind Durkheims Vorstellungen von Anomie?
Durkheim definiert Anomie im Zusammenhang mit seinen Veröffentlichungen zum Thema "Selbstmord" und Krisenbewusstsein. Er geht von einem Menschenbild aus, das von starken Bedürfnissen und dem Bedarf an äußeren Regeln zur Domestizierung geprägt ist. Er betrachtet Arbeitsteilung als eine Ursache von Desorientierung und unterscheidet zwischen Kohäsionskrise (gesellschaftliche Regellosigkeit) und Regulationskrise (persönliche Regellosigkeit).
Wie unterscheidet sich Mertons Anomiebegriff von Durkheims Ansatz?
Merton geht von der Frage aus, warum abweichendes Verhalten in verschiedenen sozialen Strukturen variiert. Seine Überlegungen basieren auf den Prämissen des Erfolgsstrebens in der amerikanischen Gesellschaft und der Kriminalitätsbelastung der Unterschicht. Er betont die Diskrepanz zwischen kulturellen Zielen und den zur Verfügung stehenden Mitteln zur Zielerreichung.
Was sind die verschiedenen Anpassungstypen nach Merton?
Merton unterscheidet zwischen Konformität (Akzeptanz von Zielen und Mitteln) und abweichendem Verhalten, welches sich in Innovation (Akzeptanz von Zielen, Ablehnung von Mitteln), Ritualismus (Ablehnung von Zielen, Akzeptanz von Mitteln), Rückzug (Ablehnung von Zielen und Mitteln) und Rebellion (Ablehnung und Austausch von Zielen und Mitteln) äußert.
Welche Bedeutung hat die Anomietheorie für die Soziale Arbeit?
Die Anomietheorie ermöglicht es Sozialarbeitern, Klienten nicht nur als Täter, sondern auch als Opfer von gesellschaftlichen Umständen zu betrachten. Sie kann die Analyse der Ursachen von abweichendem Verhalten in gesellschaftlichen Strukturen unterstützen und zur Entwicklung von Bewältigungsstrategien beitragen.
Welche Anomievarianten werden im Fazit genannt?
Im Fazit werden drei Anomievarianten zusammengefasst: Anomie aus einer Kohäsionskrise, Anomie aus einer Regulationskrise und Anomie aus einer Strukturkrise.
- Quote paper
- Jonathan Bucciero (Author), 2000, Grundzüge der Anomietheorie. Geschichte, Strukturen und Bedeutung für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97008