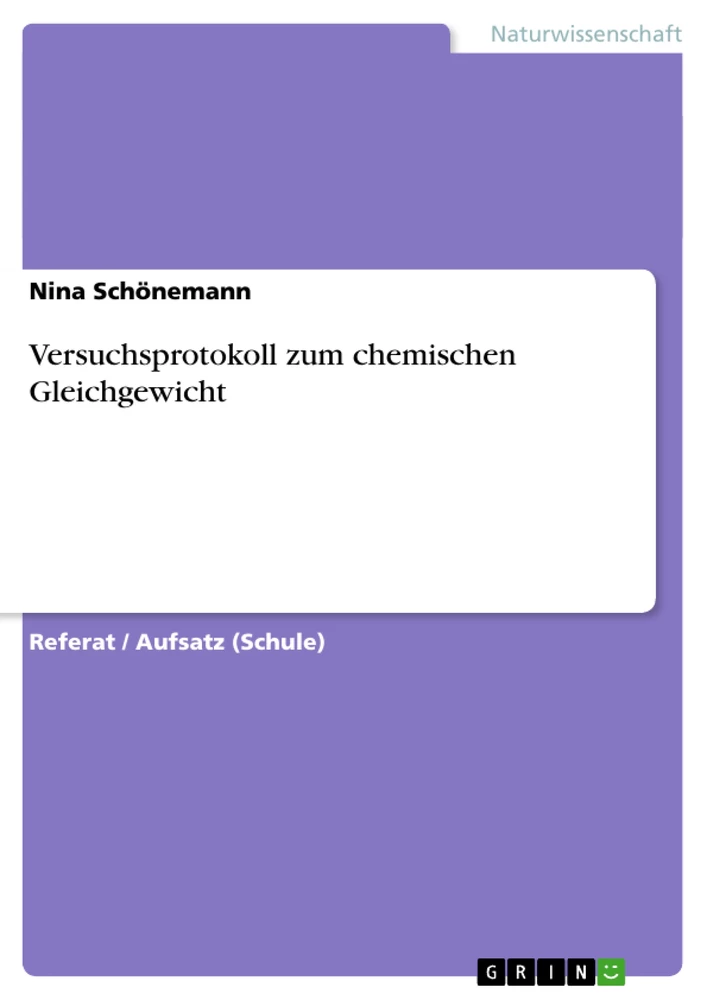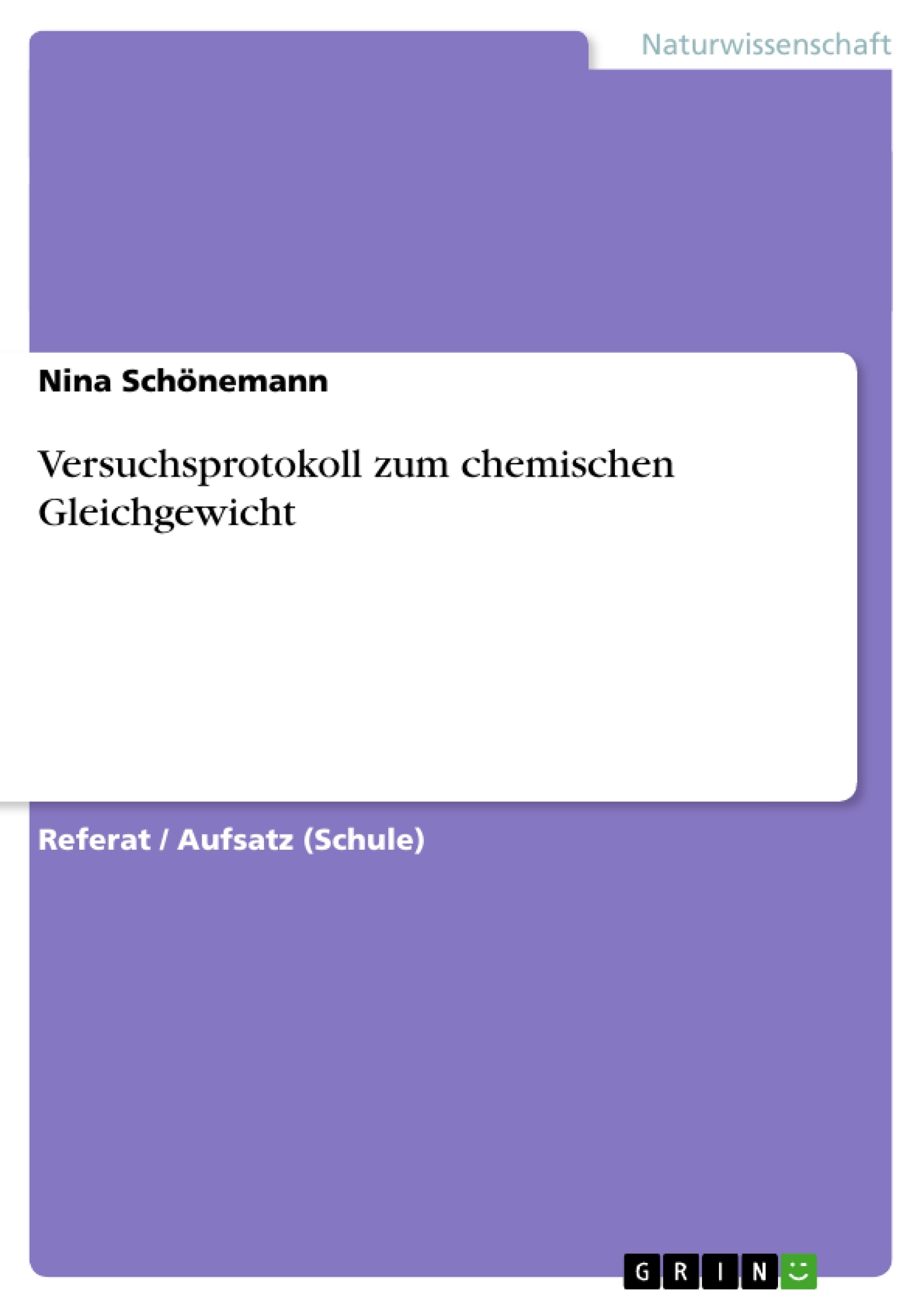Wie tief können wir in die unsichtbaren Prozesse eintauchen, die das chemische Universum beherrschen? Diese Untersuchung seziert das faszinierende Zusammenspiel von Reaktanten und Produkten im dynamischen Gleichgewicht der Esterhydrolyse und Veresterung. Durch präzise Titrationen und akribische Berechnungen wird die schwer fassbare Gleichgewichtskonstante entschlüsselt, ein Wert, der die Richtung und das Ausmaß einer Reaktion bei gegebenen Bedingungen offenbart. Der Leser wird in eine Welt der Erlenmeyerkolben, Messpipetten und Büretten entführt, in der Ethansäure, Ethanol und Ethansäureethylester die Hauptrollen spielen. Die sorgfältige Durchführung von Veresterungs- und Esterhydrolyse-Experimenten, begleitet von einer Blindprobe zur Kontrolle von Störeinflüssen, ermöglicht die Bestimmung der Säurekonzentration im Gleichgewichtszustand. Die Anwendung des Massenwirkungsgesetzes offenbart die subtile Balance zwischen Vorwärts- und Rückreaktion, während die Analyse der Messwerte und die Fehlerdiskussion die Grenzen der experimentellen Genauigkeit beleuchten. Tauchen Sie ein in die Geheimnisse der organischen Chemie und entdecken Sie, wie die Gleichgewichtskonstante als Schlüssel zum Verständnis der Reaktionskinetik und -thermodynamik dient. Dieses Werk ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Studenten, Chemiker und alle, die sich für die fundamentalen Prinzipien chemischer Reaktionen interessieren. Erforschen Sie die Einflüsse von Temperatur, Konzentration und Katalysatoren auf das chemische Gleichgewicht und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die molekularen Kräfte, die unsere Welt formen. Entdecken Sie die Bedeutung der Titration als analytisches Werkzeug und lernen Sie, wie Sie experimentelle Daten interpretieren, um die Geheimnisse der chemischen Reaktivität zu entschlüsseln. Berechnungen der Stoffmenge und Konzentration werden detailliert erklärt, um auch Lesern ohne Vorkenntnisse einen leichten Einstieg in die Thematik zu ermöglichen. Die Diskussion der experimentellen Ergebnisse und der Vergleich mit Literaturwerten regt zur kritischen Auseinandersetzung mit den Messmethoden und möglichen Fehlerquellen an. Dieses Buch bietet nicht nur eine theoretische Einführung in das chemische Gleichgewicht, sondern auch eine praktische Anleitung zur Durchführung und Auswertung von Experimenten. Es vermittelt ein tiefes Verständnis für die Prinzipien der physikalischen Chemie und ihre Anwendung in der organischen Chemie.Chemische Reaktionen, organisches Gleichgewicht, Esterhydrolyse, Veresterung, Titration, Gleichgewichtskonstante, Massenwirkungsgesetz, Reaktionskinetik, Thermodynamik, Ethansäure, Ethanol, Ethansäureethylester, Katalyse, Schwefelsäure, Natronlauge, Indikator, Bromthymol-Blau, experimentelle Chemie, physikalische Chemie, analytische Chemie, Fehlerdiskussion, Stoffmenge, Konzentration, Reaktionsgeschwindigkeit, Säure-Base-Reaktion, Neutralisation, chemisches Experiment, Labor, Messtechnik, chemische Analyse, Reaktionsmechanismus, Produktbildung, Edukt, Lösungschemie, quantitative Analyse,Stöchiometrie, molare Masse,Volumenberechnung,Verdünnung, Blindversuch, chemische Prozesse, Gleichgewichtszustand, chemische Umwandlung, chemische Bindung, Moleküle, Atome, chemische Formeln, Reaktionsbedingungen, Reaktionslenkung,Reaktionsausbeute,Reaktionsselektivität,Nachhaltige Chemie, Katalysatorentwicklung.
Chemisches Gleichgewicht und Berechnung der Gleichgewichtskonstante bei der Esterhydrolyse, bzw. der Veresterung
Problemstellung:
Wie untersucht man das chemische Gleichgewicht einer Reaktion mit Hilfe einer Titration und wie ermittelt man die Gleichgewichtskonstante einer Reaktion?
Versuchsplanung:
Man untersucht das Gleichgewicht einer Veresterung, weil die Reaktion allgemein bekannt ist. Dazu führt man drei Versuche durch. Es werden eine Veresterung, eine Esterhydrolyse und eine Blindprobe angesetzt. Bei allen Ansätzen muss das chemische Gleichgewicht eintreten. Das heisst, es wird genauso viel Säure erzeugt und verbraucht, wie Ester erzeugt und verbraucht wird. Die Stoffmengen ändern sich nicht mehr. Durch einen Katalysator (Schwefelsäure) wird es ermöglicht, dass das Gleichgewicht schon nach maximal 2 Tagen entsteht. Nachdem diese mit einem Indikator versetzt wurden, wird bei allen drei Lösungen eine Titration mit Natronlauge durchgeführt. Die Blindprobe dient zur Überprüfung, inwiefern die Schwefelsäure, das Meßergebnis beeinflußt. Schlägt die Farbe (des Indikators) um, dann ist in diesem Moment die gesamte Säure, die im Gleichgewicht vorhanden ist, durch die Natronlauge neutralisiert worden. Das Volumen der verbrauchten Natronlauge wird abgemessen, man kann dadurch errechnen, wieviel Säure noch im Gleichgewichtszustand vorhanden war. Dann müssen die Konzentrationen der anderen beteiligten Stoffe errechnet werden und daraus ergibt sich dann laut dem Massenwirkungsgesetz die Gleichgewichtskonstante.
Das Massenwirkungsgesetz
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Gleichgewichtskonstante entsteht aus dem Produkt der Produkte dividiert durch das Produkt der Edukte (Voraussetzung ist eine konstante Temperatur).
k = C · D / A · B
Die Titration
Maßanalytische Konzentrationsbestimmung, bei der man mit Hilfe eines Indikators den Gleichgewichtszustand einer Reaktion ermittelt. Man gibt dafür eine Lösung mit bekannter Konzentration zu der zu untersuchenden Probe.
Geräte:
- 100-ml-Erlenmeyerkolben + Stopfen (3 x)
- Messpipetten
- Bürette
- Becherglas (3 x)
- Rührmagnet (Magnetfisch)
- Chemikalien:
- 0,5 mol Ethansäure
- 0,5 mol Ethanol
- 0,5 mol Ethansäureethylester
- konzentrierte Schwefelsäure
- Aceton
- destilliertes Wasser
- Bromthymol-Blau-Lösung
- Natronlauge (0,1 mol/l)
Versuchsdurchführung:
1. Ansetzen der Veresterung
In einen Erlenmeyerkolben werden 28,6 ml Ethansäure, 29,2 ml Ethanol und 0,5 ml Schwefelsäure gegeben. Dann wird die Lösung mit Aceton bis auf 100 ml aufgefüllt. Sie muss 2 Tage lang bei Zimmertemperatur magnetisch gerührt werden.
2. Ansetzen der Esterhydrolyse
49 ml Ethansäureethylester, 9 ml destilliertes Wasser und 0,5 ml Schwefelsäure werden in einen Erlenmeyerkolben überführt. Die Lösung wird ebenso mit Aceton aufgefüllt und 2 Tage gerührt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Blindprobe
In einen Erlenmeyerkolben werden 0,5 ml der Schwefelsäure gegeben und mit destilliertem Wasser auf 100 ml aufgefüllt.
4. Titration
Zwei Tage später wird die Titration durchgeführt. Dazu füllt man ein Bürette mit 50 ml Natronlauge (NaOH). Von den drei Ansätzen wird jeweils 1 ml der Lösung entnommen und in Becherglas überführt. Dazu schüttet man einige Tropfen des Indikators Bromthymol-Blau, die Probe färbt sich gelb. Anschließend wird die Probe mit etwa 50 ml destilliertem Wasser verdünnt. Nun wird aus der Bürette die Natronlauge tröpfchenweise in die Lösung gefüllt, bis die Lösung nach Blau umschlägt. Dann muss das Volumen der verwendeten Natronlauge abgemessen werden (das Volumen der in der Bürette verbliebenen Natronlauge wird von den ursprünglichen 50 ml abgezogen).
Neutralisation durch die Titration
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Messprotokoll:
Drei Gruppen führten jeweils alle drei Titrationen durch.
Angegeben ist das Volumen der verbrauchten Natronlauge.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im weiteren Verlauf werden immer die Durchschnittswerte verwendet.
Auswertung:
Auswertung der Blindprobe
Der Wert bei der Blindprobe entspricht der Menge an Natronlauge, die nicht an Neutralisation der Ethansäure sondern an der Neutralisation der Salzsäure beteiligt ist. Deshalb muss man diesen Wert bei den beiden anderen Proben abziehen.
Esterhydrolyse: 29,6 ml - 16,5 ml = 13,1 ml
Veresterung: 30,3 ml - 16,5 ml = 13,8 ml
Die Volumina sind relativ gleich groß.
Berechnung der Stoffmenge von Ethansäure
Man berechnet erst die Stoffmenge der Natronlauge, da das Volumen (Meßwerte) und die Konzentration bereits bekannt ist. Das Verhältnis von Natronlauge zu Ethansäure ist:
n (Ethansäure) : n (NaOH) = 1 : 1
also n (NaOH) = n (Ethansäure)
Esterhydrolyse
ges.:
n (Ethansäure)
geg.:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
c (NaOH) = 0,1 mol/l
V = 0,0131 l
In der Probe (V = 1 ml):
n (NaOH) = c · V = 0,1 mol/l 0,0131 l = 0,00131 mol = n (Ethansäure)
Im Kolben (V = 100 ml):
Die Stoffmenge von Ethansäure muss mit 100 multipliziert werden, da die Neutralisation an der Probe durchgeführt wurde, deren Volumen nur 1 ml betrug.
n (Ethansäure) = 0,131 mol
Um nun die Konzentration zu errechnen müssen wir die Stoffmenge durch das Volumen dividieren.
c (Ethansäure) = n / V = 0,131 / 0,1 l = 1,31 mol/l
Veresterung
ges.:
n (Ethansäure) geg.:
n = c · V
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
c (NaOH) = 0,1 mol/l
V = 0,0138 l
In der Probe (V = 1 ml):
n (NaOH) = c · V = 0,1 mol/l 0,0138 l = 0,00138 mol = n (Ethansäure)
Im Kolben (V = 100 ml):
n (Ethansäure) = 0,138 mol
c (Ethansäure) = n / V = 0,138 / 0,1 l = 1,38 mol/l
Berechnung der Gleichgewichtskonstante
Zuerst müssen die Konzentrationen der anderen beteiligten Stoffe errechnet werden. Wir kennen die Konzentration von Ethansäure, die Ausgangskonzentrationen und die Verhältnisse.
c (Ethanol) = c (Ethansäure)
c(Wasser) = c (Ethansäureethylester) = c_ (Ethansäure) - c (Ethansäure)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bsp. Veresterung:
Im Gleichgewicht sind noch 1,38 mol der Ethansäure und ebensoviel Ethanol, da auch die Ausgangskonzentrationen gleich waren, vorhanden. Das heisst, der Rest von den anfänglichen 5 mol wurde umgewandelt. Pro Mol Ethansäure (und pro Mol Ethanol), die umgewandelt werden entsteht ein Mol Ester und ein Mol Wasser. Aus 3,62 mol Ethansäure und 3,62mol Ethanol entstanden also 3,62 mol Ester und 3, 62 mol Wasser. (Bei der Esterhydrolyse funktioniert alles anders herum)
Nun kann man die Gleichgewichstkonstante mit dem Massenwirkungsgesetz berechnen.
Veresterung NR:
k = c (Ethansäureethylester) · c (Wasser) / c (Ethanol) · c (Ethansäure)
k = (3,62)2 / (1,38)2 = 13,1044 / 1,9044 = 6,88
k (Veresterung) = 6,88 l/mol
Der Literaturwert ist mit k = 4 l/mol deutlich geringer. Eigentlich müßte also mehr von dem Produkt (Ester) im Gleichgewicht vorhanden sein.
Esterhydrolyse NR:
k = c (Ethanol) · c (Ethansäure) / c (Ethansäureethylester) · c (Wasser)
k = (1,38)2 / (3,69)2 = 1,9044 / 13,6161 = 0,14
k (Esterhydrolyse) = 0,14 l/mol
Die relativ kleine Konstante (< 1) zeigt, bei der Esterhydrolyse entstehen weniger Produkte (Säure) als Edukte (Ester). Die Konstante entspricht ungefähr dem Kehrwert der Konstante der Veresterung, da die Esterhydrolyse die Rückreaktion der Veresterung ist und also Edukte und Produkte vertauscht wurden (Literaturwert ist dementsprechend k = 0,25 l/mol).
Fehlerdiskussion:
Die Differenz zum Literaturwert kann durch verschiedene Fehler verursacht worden sein.
- Messungen wurden nicht exakt durchgeführt. Die Volumina der verschiedenen Stoffe und die Konzentration der Natronlauge könnten ungenau sein.
- Die Temperatur war nicht konstant und wahrscheinlich niedriger als im ,,Normalfall". Auch der Luftdruck könnte eine Rolle gespielt haben. Dadurch kann sich die Lage des Gleichgewichts (in Richtung der Esterhydrolyse) verschoben haben.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Chemisches Gleichgewicht und Berechnung der Gleichgewichtskonstante bei der Esterhydrolyse, bzw. der Veresterung"?
Der Text beschreibt ein Experiment zur Untersuchung des chemischen Gleichgewichts bei der Veresterung und Esterhydrolyse. Ziel ist es, die Gleichgewichtskonstante dieser Reaktionen durch Titration zu bestimmen.
Wie wird das chemische Gleichgewicht untersucht?
Das Gleichgewicht wird durch drei Versuche untersucht: eine Veresterung, eine Esterhydrolyse und eine Blindprobe. Die Reaktionen werden unter Zugabe eines Katalysators (Schwefelsäure) durchgeführt, um das Gleichgewicht schneller zu erreichen. Anschließend wird eine Titration mit Natronlauge durchgeführt, um die im Gleichgewicht vorhandene Säuremenge zu bestimmen.
Was ist das Massenwirkungsgesetz und wie wird es verwendet?
Das Massenwirkungsgesetz (MWG) beschreibt das Verhältnis der Konzentrationen der Reaktanten und Produkte im Gleichgewichtszustand. Die Gleichgewichtskonstante wird berechnet, indem das Produkt der Produktkonzentrationen durch das Produkt der Eduktkonzentrationen dividiert wird (bei konstanter Temperatur).
Welche Materialien und Chemikalien werden für das Experiment benötigt?
Zu den benötigten Materialien gehören Erlenmeyerkolben, Messpipetten, Bürette, Bechergläser, Rührmagnete, sowie Chemikalien wie Ethansäure, Ethanol, Ethansäureethylester, konzentrierte Schwefelsäure, Aceton, destilliertes Wasser, Bromthymol-Blau-Lösung und Natronlauge.
Wie wird die Titration durchgeführt?
Die Titration wird mit Natronlauge durchgeführt, um die Säuremenge in den Reaktionsgemischen zu bestimmen. Ein Indikator (Bromthymol-Blau) wird verwendet, um den Äquivalenzpunkt der Neutralisation zu erkennen. Das verbrauchte Volumen der Natronlauge wird gemessen, um die Stoffmenge der Säure zu berechnen.
Was ist die Rolle der Blindprobe?
Die Blindprobe dient dazu, den Einfluss der Schwefelsäure auf das Messergebnis zu berücksichtigen. Der Wert der Blindprobe wird von den Titrationsergebnissen der Veresterung und Esterhydrolyse abgezogen.
Wie werden die Stoffmengen und Konzentrationen der beteiligten Stoffe berechnet?
Zuerst wird die Stoffmenge der verbrauchten Natronlauge berechnet. Da das Verhältnis von Natronlauge zu Ethansäure 1:1 ist, entspricht die Stoffmenge der Natronlauge der Stoffmenge der Ethansäure. Die Konzentration wird dann durch Division der Stoffmenge durch das Volumen der Lösung berechnet.
Wie wird die Gleichgewichtskonstante berechnet?
Nachdem die Konzentrationen aller beteiligten Stoffe (Ethansäure, Ethanol, Ethansäureethylester und Wasser) im Gleichgewicht bekannt sind, wird die Gleichgewichtskonstante mithilfe des Massenwirkungsgesetzes berechnet.
Welche Ergebnisse wurden erzielt und wie werden sie interpretiert?
Die berechneten Gleichgewichtskonstanten für die Veresterung und Esterhydrolyse werden mit Literaturwerten verglichen. Abweichungen werden durch mögliche Fehlerquellen wie ungenaue Messungen, Temperaturschwankungen oder Verunreinigungen erklärt.
Welche Fehlerquellen können die Ergebnisse beeinflussen?
Mögliche Fehlerquellen sind ungenaue Messungen der Volumina und Konzentrationen, Temperaturschwankungen, Verunreinigungen der Geräte und Chemikalien sowie Abweichungen vom idealen Verhalten der Lösungen.
- Arbeit zitieren
- Nina Schönemann (Autor:in), 1999, Versuchsprotokoll zum chemischen Gleichgewicht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96926