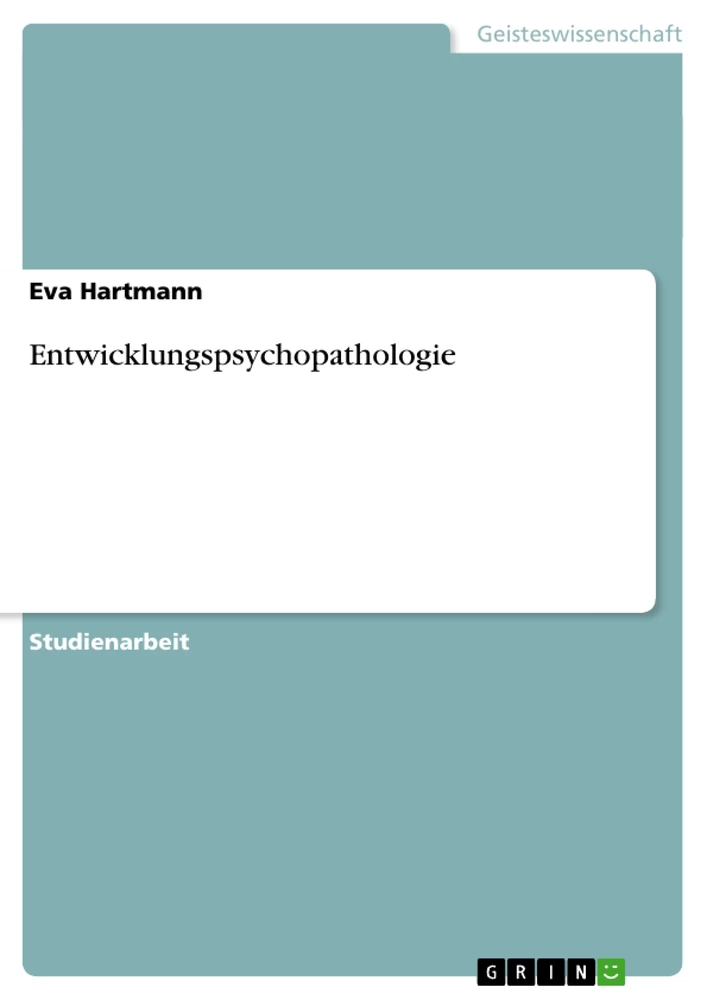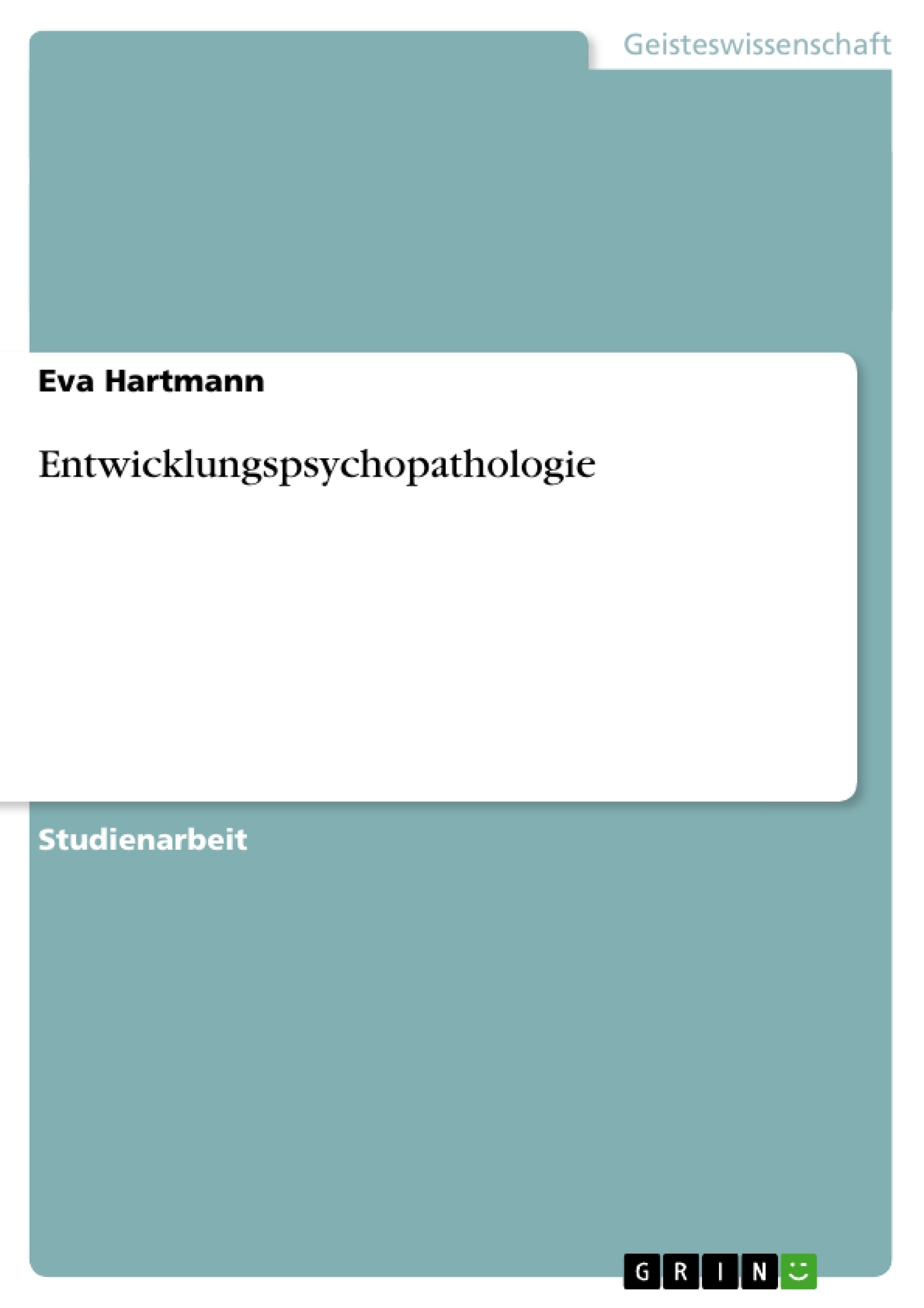INHALTSVERZEICHNIS
1. Einführung
2. „Entwicklung“ des Konzepts der protektiven Faktoren
2.1. Zwei Arten protektiver Einflüsse
2.1.1. Temperamentsmerkmale
2.1.2. Kognitive Kompetenzen
2.1.3. Selbstbezogene Kognitionen
2.1.4. Emotionale sichere Bindung an eine Bezugsperson
2.1.5. Merkmale des Erziehungsklimas
2.1.6. Soziale Unterstützung in und auß erhalb der Familie
3. Voraussetzung einer sinnvollen Verwendung des Schutzkonzepts
3.1. Abgrenzung gegenüber Risikofaktoren
3.2. Nachweis eines Puffereffekts
3.3. Abgrenzung gegenüber Kompetenzen des Kindes
3.4. Nachweis einer zeitlichen Priorität
4. Schlußbemerkung
5. Literatur
1. Einführung
Die vorliegende Arbeit „ Wovor schützen Schutzfaktoren? Anmerkungen zu einem populären Konzept der Gesundheitsforschung “ von M. Laucht, G. Esser und M. H. Schmidt, die in der Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie erschien und mit der ich mich näher beschäftigte, befaßte sich mit einigen theoretischen und methodischen Prob- lemen des Schutzkonzepts und diskutierte Voraussetzungen für seine sinnvolle Verwendung. Erörtert wurden 1) die Abgrenzung der Schutz- von den Risikofaktoren, 2) der Nachweis ei- nes Puffereffekts der protektiven Faktoren, 3) die Abgrenzung gegenüber Kompetenzen des Individuums und 4) der Nachweis einer zeitlichen Priorität der Schutzfaktoren.
Die Erforschung der psychischen Entwicklung des Menschen war in der Vergangenheit darauf konzentriert, die Ursachen von Fehlentwicklungen und Inkompetenz zu ergründen. Heute ist das Individuum mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Lebensbewältigung in den Vordergrund gerückt. In der Entwicklungspsychopathologie hat man in der letzen Zeit einen deutlichen Akzent auf protektive Faktoren und Prozesse gesetzt, insbesondere unter dem Stichwort der Resilienz. Gefragt wird, warum manche Menschen trotz vielfältiger Belastungen und Risiken gesund bleiben oder sich relativ leicht von Störungen erholen, während andere unter vergleichbaren Bedingungen besonders anfällig sind. Grundsätzlich geht es bei dem Begriff der Resilienz um eine relative Widerstandskraft gegenüber pathogenen Umständen und Ereignissen. Sie kann über die Zeit und Umstände variieren.
Im Verlauf der „neueren“ Forschung über Fähigkeiten und Möglichkeiten der Lebensbewälti- gung kam es zu einem Wandel vom Defizitmodell (Was fehlt dem Individuum? Wie konnte es zu psychischen Störungen kommen?) zum Kompetenzmodell (Welche Kompetenzen hat das Individuum, um Belastungen entgegenzuwirken? Was gibt es für Schutzfaktoren, die die Lebensbewältigung erleichtern?) des Individuums. Leider weist aber das Konzept der protek- tiven Faktoren noch einige konzeptuelle und methodische Probleme auf. So kann man sich z.B. fragen, ob protektive Faktoren nur die „Kehrseite der Medaille“ von Risikofaktoren dar- stellen oder ob sich beispielsweise durch die Berücksichtigung von Schutzfaktoren die Prog- nose von Risikokinder verbessern läßt?
2. „Entwicklung“ des Konzepts der protektiven Faktoren
Das Interesse an protektiven Faktoren wurde durch eine bestimmte Beobachtung geweckt. Man entdeckte die sogenannten „Superkids“. Das waren Kinder, die sich trotz massiver psy- chischer Belastung und widrigster Lebensumstände zu gesunden Erwachsenen entwickelten. Diese erfolgreiche Überwindung und Bewältigung schwerwiegender Belastungen wurde in einer Reihe von Veröffentlichungen der späten 70er und frühen 80er Jahre sogar nahezu als Wunder beschrieben.
E. Werner et al., die sich in ihrer hawaianischen Studie mit erfolgreichen Risikokindern be- schäftigten, beschrieben diese als „vulnerable, but invincible“, also als verletzlich aber letzt- endlich doch unbesiegbar. E. Werner und ihre Mitarbeiter beobachteten und verglichen die Kinder, die sich trotz massiver Beeinträchtigungen zu gesunden Erwachsenen entwickelt hat- ten, mit denjenigen, deren Entwicklung unter den gleichen Bedingungen viel ungünstiger ver- lief. Sie ermittelten auf der Basis dieser Beobachtung eine Reihe von Merkmalen, von denen sie annahmen, daß sie die Kinder der einen Gruppe vor dem unglücklichen Schicksal der an- deren bewahrt hatten. So wurde eine erste Liste von protektiven Faktoren entwickelt.
2.1. Zwei Arten protektiver Einflüsse
Es gibt zwei Arten protektiver Einflüsse. Zu nennen sind hier auf der einen Seite die persona- len Ressourcen, die die Schutzfaktoren in der Person des Kindes darstellen, und auf der ande- ren Seite die sozialen Ressourcen, womit die Schutzfaktoren in der Betreuungsumwelt des Kindes gemeint sind. Einige der personalen und sozialen Schutzfaktoren möchte ich an dieser Stelle näher erläutern.
2.1.1. Temperamentsmerkmale
Resiliente Kinder und Jugendliche zeigen teilweise aufgrund angeborener Dispositionen Re- gelmäßigkeiten in den biologischen Funktionen, geringe Irritierbarkeit, gutes Anpassungs- vermögen und eine gemäßigte, vorwiegend positive Stimmungslage. Kinder mit einem „schwierigen“ Temperament sind dagegen häufiger Zielscheibe der elterlichen Kritik, Reiz- barkeit und Feindseligkeit. Im Sinne einer ungünstigen „Passung“ von Eltern- und Kindver- halten wird ein schwieriges Temperament vor allem dann zu einem Risikofaktor, wenn die sozialen Ressourcen und Kompetenzen in der Familie gering sind. (Aber unter bestimmten Umweltbedingungen kann ein schwieriges Temperament sogar eine Schutzfunktion haben. So hatten z.B. unter den Bedingungen einer großen Dürre bei einem Eingeborenenstamm in Afrika die schwierigen und mehr fordernden Säuglinge ein größere Überlebenschance.)
2.1.2. Kognitive Kompetenzen
Die protektive Funktion kognitiver Kompetenzen muß im engen Zusammenhang mit motiva- tionalen Faktoren gesehen werden. So zeigten positive Schulleistungen auch dann protektive Effekte, wenn sie nicht mit überdurchschnittlicher Intelligenz zusammenhingen. Die Wirkung liegt wahrscheinlich darin, daß sie eine Quelle der Selbstbestätigung sind und dabei helfen, z.B. negative Erfahrungen in der Familie zu kompensieren. Andererseits kann ein übersteiger- tes Leistungsverhalten auch zu Versagensängsten und psychosomatischen Störungen beitra- gen.
2.1.3. Selbstbezogene Kognitionen
Resiliente Kinder und Jugendliche zeigen im Vergleich zu vulnerablen mehr Selbstvertrauen, ein positiveres Selbstwertgefühl sowie stärkere Überzeugungen, daß sie selbst wirksam und nicht hilflos sind. Die Schutzfunktion besteht wahrscheinlich darin, daß durch das Erleben von Selbstwert und Selbstwirksamkeit Anpassungsversuche in Gang gesetzt werden, die bei Gefühlen der Hilflosigkeit unterbleiben. So können z.B. Ereignisse als weniger belastend wahrgenommen werden und mehr aktive Coping-Muster initiiert werden.
2.1.4. Emotional sichere Bindung an eine Bezugsperson
Eine stabile, emotional warme Beziehung zu einem Elternteil kann eine wichtige Schutzfunk- tion gegen andere Stressoren haben. Dies zeigte sich z.B. bei der Bewältigung von psychi- scher Krankheit in der Familie, von familiären Streitigkeiten, von Kindesmißbrauch oder Scheidung der Eltern. Eine sichere Bindung an eine Bezugsperson beinhaltet aber auch mit dem Älterwerden des Kindes einen Ablösungsprozeß zwischen Kind und Bezugsperson. Ansonsten kann die Gefahr der Entwicklung von emotionaler Abhängigkeit bestehen.
2.1.5. Merkmale des Erziehungsklimas
Im engen Zusammenhang mit der Bindung an Bezugspersonen stehen Merkmale des Erziehungsklimas. In Familien mit resilienten Kindern wurde häufiger etwas gemeinsam unternommen, das emotionale Klima war herzlicher, es bestanden aber auch feste Regeln für das Verhalten. Ähnlich zeigte sich auch bei Scheidungskindern, daß sich Unterstützung und Strukturgebung günstig auswirkten.
2.1.6. Soziale Unterstützung in und auß erhalb der Familie
Das Vorhandensein und die Nutzung von sozialer Unterstützung durch Familienmitglieder, Verwandte, Lehrer, Freunde usw. tragen ebenfalls zur Resilienz bei. Unterstützende Personen tragen nicht nur zur unmittelbaren Problemreduzierung bei, sondern sind zugleich Modelle für aktives und konstruktives Bewältigungsverhalten. Im Kontext der sozialen Unterstützung können aber auch Risikoeffekte auftreten. So hat z.B. bei Straßenkindern die jeweilige PeerGruppe einerseits eine emotional stützende Funktion, ist aber andererseits Modell und Verstärker für delinquentes Verhalten oder riskante Lebensstile.
Viele der oben genannten Merkmale sind sehr vertraut aus Katalogen von Risikofaktoren - aber in jenem Kontext als Gegenpole oder als das Fehlen von Merkmalen. Männliches Ge- schlecht ist z.B. ein Risiko für eine gesunde seelische Entwicklung des Kindes, ebenso wie z.B. negatives Temperament oder fehlende Freundschaftsbeziehungen. An dieser Stelle kann man das zentrale Problem des Konzepts der protektiven Faktoren er- kennen: Es besteht die Gefahr, daß nur das Fehlen von Risiken erfaßt wird. Deshalb stellte u. a. M. Rutter die Forderung, daß Risiko- und Schutzfaktoren klar voneinander abgegrenzt werden müssen und eindeutige Vorstellungen darüber formuliert werden sollen, wie Risiko- und Schutzfaktoren zusammenwirken.
3. Voraussetzungen eine sinnvollen Verwendung des Schutzkonzepts
3.1. Abgrenzung gegenüber Risikofaktoren
Protektive Faktoren sollten begrifflich und methodisch eindeutig von Risikofaktoren abge- grenzt werden, um auszuschließen, daß Schutzfaktoren nur das Gegenteil oder das Fehlen von Risikofaktoren erfassen. Außerdem ist es wichtig, Schutzfaktoren unabhängig von Risikofaktoren zu definieren und operationalisieren, d. h. z.B. auf einer anderen Entwicklungsdimension oder nicht einfach als Komplement eines Risikofaktors.
3.2. Nachweis eines Puffereffekts
Das sogenannte Puffer-Modell besagt, daß protektive Faktoren die schädliche Wirkung eines Risikofaktors moderieren, d. h. daß bei Vorhandensein eines Schutzfaktors der Risikoeffekt gemindert oder beseitigt wird. Fehlt ein protektives Merkmal, dann kommt der Risikoeffekt voll zum Tragen. Hinter diesem Modell steht die Vorstellung einer Pufferwirkung von Schutzfaktoren. Ein protektiver Faktor ist besonders oder ausschließlich dann wirksam, wenn eine Gefährdung vorliegt; ohne Gefährdung kommt ihm keine besondere Rolle zu. Diese Beziehung verlangt methodisch gesehen den Nachweis einer spezifischen Interaktion von Risiko- und Schutzfaktoren, da es aber methodische schwierig ist, Interaktionseffekte statistisch zu prüfen, gibt es deshalb noch eine einfachere Vorstellung über das Zusammenspiel der Faktoren, die sich im Förder-Modell niederschlägt.
Dieses Modell besagt, daß lediglich erwartet wird, daß von einem protektiven Faktor ein ge- sundheitsförderlicher Einfluß ausgeht. Dieser Einfluß wird nicht auf die Risikogruppe be- schränkt gesehen, sondern als ein allgemeiner, unspezifischer Fördereffekt, von dem jedes Individuum in gleicher Weise profitiert. D. h. auch bei fehlender Risikobelastung tritt eine förderliche Wirkung des Schutzfaktors ein, und zwar in gleichem Umfang wie bei einer vor- handenen Risikobelastung.
Die Autoren des Artikels fragen nun, worin denn der Schutzeffekt bestehe? Meiner Meinung nach ist diese Frage berechtigt, denn wovor werden die Kinder der Nichtrisikogruppe, die keiner Belastung ausgesetzt sind, geschützt? Man gelangt also mit dem Förder-Modell zu einer Aussage, die erheblich unspektakulärer ist als die Unterstellung eines Puffereffekts protektiver Faktoren, der nur unter Belastung wirksam wird.
3.3. Abgrenzung gegenüber Kompetenzen des Kindes
Es ist schwierig, die protektive Wirksamkeit von Kompetenzen des Kindes nachzuweisen. Man muß hierbei vermeiden, ein und dasselbe Kindmerkmal lediglich in unterschiedlichen Funktionen zu betrachten: einmal als Kompetenz, die vor Krankheit schützt (als protektiver Faktor) und einmal als Kompetenz, die als Zeichen einer positiven Entwicklung verstanden wird (als Ergebnis einer geschützten Entwicklung). Man sollte also protektive Kindmerkmale und Entwicklungsmerkmale unabhängig voneinander bestimmen, um nicht lediglich die Sta- bilität eines Kindmerkmals als protektiven Effekt zu interpretieren. Ein Beispiel soll diesen Sachverhalt verdeutlichen:
Positives Temperament eines Säuglings gilt häufig als protektiver Faktor für seine spätere kognitive Entwicklung. Wegen der noch geringen psychischen Differenzierung in der frühen Kindheit sind aber Merkmale seines Temperaments und seiner kognitive Entwicklung miteinander korreliert. Findet man einen Zusammenhang zwischen dem protektiven Faktor „ positives Temperament“ des Säuglings und seiner späteren kognitiven Kompetenz, so kann diese Beziehung allein durch die Stabilität des Merkmals „kognitive Kompetenz“ begründet sein, ohne daß es der Annahme einer protektiven Wirkung bedarf. Um diese Interpretation auszuschließen, ist zu prüfen, ob dann ein Effekt des positiven Temperaments besteht, wenn der Einfluß der Merkmalsstabilität auspartialisiert wird.
3.4. Nachweis einer zeitlichen Priorität
Ein protektiver Faktor sollte zeitlich vor einem Risikofaktor nachweisbar sein. Ohne diese Voraussetzung könnte man nicht sicher sein, ob mit einem Merkmal, in dem sich Risikokin- der mit günstiger und ungünstiger Entwicklung unterscheiden (und das als protektiver Faktor interpretiert werden soll), wirklich die Ursache dieser Entwicklung oder nur deren Folge er- faßt wird. Der häufig beschriebene Schutzfaktor „positives Selbstwertgefühl“ kann z.B. eben- sogut als Folge einer gesunden Entwicklung trotz Risikobelastung (z.B. fehlende soziale Un- terstützung) angesehen werden wie auch als protektives Merkmal, das eine solche Entwick- lung hervorruft.
4. Schlußbemerkung
Mit dem Schutzkonzept verbinden sich große Hoffnungen, weil es beispielsweise u. a. wichti- ge Anregungen für eine wirkungsvolle Prävention von Entwicklungsstörungen gibt. Aber trotzdem sollte man das Konzept der protektiven Faktoren kritisch betrachten. Diese kritische Betrachtungsweise soll anhand der Definition des Risikofaktors in der Epidemiologie kurz erläutert werden.
Die Definition sagt, daß ein Risikofaktor ein Merkmal ist, das bei einer Gruppe von Individu- en, auf die dieses Merkmal zutrifft, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Störung im Vergleich zu einer unbelasteten Kontrollgruppe erhöht (Garmezy, 1983), Es erkranken nicht alle risikobelasteten Individuen, sondern nur eine Teilmenge (aber signifikant mehr als unbe- lastete Individuen).
Diese Definition zeigt die Unschärfe des Risikobegriffs, denn es bleibt z.B. unklar, worin eine Belastung für das Individuum besteht oder warum Risikofaktoren so wirken. Wichtig ist auch, inwieweit Stressoren objektiv oder subjektiv (im Sinne der erlebten Belastung) definiert wer- den.
Es zeigt sich also, daß hinsichtlich der Definition und Operationalisierung der (psychischen) Gesundheit sowie der Risiko- und Schutzfaktoren Probleme bestehen. Insbesondere erweist es sich als fraglich, inwieweit bei bestimmten Merkmalen generell von Risiken oder Schutzfunktionen gesprochen werden kann. Je nach Kontext, Entwicklungsabschnitt, Störungsform usw. ergeben sich unterschiedliche Effekte.
Erst die Präzisierung des Risikokonzepts und die Spezifikation der Prozesse und Mechanis- men, die einem Risikoeffekt zugrunde liegen, erlauben differenziertere Aussagen über das Zusammenwirken von Risiko- und Schutzfaktoren. Ist die Wirkungsweise eines Risikofaktors geklärt, lassen sich auch gezielt Hypothesen darüber formulieren, wie Schutzfaktoren in die- sen Prozeß eingreifen (können), um die schädlichen Folgen von Risiken unwirksam werden zu lassen.
5. Literatur
- Laucht, M.; Esser, G. & Schmidt, M. H. (1997). Wovor schützen Schutzfaktoren? Anmer- kungen zu einem populären Konzept der Gesundheitsforschung. Zeitschrift für Entwick- lungspsychologie und Pädagogische Psychologie 29, 260 - 270
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit "Wovor schützen Schutzfaktoren? Anmerkungen zu einem populären Konzept der Gesundheitsforschung"?
Die Arbeit von M. Laucht, G. Esser und M. H. Schmidt befasst sich mit theoretischen und methodischen Problemen des Schutzkonzepts in der Gesundheitsforschung. Sie diskutiert Voraussetzungen für eine sinnvolle Verwendung des Konzepts, insbesondere die Abgrenzung von Schutz- und Risikofaktoren, den Nachweis eines Puffereffekts, die Abgrenzung gegenüber Kompetenzen des Individuums und den Nachweis einer zeitlichen Priorität der Schutzfaktoren.
Was sind protektive Faktoren?
Protektive Faktoren sind Einflüsse, die Menschen widerstandsfähiger gegenüber negativen Lebensereignissen und Risiken machen. Sie helfen, trotz Belastungen gesund zu bleiben oder sich leichter von Störungen zu erholen. Es gibt personale Ressourcen (Schutzfaktoren in der Person des Kindes) und soziale Ressourcen (Schutzfaktoren in der Betreuungsumwelt des Kindes).
Welche Arten von protektiven Faktoren gibt es?
Es gibt personale und soziale Ressourcen. Personale Ressourcen umfassen Temperamentsmerkmale, kognitive Kompetenzen, selbstbezogene Kognitionen (Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl) und emotionale Kompetenzen. Soziale Ressourcen beinhalten emotionale sichere Bindungen an Bezugspersonen, Merkmale des Erziehungsklimas und soziale Unterstützung innerhalb und außerhalb der Familie.
Warum ist es wichtig, Schutzfaktoren von Risikofaktoren abzugrenzen?
Um sicherzustellen, dass Schutzfaktoren nicht lediglich das Fehlen von Risikofaktoren erfassen. Es ist wichtig, Schutzfaktoren unabhängig von Risikofaktoren zu definieren und zu operationalisieren, um ihren spezifischen Beitrag zur Resilienz und positiven Entwicklung zu verstehen.
Was ist der "Puffereffekt" von Schutzfaktoren?
Der Puffereffekt beschreibt, wie Schutzfaktoren die schädliche Wirkung von Risikofaktoren abschwächen oder beseitigen können. Im "Puffer-Modell" ist ein protektiver Faktor besonders wirksam, wenn eine Gefährdung vorliegt. Ohne Gefährdung kommt ihm keine besondere Rolle zu.
Was ist das "Förder-Modell" im Kontext von Schutzfaktoren?
Im "Förder-Modell" wird erwartet, dass ein protektiver Faktor einen gesundheitsförderlichen Einfluss hat, unabhängig davon, ob eine Risikobelastung vorliegt oder nicht. Dieser Einfluss ist ein allgemeiner, unspezifischer Fördereffekt, von dem jedes Individuum profitiert.
Warum ist die Abgrenzung von Schutzfaktoren gegenüber Kompetenzen des Kindes wichtig?
Um zu vermeiden, dass ein und dasselbe Kindmerkmal lediglich in unterschiedlichen Funktionen betrachtet wird: einmal als Kompetenz, die vor Krankheit schützt, und einmal als Kompetenz, die als Zeichen einer positiven Entwicklung verstanden wird. Es ist wichtig, protektive Kindmerkmale und Entwicklungsmerkmale unabhängig voneinander zu bestimmen.
Warum ist der Nachweis einer zeitlichen Priorität von Schutzfaktoren wichtig?
Ein protektiver Faktor sollte zeitlich vor einem Risikofaktor nachweisbar sein. Andernfalls könnte man nicht sicher sein, ob das Merkmal wirklich die Ursache für eine positive Entwicklung ist oder nur deren Folge.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Das Konzept der Schutzfaktoren bietet wichtige Anregungen für die Prävention von Entwicklungsstörungen, sollte aber kritisch betrachtet werden. Es bestehen Probleme hinsichtlich der Definition und Operationalisierung von Gesundheit sowie von Risiko- und Schutzfaktoren. Die Wirkungsweise von Risikofaktoren muss geklärt werden, um gezielte Hypothesen über das Zusammenwirken von Risiko- und Schutzfaktoren zu formulieren.
- Quote paper
- Eva Hartmann (Author), 1999, Entwicklungspsychopathologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96851