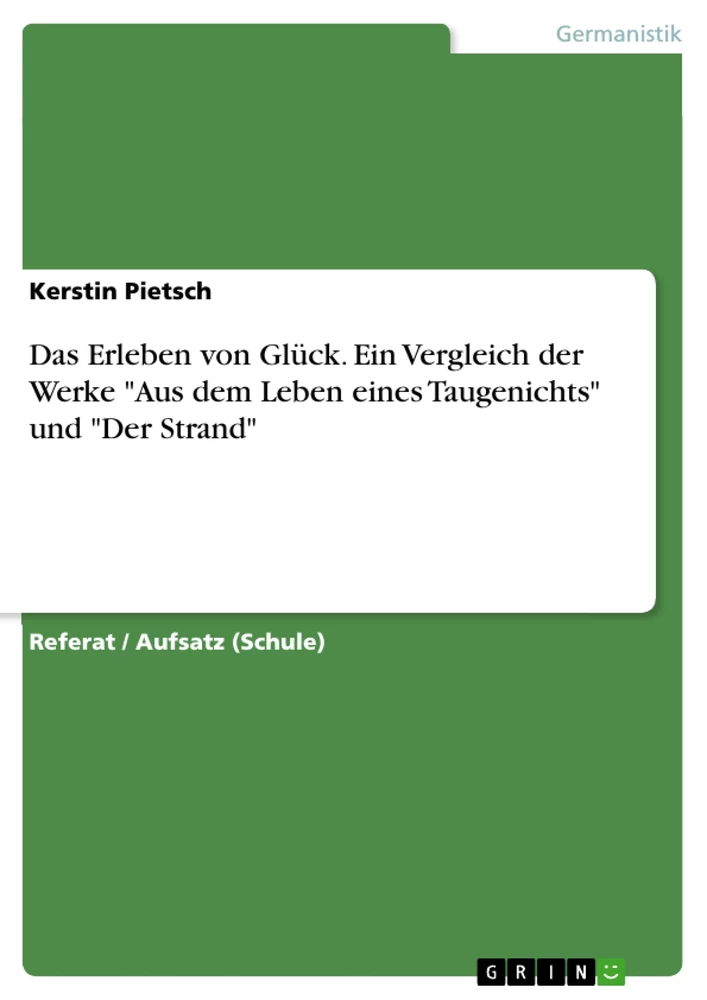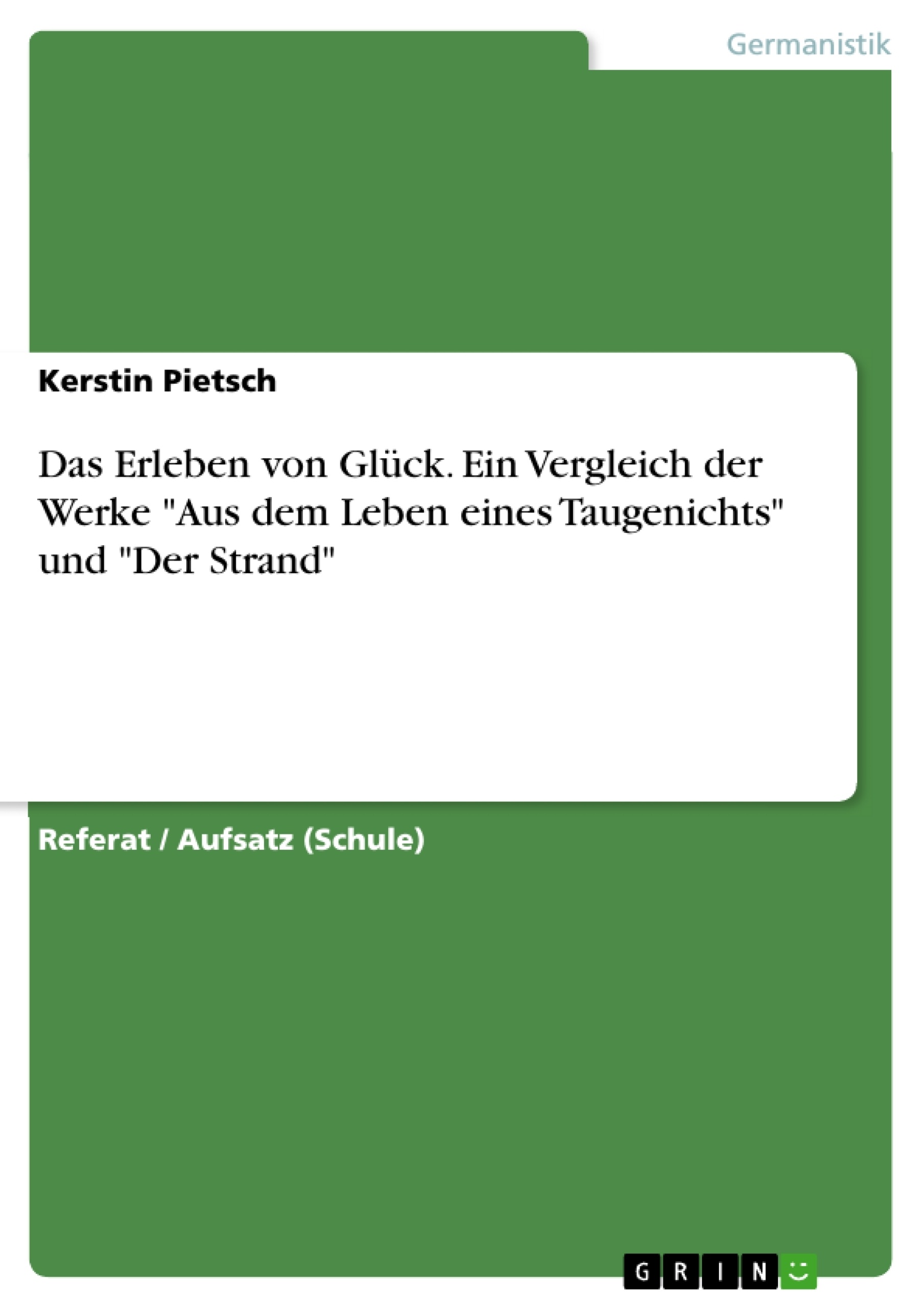Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema des Glücks. Hierfür wird ein Vergleich des Erlebens von Glück der Protagonisten in den Werken „Aus dem Leben eines Taugenichts“ von Joseph von Eichendorff und „Der Strand“ von Alex Garland angestellt.
Allgemeine Definition von Glück:
(Geschick, Zufall, Schicksal(smacht)
Komplexe Erfahrung der Freude angesichts der Erfüllung von Hoffnungen, Wünschen, Erwartungen, des Eintretens positiver Ereignisse, Eins-Sein des Menschen mit sich und dem von ihm Erlebten. Glück beinhaltet sowohl günstige Fügung der Geschehnisse, des Schicksals, als auch den Zustand des Wohlbefindens, der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben.
Thema des Referates: Vergleich des Erlebens von Glück der Protagonisten in den Werken „Aus dem Leben eines Taugenichts“ verfasst von Joseph von Eichendorff und „Der Strand“ von Alex Garland
Zunächst fällt bei der Novelle Eichendorffs auf, das die Reise des Taugenichts stark von Zufällen bestimmt ist. Er beginnt seine Reise in einem sehr naiven Glauben an Gott und an die positive Fügung des Schicksals, was als Leitidee in der gesamten Novelle zu finden ist. So bestimmt er seinen weiteren Weg häufig nicht selbst, sondern wird vor beschlossene Entscheidungen gestellt, deren Wirkungen aber immer nur positiv für ihn ausfallen. So braucht er sich kaum um seine finanzielle Versorgung zu kümmern und auch für sein leibliches Wohl wird immer ausreichend gesorgt. Dies hat zur Folge, das der Taugenichts nur sehr selten Gefühle des Unglücks oder des Leids erfährt und er daher mit einem fast ständigen Gefühl der Harmonie, Freude und Zufriedenheit mit seinem Leben zu charakterisieren ist.
Diese positiven Gefühle stehen in eingeschränktem Gegensatz zu Richards Reise. Einerseits ist der Beginn von Richards Reise zu dem geheimnisvollen Strand auch durch die Fügung des Schicksals bestimmt. Denn durch die eher zufällige Begegnung mit Daffy Duck und durch das Erhalten der Karte erreicht Richards Reise erst diese ganz spezifische Zielrichtung. Andererseits richtet Richard nach dieser zufälligen Begebenheit sein gesamtes weiteres Handeln auf das Erreichen dieses Zieles aus, denn diese Karte hat Wünsche, Erwartungen und damit Sehnsucht in ihm geweckt und er will diese Sehnsucht gerne befriedigen. Daher kann Richard sich nicht passiv der Fügung des Schicksals ergeben, wie es der Taugenichts tut, sondern muß existentielle Gefahren bewältigen.
Um zu diesem Traumstrand zu gelangen, muß Richard z.B. einen ca. 10- 12 Meter hohen Wasserfall hinunterspringen (S.94- 98). Zunächst jagt dieser Wasserfall ihm große Angst ein und er diskutiert mit Francoise und Ètienne, wie gewiß es ist, dass der Traumstand wirklich in dem vorgefundenen Tal liegt und ob es noch andere Wege gibt, dorthin zu gelangen. Außerdem ist er von den vorangegangenen Strapazen noch sehr erschöpft. Während er noch seine Chancen abwägt, „durchflutet“ ihn plötzlich ein „überwältigendes Gefühl“ der „Lustlosigkeit“(Z. 18f). Ganz plötzlich ist er in der Lage seine große Angst zu überwinden und sehr großen Mut aufzubringen. Er springt den Wasserfall hinunter und ist anschließend sehr stolz auf seine Leistung und empfindet große Freude und damit auch großes Glück. Sobald er aus dem Wasser auftaucht, macht er seiner Freude durch einen lauten Schrei Luft und schlägt „mit beiden Armen ins Wasser“(S.98, Z.5), obwohl er kurz vorher noch Angst hatte, jemand könnte ihn und seine Freunde entdecken. Doch das ist ihm jetzt völlig gleichgültig und er ist nur sehr erleichtert, das er den Sprung überlebt hat. Diese Erleichterung schreit er mit einem weiteren Ausruf darauf auch laut hinaus (Z.6). Dann sieht er die besorgten Gesichter seiner Freunde und schreit auch ihnen sein Glück entgegen: „,Mir geht’s gut! Mir geht’s ausgezeichnet!`“(Z. 10). Diese Ausrufe sind wieder ein Beleg für seinen Stolz, das er seine Angst überwinden konnte, aber auch für seine Erleichterung und Zufriedenheit. Dies wird durch die Steigerung der Adjektive und durch den vorliegenden Parallelismus deutlich. Nachdem Richard seine durchnäßte Zigarette entdeckt hat, fängt er an zu lachen, was ein allgemeines Zeichen für Heiterkeit ist und seine große Erleichterung und Freude nochmals betont. Darauf folgen zwei weitere Ausrufe, die seine positiven Gefühle erneut betonen (Z. 14f). Außerdem gebraucht er einen umgangssprachlichen Fluch, welcher seine ganz spezielle Art der Freude charakterisiert. Darauf kehrt wieder Ruhe in sein Gemüt zurück und er läßt „die Füße ins Wasser baumeln“(Z.17f), was auf einen Zustand der Entspannung, des Wohlbefindens und der inneren Harmonie schließen lässt. Als weiteres Zeichen seiner Entspannung und Ruhe zündet er sich nun eine neue Zigarette an, die er sich wie eine kleine Belohnung gönnt und genießt. Zusammenfassend ist also in bezug auf diese Textstelle festzuhalten, das Richard diesen glücklichen Moment nach einer Situation existentieller Gefahr zunächst sehr intensiv und auch körperlich betont erlebt, sich aber dann in einem Zustand innerer Ruhe und Zufriedenheit wieder entspannt.
Vergleichbare Textstellen sind in der Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“ nicht zu finden, da der Taugenichts ähnliche Gefahren auf seiner Reise nicht bewältigen muß. Dagegen wird auf seiner Reise sehr gut deutlich, das der Taugenichts sich an den kleinen Dingen des Lebens freuen kann und nicht existentielle Gefahren bestehen muß um Zufriedenheit mit seinem Leben zu spüren. Dieser Aspekt läßt sich sehr gut an seinem Einzug in das Haus des Einnehmers festmachen (S.16). Dort findet er „einen prächtigen roten Schlafrock mit gelben Punkten, grüne Pantoffeln, eine Schlafmütze und einige Pfeifen mit langen Röhren“(Z.4ff) vor. Diese simplen Kleidungsstücke und die Pfeifen bereiten ihm Gefühle großen Glücks, denn schon früher hatte er sich solche Kleidungsstücke gewünscht und somit gehen in diesem Moment Hoffnungen und Wünsche für ihn in Erfüllung. Dies ist ein zentraler Aspekt des allgemeinen Erlebens von Glück. Die damit verbundenen positiven Gefühle werden in seinem weiteren Verhalten und in seinen Gedanken deutlich. Denn als erstes macht er es sich auf „dem Bänkchen vor (seinem) Hause in Schlafrock und Schlafmütze“ (Z. 10) gemütlich. Dabei raucht er „Tabak aus dem längsten Rohre“ und genießt sein Glück in vollen Zügen. Die Freude an dieser Situation wird durch den Diminutiv und das Personalpronomen im ersten Zitat verdeutlicht. Außerdem wird gezeigt, das er vor lauter Glück mit gesellschaftlichen Forderungen bricht und sich damit auch mehr oder weniger bewußt gegen die Forderungen der Philister (= Spießbürger) seiner Zeit stellt. Denn es wäre wohl niemals in ihrem Sinne gewesen, wenn ein Einnehmer sich in Schlafrock und Schlafmütze vor sein Haus setzte, weil sich so ein Verhalten einfach „nicht gehört“. Sein großer Genuß an der Situation wird auch durch den Superlativ im zweiten Zitat gezeigt. Obwohl dieses Verhalten aus einer völlig anderen Situation resultiert, hat es viel Ähnlichkeit mit Richards Glückserleben. Denn auch der Taugenichts vergisst jede Vorsicht und Rücksicht auf gesellschaftliche Normen, so wie auch Richard seine Vorsicht und Angst plötzlich vergisst. Außerdem genießen beide ihre Freude und ihr Wohlbefinden mit Hilfe von Tabak, was ihre positiven Gefühle noch verstärkt. Auch anhand dieser Textstelle lässt sich zeigen, das der Taugenichts ebenfalls großen Stolz in Verbindung mit seinem Glück empfindet. Denn er wünscht sich, das „auch einmal ein paar Leute aus [seinem] Dorfe“(Z. 14f) vorbeikommen würden, denn er würde ihnen gerne zeigen, wie weit er es jetzt gebracht hat und will seine Freude mit ihnen teilen. Dieses Zitat zeigt sehr gut seinen Stolz und auch die vollkommene Befriedigung seiner Bedürfnisse. Er geht sogar so weit aufgrund seines kleinen Luxus von einem „vornehmeren Leben“(Z.20) zu sprechen. Diese Aussage beweist, wie schnell der Taugenichts zufrieden zu stellen ist und das er die allgemeinen Glücksgüter, wie Erfolg, Reichtum, Macht und Selbstverwirklichung, in seinem kleinen und naiven Glück schon als erreicht ansieht. Für ihn bedeutet schon der Erfolg die Einnehmerstelle bekommen zu haben, der Reichtum in den eben erwähnten Kleidungsstücken und die Macht über die Wegezölle Selbstverwirklichung und die Befriedigung seiner Bedürfnisse. Nachdem er die nützlichen Pflanzen aus seinem Garten entfernt hat, charakterisiert der Portier ihn direkt als jemanden, „den sein plötzliches Glück verrückt gemacht [hat]“(Z. 33f). Dieses Zitat belegt wiederum, wie glücklich der Taugenichts in der momentanen Situation ist und wie intensiv er seine Gefühle lebt und zeigt. Dabei wird erneut gezeigt, das er auf die Reaktion der Gesellschaft weiterhin keine Rücksicht nimmt, sondern seine Gefühle ungezwungen auslebt, was auf ein starkes Selbstbewußtsein schließen lässt.
Zusammenfassend ist daher auch in bezug auf den Taugenichts festzuhalten, das auch er seine Gefühle auf seine ganz persönliche Art und Weise intensiv lebt und auch er sich dabei hauptsächlich in einem Zustand innerer Harmonie und Zufriedenheit befindet. Als Hauptunterschied zu Richards Gefahrensituation ist jedoch wichtig, das der Taugenichts sein Handeln und damit auch sein Glück nicht eigenständig bestimmte, sondern das „die gnädige Herrschaft“ ihm die Einnehmerstelle „zugedachte“(S.15, Z.27ff).
Nachdem Richard und Etienne schon eine Weile am Strand leben und sich in die Gemeinschaft eingefunden haben, unterhalten sie sich über das Strandleben (S.143), wobei einige Gemeinsamkeiten mit den Ansichten des Taugenichts deutlich werden. Zunächst weiß Richard nicht genau, wie er seine Gedanken in Worte fassen soll und zögert. Doch dann beginnt er mit folgender Aufzählung: „Man fischt, man schwimmt, man ißt, man faulenzt, und alle sind so nett...“(Z.4f). Er drückt aus, wie glücklich er auf der Insel ist, denn alle seine Bedürfnisse sind befriedigt und es fehlt ihm nichts zur Zufriedenheit mit seinem Leben. Er sieht viele Wünsche und Sehnsüchte als erfüllt an und empfindet daher innere Ausgeglichenheit, Harmonie und pures Wohlbefinden. Diese Aspekte werden mit Hilfe des vierfachen Parallelismus gezeigt. Darauf verallgemeinert er sein persönliches Glückserleben in einer hinzugefügten Ellipse und macht den Strand zum Ziel jeglichen individuellen Handelns (Z.4-7). Seiner Meinung nach kann man auf dieser Insel vielleicht sogar die Sinnerfüllung des Lebens finden und deswegen erhebt er sie auch zum Ziel des individuellen Handelns. Jedoch erfolgt diese Verallgemeinerung nur als Zusatz und auch in seiner vorherigen Aussage klingt nur eingeschränkte Begeisterung an. Dies wird vor allem durch die Parenthese „- ich glaube, (...)“(Z.6) deutlich. Diese Ergänzung relativiert seine Aussage und weist darauf hin, das er nicht vollkommen davon überzeugt ist. Daher lassen sich auch keine intensiven Gefühlsregungen in seinem Verhalten oder in seiner Sprache wiederfinden.
Diese Interpretationen stehen in Gegensatz zum Verhalten des Taugenichts, der aufgrund kleinster, positiver Ereignisse die absolute Zufriedenheit mit seinem Leben empfindet. Richard hingegen ist damit nicht vollkommen zufrieden zustellen und setzt sich immer höher werdende Ziele für sein individuelles Handeln um das höchste Gut und damit das absolute Glück zu erreichen.
Die naive Zufriedenheit des Taugenichts und Richards Bodenständigkeit lässt sich auch in ihren Gefühlen für Aurelie und Francoise belegen. In der Geschichte des Taugenichts gestaltet sich das Problem mit der Liebe gar nicht als wirkliches Problem, sondern er findet, wie immer, die passive Erfüllung seiner Hoffnungen und Wünsche. Im sechsten Kapitel hat er gerade seiner Sehnsucht nach der Heimat und nach Aurelie in einem Lied Ausdruck verliehen, als er plötzlich einen Brief von ihr erhält. Und obwohl sich am Ende der Novelle herausstellt, das dieser Brief gar nicht für ihn bestimmt war (S.100, Z.21-24), empfindet er natürlich in diesem Moment große Freude von seiner Angebeteten Nachricht zu bekommen. Diese große Freude und seine Aufregung wird an folgender Textstelle sehr gut deutlich: „Aber da wurde ich auch auf einmal im ganzen Gesicht so rot, wie eine Päonie, und das Herz schlug mir so heftig, daß es die Alte merkte, (...)“(S.57, Z.10ff). Dieses Zitat zeigt sehr gut seine körperliche Reaktion, die auf starke innere Gefühle schließen lässt. Daher werden seine große Liebe und seine starke Sehnsucht nach Aurelie dem Leser verdeutlicht, wofür auch sein Kosename für Aurelie, „meine schöne Frau“, ein Beweis ist. Dieser Ausdruck ist als Leitmotiv in der gesamten Novelle zu finden und impliziert jedes Mal aufs neue die starken Gefühle des Taugenichts. Sein darauf folgendes Glückserleben ist wiederum durch eine körperliche Reaktion zu charakterisieren, denn „die Augen gingen [ihm] über (...) vor Entzücken und Schreck und unsäglicher Freude“(Z.20f). Diese physische Reaktion zeigt, das er die Kontrolle über seinen Körper verliert und seine Gefühle und damit sein Glück sehr intensiv sein muß. Auch der folgende Trikolon verweist auf diese starken, positiven Gefühle und wird durch das Adjektiv „unsäglich“ noch verstärkt. Es impliziert die Unfähigkeit des Taugenichts seine Gefühle in Worte zu fassen und verweist daher auf die Intensität dieser Gefühle. Diese Intensität findet sich auch in dem Verhalten des Taugenichts wieder, das ausschließlich durch dynamische Verben beschrieben wird. Zunächst „[ fliegt er] wie ein Pfeil bis in den allereinsamsten Winkel des Gartens“, wirft sich ins Gras und nachdem er den Brief noch mehrmals gelesen hat, springt er auf und ruft sein Glück laut hinaus. Der Vergleich betont seine Dynamik noch und der Neologismus „allereinsamsten“ zeigt, das er seine Freude zunächst mit keinem teilen will. Doch dieses Bedürfnis hält nicht lange an, denn schon bald teilt er seine große Freude der Umwelt mit: „nun ist’s ja klar, sie liebt mich ja, sie liebt mich!“(Z.34f). In diesem Zitat wird deutlich, das er seine Sinnerfüllung des Lebens durch diese Schlußfolgerung als gefunden ansieht und auch seine absolute Zufriedenheit erreicht hat. Nun hat er endlich die lange gewünschte Gewißheit erlangt und kann in Gelassenheit und innerer Ruhe und Harmonie seine Reise fortsetzen. Diese Gewißheit wird mit Hilfe der Repetition und dem Ausruf verdeutlicht. Damit weiß er, das er das Ziel seines individuellen Handelns, die Liebe zu Aurelie, jederzeit erreichen kann und kann sich daher bei der Fortsetzung seiner Reise weiterhin von seinem Schicksal lenken lassen.
Im Gegensatz dazu stellt sich Richards Bedürfnis nach Liebe in einer weniger optimistischen Weise dar. In der folgenden Textstelle wird deutlich, wie groß Richards Bedürfnis nach Liebe ist und wie sehr er sich nach körperlicher und auch geistiger Zuneigung sehnt. Dies wird sehr deutlich gezeigt, wenn Richard Francoise pflegt, nachdem sie von vergiftetem Tintenfisch gegessen hat. Sie ist sehr erschöpft und bevor sie einschläft, sieht sie ihren Freund, Etienne, an und sagt ihm, das sie ihn liebt. Doch Richard „[blinzelt] und [denkt] für einen Sekundenbruchteil, sie könnte [ihn] gemeint haben“(S.276, Z.14f). Diese Reaktion hat ihre Wurzeln wahrscheinlich in seinem Unbewußten, wo er ein verstecktes Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung hat. Doch zu seinem sonstigen Charakter passt dieses Bedürfnis nicht und deswegen kann er es auch nur für einen „Sekundenbruchteil“ zulassen. Doch in diesem kleinen Moment erfüllt sich ein geheimer Wunsch und eine heimliche Hoffnung in ihm und so gönnt er sich einen kurzen Moment des Glücks. Und obwohl er schnell wieder realistisch wird und weiß, das dieser Satz nicht an ihn gerichtet war, lässt er seinen Gefühlen doch noch ein wenig Raum sich auszuleben. Er bleibt gedanklich einen Moment länger in dieser irrealen Welt, lässt seine Gefühle des Wohlbefindens, der Freude und der Zufriedenheit zu und beschreibt sie als „schönes Gefühl“, also als Glück. Dazu „lächelt“ er, was ein weiteres Zeichen für seine Zufriedenheit ist. Richard verstärkt auch den körperlichen Kontakt um einen weiteren seiner Wünsche zu erfüllen, indem er ihr übers Haar streichelt (Z.19f), zulässt, das ihre Hand sich um seine schließt (Z.20f) und ihre Schultern mit seinen gekreuzten Beinen stützt (Z.23). Diese Situation strahlt eine Atmosphäre der Harmonie und Vertrautheit aus, die Richard große Freude und eventuell auch körperliche Lust bereitet. Außerdem wird deutlich, das Richard diese Erfahrung sehr genießt, denn er hält still um Francoise nicht zu wecken und die schöne Situation so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Jedoch ist sein Glück noch nicht vollkommen und seine Zufriedenheit noch nicht komplett erfüllt, denn er würde Francoise gerne küssen um seiner Zuneigung für sie Ausdruck zu verleihen. Doch dieses letzte Bedürfnis stellt einen Konflikt mit seinem Gewissen dar und deswegen versucht er sein Verlangen zu rationalisieren und zu dämpfen um spätere Schuldgefühle zu vermeiden. Richard geht daher geradezu strategisch vor um sein vollkommenes Glück zu erreichen und erinnert sich zunächst an den Kuss, den Francoise ihm gegeben hat, als er krank war. Er versucht den „gleichen zärtlichen Geist“(Z.33) zu treffen, den ihr Kuss damals hatte und rationalisiert ihn zu einem „geradlinigen Kuß auf die Wange“ (Z.34) um ja nicht zuviel von seinen starken Gefühlen für sie zuzulassen. Doch genau in diesem Moment muß er seine strategische Stellung aufgeben, weil seine Gefühle ihn dann doch überwältigen. Die Beschreibung seiner Gefühle sind in einer Klimax angeordnet, denn als erstes bemerkt er, „wie weich und glatt ihre Haut“ ist und setzt diese Erfahrung in einen Kontrast mit der „höllischen Nacht“, in der sie sich befinden, und die von „Kotzen und Stöhnen“ gekennzeichnet ist (S.277, Z.4f) ist. Die metaphorische Beschreibung für die Nacht zeigt, wie nötig Richard diesen kleinen Moment des Glücks hat und warum er sich gerade jetzt gehen lässt. Deswegen ist es auch nur verständlich, das er den Kuss „zwei Sekunden zu lange dauern“(Z.2f) lässt um den schrecklichen Umständen seiner Umgebung noch einen Moment länger zu entrinnen. Der metaphorische Ausdruck „kleine Oase“ belegt, wie intensiv Richard diesen Kuss erlebt und wie bedeutend er für ihn ist. Er sieht ihn als eine Art existentiell wichtige Rettung in einer schrecklichen Situation, aus der es ansonsten keinen Ausweg mehr gibt. Aus diesem sehr positiven Ereignis kann er wieder neue Kraft schöpfen, die er für die Bewältigung der schrecklichen Situation bitter nötig hat. Außerdem hat der Kuss nicht nur Auswirkungen auf seine körperlichen Bedürfnisse, die Gelegenheit zur Befriedigung finden, sondern auch auf seine Psyche: „Ich gab meine Deckung auf und schloß die Augen für einen Moment“(Z.8f). Richard vergleicht sein Verhalten häufig selbst mit militärischen Zuständen, wie z.B. mit Aspekten des Vietnamkrieges. Dies ist nun einer der wenigen Augenblicke auf seiner Reise, wo er auch seine positiven Gefühle uneingeschränkt zulässt. Natürlich nur für einen kurzen Moment, aber in diesem Moment empfindet er große Freude wahrscheinlich verbunden mit körperlicher Lust, absolutes Wohlbefinden, vollkommene Befriedigung seiner geistigen und körperlichen Bedürfnisse und Zufriedenheit mit seinem Leben. Aufgrund dieser Zusammenfassung lässt sich schlußfolgern, das diese Textstelle die zentrale Stelle in Richards Glückserlebens ist, weil er nur an dieser Stelle so viel von seinen positiven Gefühlen zulässt. Zusammenfassend ist daher wichtig, das Richard seine originären Bedürfnisse nach Zuneigung und Geborgenheit häufig verdrängt und ihnen nur sehr selten in seiner Handlung folgt. Deswegen ist er für libidinös (=lustvoll) besetzte Erfahrungen auch weniger empfänglich als es der Taugenichts mit seiner naiven und offenen Art ist. Diese charakterlichen Eigenschaften der beiden Protagonisten sind für das Verständnis der Gesamtwerke und besonders für die Bearbeitung dieses Themas entscheidend.
Auch die Enden der beiden Werke sind ein deutliches Indiz für die vollkommen verschiedenen Charaktereigenschaften der Protagonisten. Das Ende von Garlands Roman zeigt ein völlig anderes Glückserleben von Richard auf, das auch im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Textstellen steht. Schon zu Beginn des Romans wird deutlich, das Richard sich als Ziele seines individuellen Handelns auch sehr seltsame Erwartungen gesetzt hat. Denn er wünscht sich z.B. einmal „in eine Straßenschlacht zu geraten“, „im Zorn abgefeuerte Gewehrschüsse [zu] hören“ und „dem Tod ins Auge zu sehen“(S.171, Z.5-10). Diese Hoffnungen zu erfüllen ist ihm sehr wichtig und am Ende seiner Reise kommt ihm sein Schicksal dabei zur Hilfe. Die asiatischen Wächter auf der Insel haben eine Gruppe von Neuankömmlingen abgefangen und bei ihnen eine, von Richard gezeichnete, Karte gefunden. Das von Richard gezeigte Verhalten nach dem Eintreffen der bewaffneten Wächter und in den folgenden Momenten zeigt seine ambivalenten Charakterzüge und belegt die Relativität von individuellem Glückserleben. Während seine Freunde vom Erscheinen der Wächter zunächst sehr geschockt sind, findet Richard sogleich den ersten Vergleich mit Vietnam und beobachtet die Reaktion der anderen interessiert. Diese Beobachtungen scheinen ihm sichtliche Zufriedenheit zu bereiten und er stellt sogar schon die ersten Bewertungen an (S.428f). Im nächsten Moment ist ihm bewusst, das er und seine Freunde sterben müssen, doch er nimmt es mit bemerkenswerter Gelassenheit wahr. Denn schließlich gehörte der Tod oder wenigstens der Kontakt mit ihm auf seine „Wunschliste“ für ein erfülltes und sinnvolles Leben. Doch dann erfüllen sich seine Hoffnungen plötzlich schneller als er es vorausgesehen hat. Denn er wäre gerne in den „Genuß“ gekommen auch andere sterben zu sehen, was ihm weitere Erfüllung seiner Hoffnungen und damit Freude und Zufriedenheit bereitet hätte. Doch dann wird er von dem Boß der Wächter mehrmals geschlagen und in seiner Todesangst wird er immer dreister und will sein Glück vor seinem Tod möglichst perfekt machen. Zunächst bittet er darum, das die Wächter doch zunächst jemand anders erschießen sollten und dann will er sich den Vollstrecker selbst wählen. Dazu wählt er sich den „Kickboxer“, den er schon früher aus der Ferne beobachtet und dessen Stärke er bewundert hat. Seine Hinrichtung durch diesen kräftigen Asiaten vollstreckt zu wissen, befriedigt wieder einen Teil seiner Bedürfnisse und bereitet ihm daher wieder in gewisser Weise neue Zufriedenheit und Freude. Dann holt der Boß die bereits erwähnte Karte hervor und einen Moment später erfüllt sich auch Richards Wunsch nach „im Zorn abgefeuerten Gewehrschüssen“ wenigstens teilweise. Denn der Boß bekommt „einen hysterischen Wutanfall“ und als er gerade beginnt sich wieder zu beruhigen, schießt er auf Richards Karte. Doch diesen Erfolg kann Richard nicht wirklich genießen, denn im nächsten Moment sieht er tatsächlich fast „den Tod vor Augen“, denn er wird ohnmächtig (S.432, Z.12). Und obwohl er sich dieses Erlebnis als einen wünschenswerten Augenblick gewünscht hat, kann er nun verständlicherweise kein wirkliches Glück erleben. Als Begründung für diese gedämpfte Freude bringt er an, das die Wächter ja gar nicht wirklich vorhatten ihn zu töten und ihn nur als „Punchingball“ benutzt hätten. Doch dann erlebt er noch starke Freude und empfindet sichtliches Wohlbefinden als die Strandbewohner beginnen die toten Körper der Floßfahrer zu zerlegen (S.436, Z.19-26). Dieses Erlebnis jagt ihm sogar so viel „Adrenalin in die Blutbahn“, das er physisch wieder in der Lage wäre sogar einen „Marathonlauf“ zu machen. Dieses Nomen ist natürlich nur metaphorisch gemeint, aber es soll daher um so stärker zeigen, das diese innerliche Freude auch seine physischen Fähigkeiten wieder belebt. Diese Reaktion auf solch eine brutale Szene steht zwar in klarem Gegensatz zum allgemeinen Glückserleben, das auf positive Ereignisse begründet ist, Richards Gefühle lassen aber trotzdem auf glückliche Empfindungen schließen. Diese krankhaften Charakterzüge werden auch in folgender Metapher deutlich: „Mit jedem abgetrennten Glied schienen neue Wurzeln mich an den Boden zu binden.“(S.436, Z.25f). Einerseits betont dieser Satz die Brutalität der Szene, und verweist aber auch andererseits auf Richards seltsame Ansichten. Sie zeigt wie fasziniert Richard von dieser Brutalität ist und wie krankhaft sein Glückserleben in diesem Moment ist, da er in so einem Moment eine tiefe Verbindung zu dem Ort des Geschehens verspürt. Er zeigt daher eine große Begeisterung und Freude auch für direkt erlebte, brutale Szenen, die er vorher nur aus dem Fernsehen kannte. Damit hat sich wieder ein Ziel seines individuellen Handelns erfüllt, denn er ist zwar nicht in eine „Straßenschlacht geraten“, konnte aber ein noch brutaleres Ereignis miterleben. Sein krankhaftes Glück gipfelt dann in dem Schlußereignis des Strandlebens, indem er dem Tod tatsächlich noch direkter ins Auge schaut. Nachdem ein Teil der Strandbewohner sich auf ihn gestürzt ist und ihn übel zugerichtet hat, erscheint Mr. Duck ihm zum letzten Mal und er sagt zu ihm: „Gott, was für’ne eklige Art zu sterben. Aber zumindest ist es ein Ende.“(S.439, Z.14f). Dieses Zitat zeigt, das er sich nun sicher ist, das er wirklich sterben muß und es keinen Ausweg mehr gibt. Durch diese Konfrontation mit dem Tod müßte er jetzt eigentlich die vollkommene Befriedigung seiner Bedürfnisse verspüren, aber zu solchen Gefühlen kommt es nicht mehr, denn seine Freunde, Jed, Keaty, Étienne und Francoise, kommen ihm zur Hilfe (S.439f).
Diese Ereignisse stehen in engem Zusammenhang mit den letzten Sätzen des Romans: „Mir geht’s prima. Ich habe böse Träume, aber Mr. Duck habe ich nicht wiedergesehen. (...) Gefällt mir, wie das klingt. Ich trage’ne Menge Narben mit mir rum.“(S.446, Z.27, 31f). In diesen letzten Sätzen drückt Richard als Ich-Erzähler aus, das er glücklich ist und seine Hoffnungen und Wünsche sich erfüllt haben. Nun fühlt er eine innere Harmonie, die nur durch seine bösen Träume gestört wird. Diese Träume lassen schlußfolgern, das er sein absolutes Glück nicht gefunden hat und er auch nicht vollkommen zufrieden und fröhlich sein kann. Denn selbst wenn er es nicht direkt zugeben will und es verdrängt, besonders die letzten Ereignisse belasten ihn noch und drängen nachts noch in sein Bewußtsein zurück. Trotzdem ist er stolz auf das Erlebte und besonders die Erinnerung an die brutalen Ereignisse und an die bewältigten Gefahren bereitet ihm große Freude. Doch vollkommen glücklich können ihn auch diese Narben nicht machen, denn weitere Hinweise auf wirklich glückliche Gefühle lassen sich am Ende des Romans nicht finden. Richard schließt seine Reise daher nur in eingeschränkter Zufriedenheit und nicht in dem absoluten Glück ab.
Der Taugenichts dagegen erlebt am Ende der Reise die absolute Zufriedenheit und damit das absolute Glück. Als er zum Schloß seiner „schönen Frau“ zurückkommt, sieht er als erstes alle seine alten Freunde und Wegbegleiter wieder. Und als sich dann noch die große „Konfusion der Herzen auflöst“(S.100) und er sich mit Aurelie ausspricht ist sein Glück schon fast perfekt. Jetzt schon ist es ihm „noch wie ein Traum“(S.102, Z.5), denn seine große Sehnsucht nach Aurelie ist gestillt. Doch dann kommt sein Schicksal ihm noch einmal sehr intensiv zur Hilfe. Denn von nun an muß er sich um nichts mehr sorgen, denn Aurelies Onkel hat ihnen ein „weißes Schlößchen“ mit Garten und Weinbergen geschenkt und die Hochzeit ist auch schon vorbereitet. Als absoluter Höhepunkt seines Glücks klärt Aurelie ihn dann auf, das sie gar keine Gräfin ist und nun braucht er sich auch um Standesunterschiede keine Sorgen mehr zu machen. Ähnlich wie zu dem Zeitpunkt, als er die Stelle des Einnehmers bekommt, ist auch dieses Mal seine Freude über seine neue Kleidung sehr groß: „,O‘ rief ich voller Freuden, ,englischen Frack, Strohhut und Pumphosen und Sporen!‘“(S.103, Z.24f). Dieses Zitat zeigt erneut, wie er in seiner Freude aufgeht und wie intensiv er sich selbst über so kleine Reichtümer wie Kleidungsstücke freuen kann. Die Interjektion und die adverbiale Ergänzung betonen seine große Freude noch stärker und die darauf folgende Aufzählung zeigt, wie sehr er sich auf die neue Kleidung, aber auch auf das Leben mit Aurelie, freut. Für den Taugenichts ist daher die vollkommene Befriedigung seiner Bedürfnisse, die Sinnerfüllung seines Lebens und die absolute Zufriedenheit eingetreten. Er hat auch allgemeine Glücksgüter, wie Reichtum, Macht und vor allem die Liebe erreicht und kann von nun an ein vollkommen glückliches und erfülltes Leben führen. Diese absolute Harmonie wird auch im letzten Satz der Novelle deutlich: „- und es war alles, alles gut!“ Dieser letzte Satz hebt noch einmal den bewußt naiven Ton der Novelle hervor und nur durch diese stark naive Färbung konnte so ein absolut harmonisches Ende entstehen. Nur so konnte der Taugenichts sein absolutes Glück finden und die Erfüllung all seiner Sehnsüchte in solch einer Totalität erleben. Damit hat der Taugenichts ohne viel eignes Zutun die Sinnerfüllung seines Lebens erlebt und genießt das höchste Gut der Menschheit: Glück.
Abschließend ist daher festzuhalten, das die Abschlüsse der beiden Reisen in starkem Gegensatz zueinander stehen. In Eichendorffs Novelle bewahrheitet sich der Traum der Menschen nach dem perfekten Glück und in Garlands Roman wird die Thematik des Glücks eher kritisch und in weniger großer Euphorie aufgefasst. Während man den Taugenichts als wirklichen Glückspilz bezeichnen kann, bleiben Richards Gefühle häufig eher versteckt und seine Wünsche nehmen dazu noch teilweise krankhafte Züge an. Trotzdem lassen sich Gemeinsamkeiten in dem individuellen Glückserleben der Protagonisten finden, was wahrscheinlich vor allem in der gemeinsamen Altersgruppe zu begründen ist.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die allgemeine Definition von Glück laut dem Text?
Glück wird als eine komplexe Erfahrung der Freude angesichts der Erfüllung von Hoffnungen, Wünschen, Erwartungen und des Eintretens positiver Ereignisse beschrieben. Es beinhaltet das Eins-Sein des Menschen mit sich und dem von ihm Erlebten. Glück umfasst sowohl günstige Fügung der Geschehnisse und des Schicksals als auch den Zustand des Wohlbefindens und der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben.
Was ist das Thema des Referats?
Das Thema des Referats ist ein Vergleich des Erlebens von Glück der Protagonisten in den Werken „Aus dem Leben eines Taugenichts“ von Joseph von Eichendorff und „Der Strand“ von Alex Garland.
Inwiefern unterscheidet sich das Glückserleben des Taugenichts von dem von Richard?
Der Taugenichts erlebt sein Glück oft durch Zufälle und eine naive Hingabe an das Schicksal, während Richard sein Glück aktiver sucht und existenzielle Gefahren bewältigen muss. Der Taugenichts kann sich an kleinen Dingen erfreuen, während Richard oft höhere Ziele verfolgt, um Glück zu empfinden. Richards Glück ist oft mit Anstrengung und Überwindung verbunden, während das Glück des Taugenichts eher passiv und unbeschwert ist.
Wie äußert sich Richards Glückserleben im Zusammenhang mit dem Wasserfall?
Um zu dem Traumstrand zu gelangen, muss Richard einen ca. 10- 12 Meter hohen Wasserfall hinunterspringen. Diese Tat überwindet er mit grossem Mut nachdem er zuvor von einem Gefühl der Lustlosigkeit durchflutet wurde. Er ist anschließend sehr stolz auf seine Leistung und empfindet große Freude und damit auch großes Glück.
Wie äußert sich das Glück des Taugenichts beim Einzug in das Haus des Einnehmers?
Der Taugenichts findet im Haus des Einnehmers einen prächtigen roten Schlafrock, grüne Pantoffeln, eine Schlafmütze und Pfeifen vor. Diese simplen Dinge bereiten ihm Gefühle großen Glücks, da sie die Erfüllung seiner Wünsche und Hoffnungen darstellen. Er genießt diese Situation in vollen Zügen und bricht dabei sogar mit gesellschaftlichen Normen.
Wie bewertet Richard das Strandleben im Vergleich zum Taugenichts?
Richard schätzt das Strandleben, weil es seine grundlegenden Bedürfnisse befriedigt, aber er empfindet keine intensive Begeisterung wie der Taugenichts. Der Taugenichts findet bereits in kleinen, positiven Ereignissen die absolute Zufriedenheit, während Richard nach höher gesteckten Zielen strebt, um das absolute Glück zu erreichen.
Wie unterscheiden sich die Liebesbeziehungen der beiden Protagonisten?
Der Taugenichts erlebt seine Liebe zu Aurelie als eine passive Erfüllung seiner Sehnsüchte, während Richard sich nach Liebe und Zuneigung sehnt, diese aber oft verdrängt. Der Taugenichts erhält einen Brief von Aurelie, was zu einer intensiven körperlichen und emotionalen Reaktion führt. Richard hingegen erlebt einen flüchtigen Moment des Glücks, als Francoise ihn vermeintlich liebt, und genießt körperliche Nähe, versucht aber, seine Gefühle zu rationalisieren.
Wie unterscheiden sich die Enden der beiden Werke in Bezug auf das Glückserleben der Protagonisten?
Am Ende der Geschichte erlebt der Taugenichts das absolute Glück und die vollkommene Befriedigung seiner Bedürfnisse, indem er mit Aurelie zusammenkommt und ein sorgenfreies Leben beginnt. Richard hingegen erlebt am Ende des Romans ein Glück, das eher kritisch und ambivalent ist. Er konfrontiert sich mit Gewalt und Tod, was ihn zwar befriedigt, aber nicht zu vollkommener Zufriedenheit führt.
Welche Rolle spielt der Tod im Glückserleben von Richard am Ende von „Der Strand“?
Richard hat sich zu Beginn des Romans gewünscht "dem Tod ins Auge zu sehen". Am Ende der Reise scheint ihm sein Schicksal dabei zur Hilfe zu kommen, doch er nimmt es mit bemerkenswerter Gelassenheit wahr. Er will sein Glück vor seinem Tod möglichst perfekt machen, aber als er ohnmächtig wird, kann er nun verständlicherweise kein wirkliches Glück erleben.
Gibt es Gemeinsamkeiten im Glückserleben der Protagonisten?
Trotz der Unterschiede lassen sich Gemeinsamkeiten im individuellen Glückserleben der Protagonisten finden, was wahrscheinlich vor allem in der gemeinsamen Altersgruppe zu begründen ist.
- Arbeit zitieren
- Kerstin Pietsch (Autor:in), 2000, Das Erleben von Glück. Ein Vergleich der Werke "Aus dem Leben eines Taugenichts" und "Der Strand", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96847