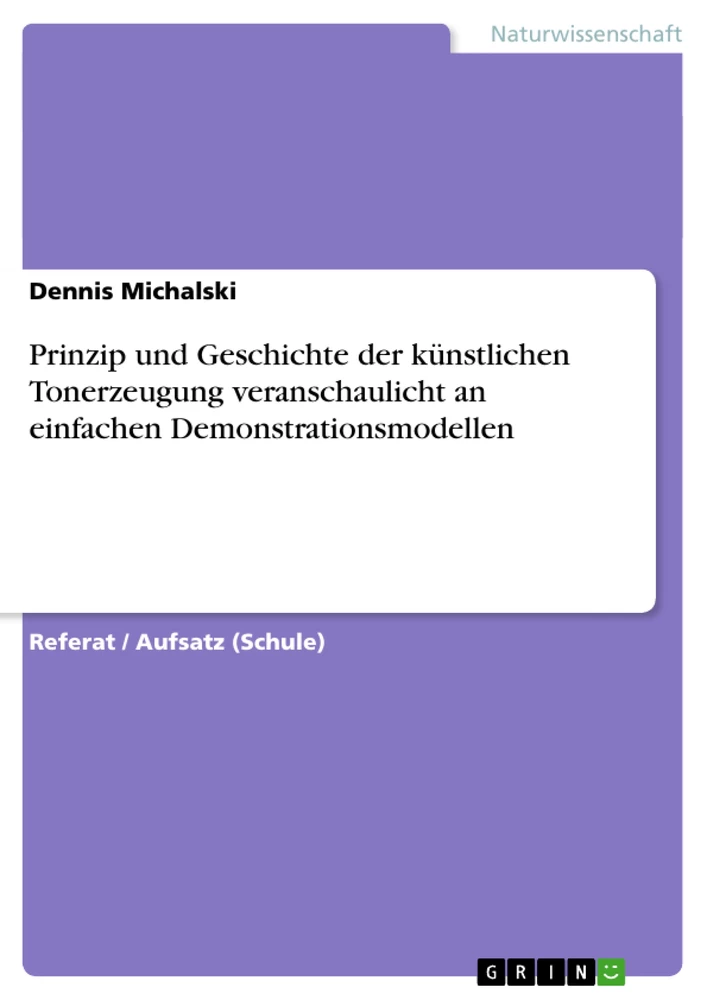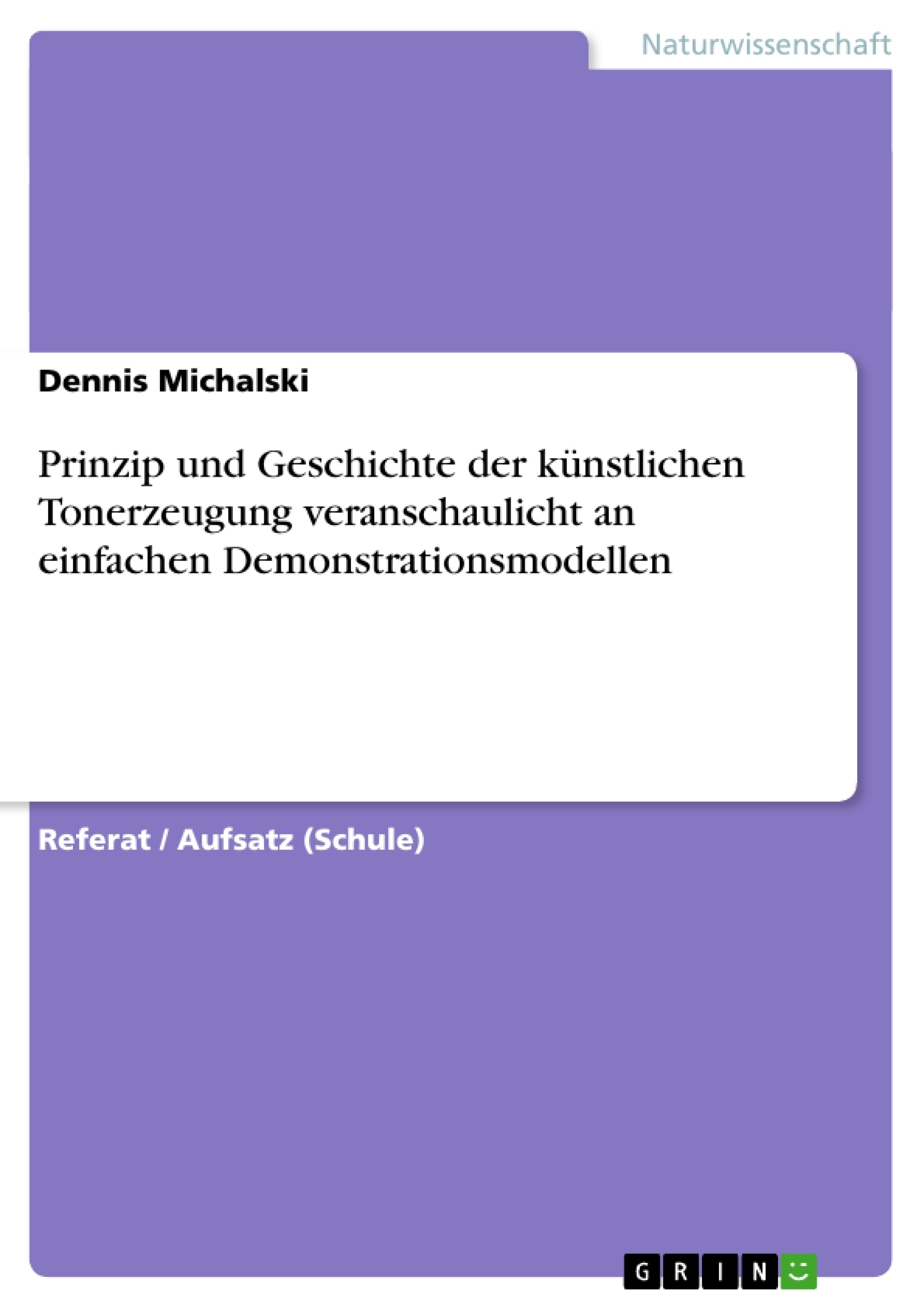INHALT
1. Vorwort
2. Kurze Einführung in die geschichtliche Entwicklung
3. Physikalische Grundlagen
4. Einfache Schallwandler - praktische Versuche erläutert
4.1 Der Lautsprecher
4.2 Das Reissche Telefon
5. Technische Anwendungen
5.1 Nadeltonverfahren
5.2 Magnettonverfahren
6. Klangsynthese
7. Literaturverzeichnis
1. Vorwort
Wenn man es genau nimmt, gibt es künstlich erzeugte Töne fast schon seit dem es Töne gibt. Ob man primitive Kulturen, die sich mit Hilfe von Trommeln über lange Distanzen verständigten, oder erste Instrumente betrachtet, deren erste Darstellung bereits 25.000 Jahre zurückliegt, es ist überall das selbe. Mit Hilfe von mehr oder weniger technischen Hilfsmitteln wird versucht, einzelne Töne oder Klangfolgen zu erzeugen.
Bei den Vorüberlegungen zum Inhalt meiner Facharbeit war für mich von Anfang an klar, daß ich besondere Schwerpunkte setzen müßte. Schließlich entschloß ich mich, diese auf die Anfänge der elektrischen Tonerzeugung zu legen, da hier sicherlich die meisten für den Unterricht sinnvollen Erkenntnisse gewonnen werden könn- ten. Elektrische Tonerzeugung bedeutet für mich, Tonerzeugung bei der die Kenntnis über elektrischen Strom eine Rolle spielt.
Im folgenden gebe ich eine gestraffte Übersicht angefangen bei ersten experimentellen Versuchen der Tonübertragung, welche logischerweise eng verknüpft mit der Tonerzeugung ist, bis hin zur modernen Klansynthese.
2. Kurze Einführung in die geschichtliche Entwicklung
Das 19. Jahrhundert war eines der wichtigsten Epochen auf dem Gebiet der Physik. Es wurden Erkenntnisse gewonnen die selbst heute noch Gültigkeit haben. Zum ersten Mal wurden vorher als gegeben akzeptierte Naturgesetze hinterfragt und Erklärungsansätze entwickelt. Mit dem Ausgehen des Jahrhunderts waren diese Grundlagen gegeben und immer mehr Denker machten sich Gedanken, wie man dieses Wissen anwenden könne.
Eine Problemstellung mit der man sich beschäftigte war die Übertragung und Speicherung des Schalls um Kommunikation über große Reichweiten zu ermöglichen. Einer der ersten, denen dieses in der Praxis gelang, war der deutsche Physiker Philipp Reiss. Er ent- wickelte ein Gerät, mit dem es möglich war Schall in elektromagneti- sche Wellen und zurück zu verwandeln. Dieses Gerät diente dem Amerikaner Graham Bell für sein 1872 patentiertes „Telephon“ als Vorlage, dessen Funktionsprinzip auch in den heutigen Telefonen noch Anwendung findet. Immer mehr Gelehrte griffen das von Reiss erdachte Modell auf und entwickelten eigene Erfindungen. Fünf Jah- re später war es Thomas A. Edison gelungen mit Hilfe seines „Pho- nographen“ Sprache auf einer Walze zu speichern. Das Nadeltonver- fahren war geboren. Seine Technik, einen Stichel, der eine Rille in eine Metallfolie schnitt, durch den aufzuzeichnenden Schall auszu- lenken, wurde ebenfalls von anderen weiterentwickelt. Der Deutsche Emil Berliner erhielt 1887 ein Patent auf die Erfindung des Grammo- phons und der Schallplatte. Parallel zu dieser Entwicklung entstand ein weiteres Aufzeichnungs- beziehungsweise Wiedergabesystem: Das Magnettonverfahren. Nach Oberlin Smith, der Töne auf einem metallspänehaltigen Wollfaden speicherte, präsentierte der Däne Valdemar Poulsen auf der Weltausstellung 1890 mit seinem Te- legraphon eine Sensation. Ihm diente eine circa 1mm starker Stahl- draht als Tonträger.
Im Jahre 1926 kam dann eine weitere entscheidende Entwick- lung auf den Markt. Die Elektronenröhre. Mit ihr wurde die mechani- sche Aufzeichnung, wie sie beim Grammophon angewendet wurde immer mehr verdrängt und elektromagnetische Verfahren wurden zum Standard. Es war nun möglich immer größere Hörbereiche zu erfassen und lästiges Rauschen konnte immer mehr unterdrückt werden. 1927 präsentierte AEG das „Magnetophon K1“. Bei diesem Gerät kamen zum ersten Mal beschichtete Kunststoffbänder zum Einsatz. Das Nadeltonverfahren verlor aber nicht an Bedeutung.
Nachdem man anstatt von Schellack Vinyl als Trägermaterial benutz- te wurde auch hier eine enorm gesteigerte Aufzeichnungsqualität erreicht.
Nach enormen Entwicklungssprüngen im Laufe unseres Jahr- hunderts kamen dann in den späten 70ern und frühen 80ern wieder neue Entwicklungen hinzu. Philips entwickelte die Compact Disc welches den Aufbruch in das Digitalzeitalter bedeutete. Kassette und Langspielplatte wurden fast komplett verdrängt und haben heute nur noch Nischencharakter. Parallel zu diesen Entwicklungen wurden aber auch Methoden entwickelt, Töne direkt künstlich zu erzeugen, zu „synthetisieren“. Diese Entwicklungen und das dahinterstehende Prinzip werden aber extra im Abschnitt „Klangsynthese“ behandelt.
3. Physikalische Grundlagen
Die Entstehung von Tönen ist sehr eng verknüpft mit dem Wis- sen über elektrischen Strom. Als elektrischer Strom wird im allge- meinen die Bewegung negativ geladener Teilchen, der Elektronen, durch einen Leiter bezeichnet. Im folgenden wird vorausgesetzt, daß grundlegende Kenntnisse über magnetische und Wärmewirkung und generelle Ge- setzmäßigkeiten des elektrischen Stromes vorhan- den sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Kurve einer Sinusschwingung
Von beson- derer Bedeutung für die Toner- zeugung ist die Wechselspan- nung. Normaler- weise geht man bei elektrischem Strom von Elektronenfluß von ei- nem Pol einer Spannungsquelle zum anderen aus. Werden die Be- dingungen nicht verändert verläuft dieser Fluß konstant, also immer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2: Klangspektrum in Hertz
die gleiche Menge an Elektronen wandert in einer bestimmten Zeit von einem Pol zum anderen. Diesen Zustand bezeichnet man als Gleichstrom. Beim Wechselstrom ist dies anders. Anstatt einer kon- stanten Polung ändert sich die Flußrichtung in einer bestimmten Fre- quenz. Das hat zur Folge das die Elektronen nicht mehr gleichmäßig voranfließen, sondern hin- und herpendeln. Sie beginnen zu schwin- gen. Abbildung 1 zeigt diesen Vorgang sehr anschaulich. Man kann erkennen, daß die abgebildete Kurve einer Sinuskurve sehr ähnelt. Als Amplitude bezeichnet man den jeweils positiven und negativen Ausschlag der Kurve in y-Richtung. Eine Periode ist die Zeit, welche die Kurve für einen negativen und einen positiven Ausschlag braucht. Die Anzahl der Perioden pro Sekunde ist die Frequenz. Sie wird in Hertz1 angegeben. Die Tatsache dieser Schwingung führt uns zum Schall. Schall ist nämlich nichts anderes als schwingende Luftmole- küle. Im Bereich der hörbaren Töne haben sie eine Frequenz zwi- schen etwa 16 Hz und 15 kHz (also 16 bis 15000 Schwingungen pro Sekunde). Abbildung 2 zeigt, in welchen Bereichen die jeweils ange- gebenen Musikinstrumente Schwingungen erzeugen können. Das Prinzip der künstlichen Tonerzeugung liegt darin, elektrische Schwingungen in akustische Schwingungen, also Schall, umzuwan- deln. Dies geschieht mit Hilfe von sogenannten Schallwandlern, de- ren Funktionsweise im nächsten Kapitel ausführlich erklärt werden.
4. Einfache Schallwandler - praktische Versuche erläutert
4.1 Der Lautsprecher
Der erste Versuch, welcher hier erläutert werden soll ist die Konstruktion eines primitiven Lautsprechers, an dem sehr einfach verdeutlicht werden kann, daß die Umwandlung von Wechselspan- nung in Schallschwingungen funktioniert. Hierfür benötigen wir einen Elektromagneten, also eine Spule mit Eisenkern, den wir an eine Wechselspannungsquelle anschließen (circa 5 bis 10 Volt). Nach den oben erläuterten Grundlagen ändern sich nun Richtung und Stärke des generierten Magnetfeldes im Takt der angelegten Wech- selspannung (vgl. Abb.1). Nun halten wir ein dünnes Eisenblech- stück, beispielsweise einen Konservendosendeckel, circa einen Mil- limeter vor eines der schmalen Enden des Metallkerns. Das Blech wird vom Magneten angezogen und ein Brummton entsteht. Diese Anziehung beruht auf der magnetischen Einflußwirkung auf das Blech. Verglichen mit der Sinuskurve kann man sagen, daß jedesmal wenn die Kurve einen Ausschlag in positiver oder negativer Richtung hat, das Blech angezogen wird. Eine Luftschwingung entsteht. Da das Blech magnetisch neutral ist, ist es egal ob ein positives oder ein negatives Feld generiert wird. Dies hat den unerwünschten Nebenef- fekt, daß das Blech während einer Periode des Spannungsfeldes zwei Perioden absolviert, also mit der doppelten Frequenz schwingt. Wir wollen aber die selbe Frequenz erhalten, da ja sonst Töne immer doppelt so hoch erklin- gen als eigentlich ge- dacht. Dieses Problem läßt sich aber mit einem kleinen Umbau des Versuchs umgehen. Man ersetzt den Eisen- kern einfach durch ei- nen Permanentmagneten. Nun wird die Membran, dies ist der Fach- begriff für das was das Blech eigentlich repräsentiert, ständig ein wenig angezogen. Wenn die Spule nun ein wechselndes Magnetfeld erzeugt, so wird sich dieses zum Feld des Permanentmagneten ad- dieren (bei gleicher Polarität) oder von ihm subtrahieren (bei unter- schiedlicher Polarität). Infolgedessen wird das Feld des Permanent- magneten im Takt der Wechselspannung während einer Halbwelle der Sinuskurve geschwächt, während der anderen verstärkt, und die Membran schwingt mit der Frequenz der Wechselspannung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3: Versuchsaufbau Lautsprecher
4.2 Das Reissche Telefon
Wie bereits in der geschichtlichen Übersicht erwähnt, war Philip Reis der erste, der einen funktionstüchtigen Schallwandler kon- struierte. Sein Gerät basierte auf dem oben vorgestellten Lautspre- cher. Er verband einfach zwei dieser Wandler über eine Leitung. Ein Hörer diente als Empfänger, der Andere als Sender. Das dieses Ver- fahren funktionierte war durchaus erstaunlich, da ja sowohl Sender als auch Empfänger gleich aufgebaut waren. Um dies zu erklären muß man nur näher betrachten, was bei der Durchführung des Ver- suches passiert. Spricht man gegen die Membran des Senders wird dieser durch die Schallwellen in Schwingungen versetzt. Durch die Schwingungen verändert sich der Abstand zwischen Membran und Permanentmagnet. Hier- durch wirkt sich die Membran auf die Stärke des Magnetfeldes aus. Nach den Regeln der magneti- schen Induktionswirkung wirkt diese Schwächung auch auf die Spu- le. Es wird eine Wechselspannung induziert, deren Frequenz und Kurvenform genau der Schallschwingung entspricht. Schauen wir den vorherigen Versuch an, sehen wir, daß diese Wechselspannung wieder in Schall umgewandelt werden kann - was bedeutet, daß die Töne genauso wie auf der einen Seite hineingesprochen auf der an- deren Seite, am Empfänger wieder herauskommen. Theoretisch je- denfalls. Reiss gelang es zwar das Signal zu übertragen, doch das Signal kam so geschwächt auf der anderen Seite hinaus, daß man schon in den Sender hineinschreien mußte um irgend etwas hören zu können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.4: Versuchsaufbau Reissches Telefon
Beim Nachbau dieses Versuches konkretisierte sich zuerst ein kleines Problem. Die vorher verwendete Membran war nicht empfind- lich um durch so leichte Schwingungen wie Sprache beeinflußt zu werden. Also mußte zuerst eine empfindlichere Membran gebaut werden. Ich realisierte dies, indem ich in ein circa 20cm² großes Hartpappestück ein kreisrundes Loch einschnitt und dieses mit Plas- tikfolie beklebte. Um eine Influenzwirkung hervorzurufen mußte noch ein drei mal acht Zentimeter großes Metallplättchen mittig auf der Membran plaziert werden. Beim ersten Versuch passierte dann aber gar nichts. Wahrscheinlich war die magnetische Feldstärke des Per- manentmagneten, die auf das Metallplätchen an der Membran wirk- te, zu stark. Dies hatte zur Folge, daß der Schall keinen Einfluß auf die Membran hatte. Als Folge tauschte ich die Permanentmagneten gegen schwach magnetisierte U-Eisen. Tatsächlich ließ sich nun auf Empfängerseite eine Bewegung der Membran feststellen. Doch das Ergebnis war nicht sehr befriedigend. Man muß aber bedenken, daß die induzierten Wechselspannungen im Millivolt-Bereich liegen und somit Dinge wie äußere Einflüsse oder Leitungswiderstände enorme Auswirkungen haben. Leider konnte ich mit den mir zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln keinerlei verbesserte Versuchsaufbauten tes- ten, somit kann ich nur noch abschließend ein paar Verbesserungs- vorschläge einbringen. Die erste Möglichkeit wäre, in den Stromkreis einen Niederfrequenzverstärker einzubinden. Wie der Name schon sagt, könnte man mit diesem Gerät entstehende Schwingungen ver- stärkt weiterleiten. Ein zweites wäre die Optimierung der Membra- nen. Andere Materialien größerer Membrandurchmesser und ähnli- ches spielen sicherlich eine Rolle. Man könnte die selbstgebauten Membranen auch einfach durch handelsübliche Kopfhörer ersetzten, da diese ja nach dem selben Prinzip funktionieren.
5. Technische Anwendungen
Erste praktischen Anwendungen wie das Reissche Telefon wa- ren Anfang des 20. Jahrhunderts die Vorlage für weitere Entwicklun- gen auf dem Gebiet der Tontechnik. Ein Ziel war es, Töne aufzu- zeichnen und danach wieder abspielen zu können. Heutzutage gibt es Compact Discs, Digital-Audio-Tapes(DAT’S) oder gar Personal Computer die als Aufnahmestudio fungieren können. Damals stand diese Entwicklung noch ganz am Anfang und somit war es eine klei- ne Sensation als Anfang der 20er Jahre das Grammophon, ein Ge- rät, welches nach dem Nadeltonverfahren funktionierte, auf den Markt kam. Im folgenden Kapitel soll neben diesem auch noch das etwas später entwickelte Magnettonverfahren erläutert werden.
5.1 Nadeltonverfahren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.5: Schneiden einer
Die Grundkomponenten dieses Aufnahme-, beziehungsweise Wiedergabesystems sind eine rotieren- de Scheibe (Schallplatte) und ein Schneidstichel (Aufnahme) oder Tonab- nehmer (Wiedergabe). Bei der Auf- zeichnung werden die Schallschwin- gungen von einem Mikrofon in elektri- sche Schwingungen umgewandelt. Die- se beeinflussen einen Stichel, der auf der sich mit gleichbleibender Geschwin- Platte in Seitenschrift digkeit drehenden Schallplatte plaziert ist. Dieser schwingt dann genauso wie die auf- genommene Schallwelle parallel zu seiner Achse und überträgt diese somit als Rille auf die Schallplatte. Dieses Verfahren bezeichnet man als Seitenschrift. Unterschiedlich zu die- sem Verfahren wird bei der Tiefenschrift der Schneidstichel in Richtung seiner Achse, also auf und ab bewegt. Diese ist relevant für die Aufnahme eines Stereosignals. Hier kommt eine Kombination aus Seiten- und Tiefenschrift zum Einsatz, da Schallplattenspieler nur einen Tonabnehmer haben. Dieser Tonabnehmer liegt dann beim Abspielen der Platte in der Rille. Er wandelt die eingeritzten Wellenbewegungen nach dem bekannten Prinzip wieder in Strom- schwingungen, die dann schließlich wieder über einen Lautsprecher zu Schall werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.6: Stereotonab- nehmer
5.2 Magnettonverfahren
Das Magnetband, der Informationsträger beim Magnettonverfahren ist eine aus Kunststoff (zum Beispiel Polyester) bestehende Folie auf der eine Schicht aus magnetisierbaren Teilchen aufgebracht wurde. Im Tongerät gleiten aneeinem Elektromagneten vorbei. Legt man eine Wechselspannung an den Magnetkopf, so ändert sich abwechselnd die Richtung der Elementarmagnete. Es las- sen sich also Informationen spei- chern. In der Regel hat man mit einen Magnettongerät drei Ope- rationsmöglichkeiten: Löschen, Aufnehmen und Wiedergeben.
Das Löschen eines Bandes erreicht man, indem man es an einem Dauermagneten vorbeilau- fen läßt. Hierdurch werden die Elementarmagnete wieder gleichmäßig magnetisiert und das Band ist wieder bespielbar. In modernen Bandgeräten wird der selbe Effekt durch einen extra Löschkopf, der ein hochfrequentes Wechselfeld induziert, hervorgerufen. Dieses Verfahren soll aufgrund seiner Komplexität hier aber nicht weiter erläutert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.7: Aufbau Ton- bandgerät
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.8: Prinzip des Magnettonver- fahrens
Aufnahme und Wiedergabe folgen wieder dem bekannten Prin- zip der Spannungserzeugung als Folge der magnetischen Induktion.
6. Klangsynthese
In den Köpfen der Komponisten hatte sich bereits im ausgehenden 19.Jahrhundert die Vision festgesetzt, Musik zu schaffen, die komplett durch elektronische Mittel erzeugt wird. Es fanden sich Menschen zusammen, allen voran Luigi Russolo, die sich mit den neuen technischen Möglichkeiten befaßten. Sie wurden als Futuristen bekannt. Eine ihrer Methoden war, Ge- räusche der Natur aufzuneh- men und in ihre Kompositionen mit einzubinden. In den späten vierziger Jahren entwickelte der Physiker und Direktor des Insti- tuts für Phonetik an der Universität Bonn, Werner Meyer-Eppler, den Vocoder, ein Analysegerät, mit dem die menschliche Stimme synthetisch erzeugt werden konnte. Die wahrscheinlich wichtigste Errungenschaft war der unter der Leitung von Robert Moog für den britischen Hersteller EMS konstruierte Synthesizer2.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9: Moog-Synthesizer
Als Synthesizer bezeichnet man im allgemeinen Schaltungen zur Tonerzeugung, bei denen die gewünschte Frequenz nicht direkt erzeugt, sondern durch Mischung, Vervielfachung oder Teilung von Frequenzen gewonnen wird. Man unterscheidet hierbei zwischen direkten und indirekten Syntheseverfahren. Bei der Direktsynthese werden mit Hilfe zweier Quarzoszillatoren, die als Sinusschwin- gungsgeneratoren dienen, eine Ausgangsfrequenz per Summen- oder Differenzbildung der Oszillatorfrequenzen, erzeugt. Bei der indi- rekten Synthese wird ein spannungsgesteuerter Oszillator (d.h. ver- schiedene Frequenzen bei verschiedenen Spannungen) und ein Quarzoszillator (Referenzoszillator) verwendet. Vereinfacht gesagt wird die Referenzfrequenz des Quarzoszillators mit Hilfe eines Fre- quenzteilers moduliert. Diese modulierte Schwingung beeinflußt den spannungsabhängigen Oszillator, welcher dann die gewünschte Fre- quenz ausgibt. Für nähere Ausführungen über dieses Thema sollte das Kapitel „Grundlagen der Übertragungstechnik“ im Buch „Fach- kunde Radio-, Fernseh- und Funkelektronik“ herangezogen werden.
7. Literaturverzeichnis
Brett, Bernhard. und Ingman, Nicholas.: Die Geschichte der Musik. Hamburg: Tessloff Verlag (1.Aufl.), 1972.
Briner, Ermanno: Reclams Musikinstrumentenführer. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co. (1.Aufl.), 1988.
Carstens, Matthias: Musik - Elektronik für Studio und Bühne. Niedernhausen/Ts.: Falken-Verlag GmbH (1.Aufl.), 1995.
Dickreiter, Michael: Handbuch der Tonstudiotechnik Band 1 und 2. München: KG Saur Verlag KG (6.Aufl.), 1997.
Häberle, Heinz: Fachkunde Radio-, Fernseh- und Funkelektro- nik. Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co
Jakubaschk, Hagen: Radiotechnik und Elektronik leicht ver- ständlich. Hannover: Verlag Hans Heise GmbH & Co KG (1. Aufl.), 1989.
Wirsum, Siegfried: Praktische Beschallungstechnik: Gerätekonzepte, Installation, Optimierung. München: Franzis-Verlag GmbH (1.Aufl.), 1990.
Abbildungen
Abb. 1, 3, 4: Jakubaschk, Hagen: Radiotechnik und Elektronik leicht verständlich. Hannover: Verlag Hans Heise GmbH & Co KG (1. Aufl.), 1989, Seite 69, 91, 93.
Abb. 2: Wirsum, Siegfried: Praktische Beschallungstechnik: Gerätekonzepte, Installation, Optimierung. München: Franzis-Verlag GmbH (1.Aufl.), 1990, Seite 33.
Abb. 5, 6, 7, 8: Häberle, Heinz: Fachkunde Radio-, Fernseh- und Funkelektronik. Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co (3.Aufl.), 1996, Seite 588, 589, 604.
Abb. 9: Brett, Bernhard. und Ingman, Nicholas.: Die Geschichte der Musik. Hamburg: Tessloff Verlag (1.Aufl.), 1972, Seite 111.
[...]
1 Nach dt. Physiker Heinrich Hertz, *)Hamburg 22.2. 1857, †)Bonn 1.1. 1894
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Facharbeit über Tonerzeugung?
Diese Facharbeit behandelt die Anfänge der elektrischen Tonerzeugung und gibt eine Übersicht von ersten experimentellen Versuchen der Tonübertragung bis hin zur modernen Klangsynthese. Sie beinhaltet eine kurze Einführung in die geschichtliche Entwicklung, physikalische Grundlagen, die Erklärung einfacher Schallwandler und praktische Versuche, technische Anwendungen wie Nadel- und Magnettonverfahren, sowie eine Einführung in die Klangsynthese.
Welche geschichtliche Entwicklung der Tonerzeugung wird behandelt?
Die Arbeit geht auf das 19. Jahrhundert ein, eine wichtige Epoche für die Physik, und beschreibt die Entwicklung von der Übertragung und Speicherung von Schall, beginnend mit Philipp Reiss' Gerät, das als Vorlage für Bells Telefon diente, bis hin zu Edisons Phonographen und Berliners Grammofon. Es wird auch das Magnettonverfahren mit Valdemar Poulsens Telegraphon und die spätere Entwicklung der Elektronenröhre und des Magnetophons K1 behandelt, sowie die Einführung der Compact Disc.
Welche physikalischen Grundlagen der Tonerzeugung werden erläutert?
Die Arbeit erklärt die Grundlagen des elektrischen Stroms und der Wechselspannung, insbesondere die Bedeutung der Frequenz und Amplitude von Schwingungen. Sie beschreibt, wie elektrische Schwingungen in akustische Schwingungen (Schall) umgewandelt werden und geht auf das Prinzip von Schallwandlern ein.
Welche einfachen Schallwandler werden im Detail erklärt?
Es werden zwei einfache Schallwandler erklärt: ein primitiver Lautsprecher und das Reissche Telefon. Für den Lautsprecher wird der Aufbau mit einem Elektromagneten und einem Eisenblech beschrieben und die Funktionsweise erläutert. Das Reissche Telefon wird als früher Schallwandler vorgestellt, der auf ähnlichen Prinzipien basiert.
Welche praktischen Versuche werden im Zusammenhang mit Schallwandlern beschrieben?
Die Facharbeit beschreibt den Bau eines primitiven Lautsprechers, bei dem ein Elektromagnet verwendet wird, um ein Eisenblech zum Schwingen zu bringen. Weiterhin wird der Nachbau des Reisschen Telefons beschrieben, einschließlich der Herausforderungen und Verbesserungsvorschläge.
Welche technischen Anwendungen der Tonerzeugung werden behandelt?
Die Arbeit geht auf das Nadeltonverfahren (Grammophon, Schallplatte) und das Magnettonverfahren (Tonband) ein. Dabei werden die Funktionsweisen von Schneidstichel und Tonabnehmer beim Nadeltonverfahren sowie die Lösch-, Aufnahme- und Wiedergabeprozesse beim Magnettonverfahren erklärt.
Was wird unter Klangsynthese in diesem Kontext verstanden?
Klangsynthese wird als die künstliche Erzeugung von Tönen durch elektronische Mittel definiert. Die Arbeit erwähnt Pioniere wie Luigi Russolo und Werner Meyer-Eppler, sowie die Entwicklung des Moog-Synthesizers und unterscheidet zwischen direkten und indirekten Syntheseverfahren.
Welche Literatur wird in der Facharbeit zitiert?
Es wird eine Liste von Fachbüchern und Publikationen angegeben, die für die Erstellung der Arbeit verwendet wurden, darunter Werke zur Musikgeschichte, Musikinstrumentenkunde, Studio- und Bühnenelektronik, Radiotechnik und Beschallungstechnik.
- Quote paper
- Dennis Michalski (Author), 1998, Prinzip und Geschichte der künstlichen Tonerzeugung veranschaulicht an einfachen Demonstrationsmodellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96833