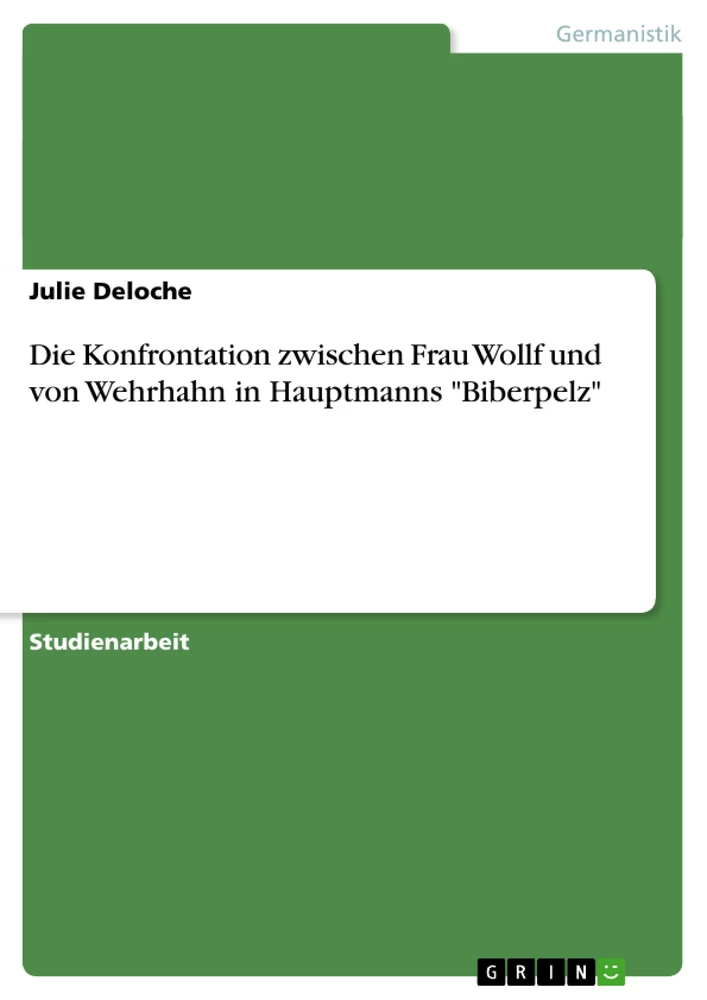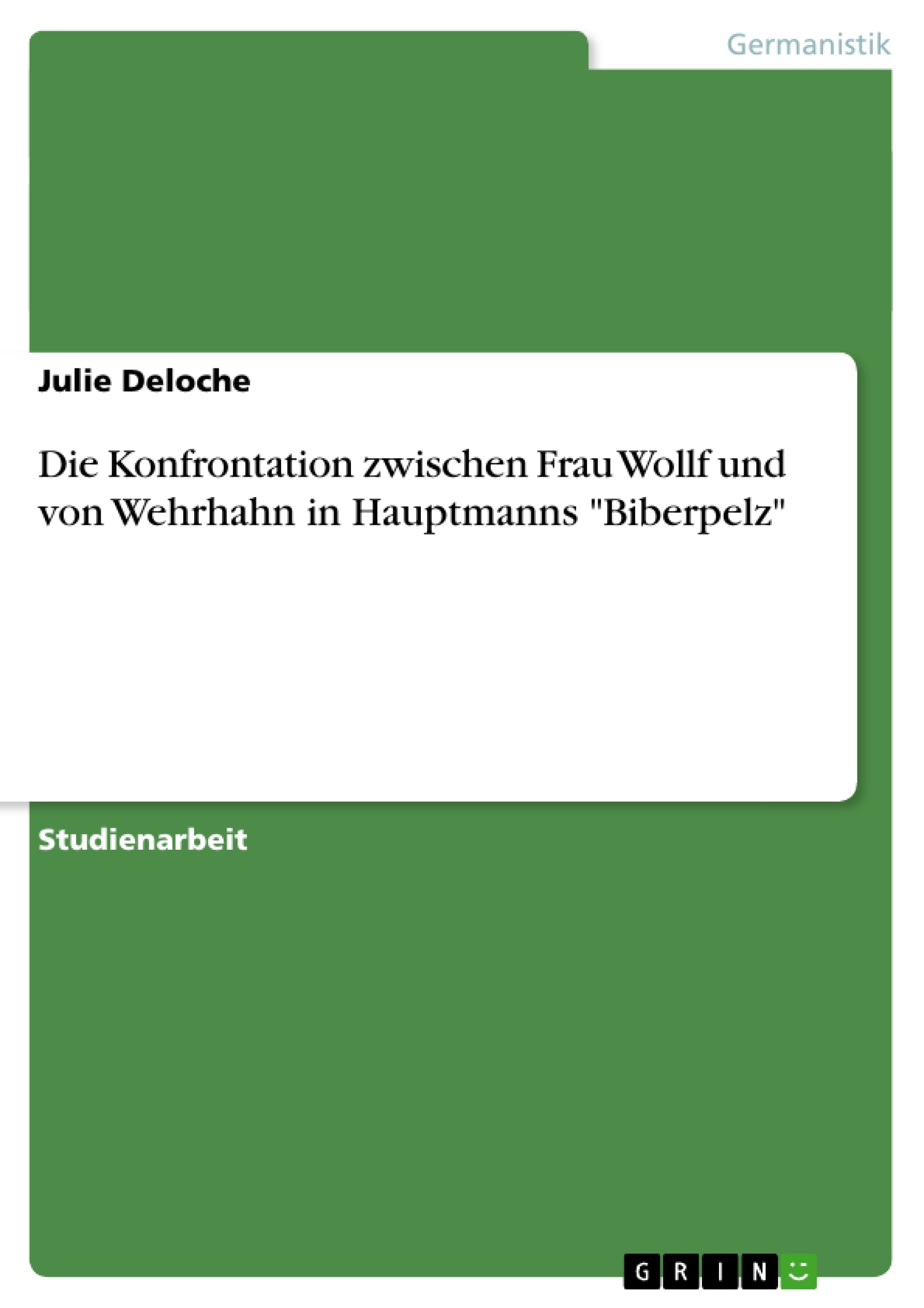In einer Zeit politischer Intrigen und sozialer Ungleichheit entfaltet sich eine urkomische Geschichte um Macht, List und die unerschütterliche Überlebenskunst einer bemerkenswerten Frau. Gerhart Hauptmanns "Der Biberpelz" ist weit mehr als nur eine Diebeskomödie; es ist ein scharfsinniges Sittengemälde des wilhelminischen Deutschlands, in dem der kleine Mann gegen die korrupte Obrigkeit aufbegehrt – wenn auch auf höchst unorthodoxe Weise. Im Zentrum steht Mutter Wolff, eine resolute Waschfrau mit einem ausgeprägten Sinn für Pragmatismus und einem noch ausgeprägteren Hang zur Aneignung fremden Eigentums. Ihr Gegenspieler ist der ebenso eifrige wie inkompetente Amtsvorsteher von Wehrhahn, ein Bürokrat par excellence, der in seiner bornierten Amtsgläubigkeit blind für die wahren Machenschaften in seinem Bezirk ist. Während Wehrhahn verbissen nach einem vermeintlichen Staatsfeind sucht, nutzt Frau Wolff geschickt die Gunst der Stunde, um sich und ihrer Familie ein besseres Leben zu sichern – Stück für Stück, Biberpelz für Biberpelz. Die Verwicklungen und Missverständnisse, die sich aus diesem Katz-und-Maus-Spiel ergeben, sind nicht nur von unbändiger Komik, sondern werfen auch ein Schlaglicht auf die sozialen Verhältnisse und die Doppelmoral der damaligen Zeit. Hauptmanns meisterhafte Charakterzeichnung, die pointierten Dialoge im Berliner Dialekt und die zeitlose Thematik machen "Der Biberpelz" zu einem Klassiker des deutschen Theaters, der auch heute noch zum Lachen und Nachdenken anregt. Tauchen Sie ein in eine Welt voller skurriler Figuren, verwickelter Intrigen und urkomischer Situationen, in der die Grenzen zwischen Recht und Unrecht, Arm und Reich auf ebenso unterhaltsame wie tiefgründige Weise verschwimmen. "Der Biberpelz" ist eine brillante Satire auf die Machtverhältnisse und die menschliche Natur, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Entdecken Sie die zeitlose Relevanz dieser Komödie und lassen Sie sich von Hauptmanns Sprachwitz und seinem Gespür für komische Situationen verzaubern. Eine Geschichte über Widerstand, Überlebenskunst und die unbezähmbare Kraft des Humors – ein Muss für alle Liebhaber des deutschen Theaters und eine erfrischende Lektüre für alle, die sich nach einer intelligenten und unterhaltsamen Komödie sehnen. Erleben Sie, wie Frau Wolff mit Witz und Raffinesse die Ordnungshüter an der Nase herumführt und dabei die Leser und Zuschauer in ihren Bann zieht. Ein Stück, das nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken über die Absurditäten des Lebens und die Unvollkommenheit der menschlichen Natur anregt – ein zeitloser Klassiker, der auch heute noch seine Aktualität besitzt und uns aufzeigt, dass die kleinen Leute oft die größten Überlebenskünstler sind.
Einleitung:
Hauptmanns Komödie "Der Biberpelz" gehört in den Umkreis der sozialen Dramen seiner ersten Schaffensperiode. Seine "Diebskomödie", die man mit einem der wenigen deutschen Lustspiele, mit Kleists "Zerbrochenem Krug" und wegen seiner satirischen Schärfe mit Gogols "Revisor" verglichen hat, beruht auf eigenen Erlebnissen des jungen Hauptmanns und ist wiederum ein Zeitstück, das in der Ära der Bismarckschen Sozialistenverfolgung mit ihrem Spitzel- und Denunziantenunwesen spielt1.
Das Drama lebt durch die Konfrontierung von zwei Charakteren: der Waschfrau Frau
Wolff und dem Amtvorsteher von Wehrhahn. Erstens werden wir uns mit der Zuordnung der Personen beschäftigen, zweitens mit der Komposition des Werks und drittens mit dem Sprachniveau, das die Personen benutzen.
1. Die Zuordnung der Personen:
In diesem Werk gibt es zwei alternierende Schauplätzen entsprechend zwei Personengruppierungen: die durch Familienbande und diebische Interessen verknüpfte Gruppe um Frau Wolff und den Kreis, der den Ermittler und Agenten der Obrigkeit, Wehrhahn, umgibt. Beide Parteien sind zahlenmäßig, gleich stark, umfassen jeweils fünf Personen, die Wolffen, ihren Mann, die beiden Töchter und Wulkow einerseits, Wehrhahn, Mitteldorf, Glasenapp, Motes und seiner Frau andererseits. Im Hinblick darauf sind die beiden Hauptgruppen auf ihren natürlichen Gegensatz angelegt, der allerdings aufgrund des Komödienrahmens nicht ausgetragen wird. Die vorgestellten Konflikte beschäftigen sich dagegen mit den Spannungen, die durch die Beziehungen der Hauptparteien zu den mittleren Gruppe (Krüger und Fleischer) sich herstellen: den Aktivitäten der Wolffen gegen Krüger also und den Ermittlungen Wehrhahns gegen Fleischer. Diese zugleich antithetische und symmetrische Anlage des Personals wird durch die Zuordnung der Personen unterbaut. Beide Gruppen scharen sich um eine herausragende Gestalt, werden dann sekundiert von jeweils zwei Figurenspaaren, den beiden Mädchen und den zwei Amtsdienern, wobei Leontine und Mitteldorf unwissentlich Helfersdienste leisten im Vergleich mit der aktiviren Rolle von Adelheid und Glasenapp. Es handelt sich hier um eine entfaltende Konfliktfähigkeit.
1.1 Von Wehrhahn:
Während Hauptmann die Zuordnung der Vorfälle verändert hat, erstellt er in den Figuren, und zwar besonders in den negativen, mit vielen Wesens- und Verhaltensmerkmalen abbildungsscharfe Konterfeis. Erfüllt von seiner Aufgabe, fühlt sich dieser Dorfbeamte als Verkörperung der Autorität. Er lebt in der ihm zugeteilten Rolle, betont zugleich, dass er eine
Rolle spielen will: (Wehrhahn)"Die Herren freilich, die mich ernannt haben, die wissen genau, mit wem sie's zu tun haben. Die kennen den ganzen Ernst meiner Auffassung"2.
Diesen "Ernst" als Gestus einer Marionette der Macht aufzudecken, ist Hauptmanns Absicht bei dieser Figur. Die Selbsteinschätzung seiner behördlichen Stellung ist religiös eingefärbt- (Wehrhahn)"Ich erfasse mein Amt als heiljen Beruf"3.Vor seinem ersten Auftritt wird in der Szenenanweisung zum II.Akt gesagt:"befleißigt sich militärischer Kürze im Ausdruck"4, im pathetischen Schlußmonolog des II.Aktes: "So aber heißt es: tapfer aushalten. Was ist denn schließlich, für was man kämpft? Die höchsten Güter der Nation!"5. Die Phrasenhaftigkeit dieser großen Worte und hohen Werte wird schon von den Personen erkannt, mit denen
Wehrhahn umgeht. Obwohl er ein Vertreter des Militarismus ist, spricht er mit einer "Fistelstimme"6. Das zeigt ein Widerspruch, man nimmt ihn nicht ernst.
1.2 Frau Wolff:
Anders als beim Amtvorsteher betrachtet Hauptmann hier stärker die Prägung des Modells durch die zusammenwirkenden Faktoren von Erbe, Milieu, Blut und Boden als konkrete Verhalten. Frau Wolff, wie ihr Name es zeigt, ist die Schelmin. Sie zeigt Wehrhahn als die Marionette der Macht, der sich damit über seine Lebensschwäche hinweglügt. Während die Wolffen mit dem Recht des Stärkeren auf den "eigenen Weg" konsequent den Erfolg sucht und Mitleid zweckdienlich vorgibt, verliert sich Wehrhahn in sentimentales Mitgefühl. Mit viel Sympathie wird die Waschfrau gezeichnet, obwohl sie die Diebin ist. Sie ist die Quelle der in diesem Stück hervorstechenden Kontrastkomik, läßt immer neu Mißverhältnisse inne von Schein und Sein, von eingebildeter und wirklicher Lage werden, was im Stück selbst definiert wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Die Komposition des Dramas:
Als wir die Komposition des Dramas analysieren, können wir ein symmetrisches Aufbau des "Biberpelz" bemerken.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zwischen den zwei Akten verändert sich das Schauplatz. Man kann auch ein Parallelität der Abläufe zwischen Küche und Amtsstube wahrnehmen: bei der Beschreibung des Ortes zum Beispiel:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der I.Akt wird durch eine typisch naturalistische Milieustudie eröffnet: Die Küche der Familie Wolff wird eingehend beschrieben, um die Mischung von Ärmlichkeit ("rohgezimmerte Tür", "alte Küchenbank") und Sauberkeit ("saubergedecktes Bett") herauszustellen. Ein "Stuhl aus weichem Holz" ist nicht wichtig als Regieanmerkung, sondern zielt ebenfalls auf die Milieuskizze, d.h. die Betonung der Armut. Der I.Akt ist dem Lebenskreis der Mutter Wolff gewidmet.
Auch die einleitende Regieanmerkung des II.Aktes ist eine Milieuskizze. Dem "kleinen, blaugetünchten, flachen, Küchenraum" der Wolffens kontrastiert hier ein "großer, weißgetünchter, kahler Raum". Wie im ersten Akt Frau Wolff über eine Nebenfigur eingeführt wird, so geschieht es auch hier bei Wehrhahn. Persönlich nahestehende Menschen -dort Leontine, hier Glasenapp- eröffnen die Möglichkeit, die Hauptfiguren in typischen Charaktereigenschaften darzustellen. Dabei ist es aufschlußreich, dass Frau Wolff sofort als Mutter in ihrer häuslichen Umgebung vorgestellt wird. Der II.Akt ist gegenläufig und zugleich parallel zum I.Akt: In jedem Akt herrscht eine Figur vor, die sie durch ihr Handeln und Reden profiliert, aber wenn wir am Ende des I.Aktes viel Sympathie für die energische Mutter empfinden, so hat sich Wehrhahn bis zum Ende des II.Aktes nur lächerlich gemacht. Diese konträre Wirkung ist gewollt, denn die beiden ersten Akte kontrastieren das Private und Familiäre dem Öffentlichen, die Frau dem Mann, die soziale Unterschicht der staatstragenden Oberschicht.
Der dritte Akt stellt sich auch dem vierten Akt gegenüber.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Parallelitäten laufen auf die Demonstration dessen hinaus, dass die Gerechtigkeit vom Amt wegen der pragmatischen Rechtsauffassung der Wolffen nahesteht.
3. Die Sprache:
Das Sprachniveau der Wolffen ist bei allem prinzipiellen Kontrast zur Hochsprache Wehrhahns angeglichen. Der Dialekt von Frau Wolff ist eine Mischung von Schlesischem und Berliner. Wehrhahn spricht das Hochdeutsche, aber er neigt aber zu Abschleifungen -/g/ nach /j/: "Holzjeschäfte"7, "Sie haben ja jehört, was Frau Wolff jesagt hat."8. Die Sprache von Frau Wolff ist die Sprache der Arbeiterfamilie -Prägung der Faktoren von Erbe und Milieu-, eine Sprache, die Ellipsen9 ("Da ruff mich ock, heerschte! Ich wer der an Schupps geben, daßte ooch ja und fliegst nich daneben"10, "Na, wenn se nu aber - und stehlen das Holz?"11 ) und Anakoluthe12 ("Hier in der Nähe am Hause, verstehste, da legste m'r keene Schlingen mehr."13 ) benutzt. Es zeigt also ein Kontrast zwischen der Unterschichtssprache und der herrschenden Sprache. Frau Wolff spricht mit Sprichwörter: "I, wer de ni will, der läßt's halt bleiben."14, "Wer halt nich wagt, der gewinnt ooch nich.", "Wer mich haut, sprech ich, den hau ich wieder-"15, "Paß du bloß uff dich uff und nich uff mich"16, "Was kommen soll, kommt"17. Sie benutzt auch Wörter, die fast Homonyme sind, aber sie haben eine andere Bedeutung: z. B."Konferenz"(S.6) statt Kompetenz, "Temperatur"(S.18) statt Temperament, "Eklipage"(S.18) statt Equipage.
Schluß.
Wenn Hauptmann die Akte nicht in Szenen untergliedert, so herrscht doch eine starke Binnenstrukturierung, die allerdings mit veränderten Mitteln erreicht wird, vor allem durch eine polare Struktur; Frau Wolff steht Wehrhahn gegenüber, wobei der Kontrast der Geschlechter und der sozialen Rollen wichtig ist. Jeweils zwei Akte werden den beiden Hauptpersonen zur Entfaltung ihrer Person eingeräumt.
Hauptmanns Komödie "Der Biberpelz" bezeichnet einen wichtigen Einschnitt in der Geschichte des naturalistischen Theaters. Der Autor bietet in dieser Diebskomödie schon den Mutterwitz, die Pfiffigkeit der Wolffen im Widerspruch zu voreingenommener Rechthaberei Wehrhahns. Dieses Stück hat einen offenen Schluß, denn "das wahre Drama ist seiner Natur nach endlos. Es ist ein fortdauernder innerer Kampf ohne Entscheidung"18 (Hauptmann).
Literaturverzeichnis
- Gert Oberembt, "Gerhart Hauptmann - Der Biberpelz, eine naturalistische Komödie", Schöning, 1987
- Helmut Scheuer, " Gerhart Hauptmann - Der Biberpelz, Grundlagen und Gedanken zum Verständnis des Dramas", Diesterweg, Frankfurt am Main, 1986
- Roy C. Cowen, "Der Naturalismus - Kommentar zu einer Epoche", Winkler, München, 1973
- Ursula Münchow, "Deutscher Naturalismus", Sammlung Akademie-Verlag, Berlin, 1968
- Bernhard Greiner, "Die Komödie", UTB 1665, Tübingen, 1992
- Hans Steffen, "Das deutsche Lustspiel II", Kleiner Vandenhoeck-Reihe, Göttingen, 1969
[...]
1 "Zeit: Septennatskampf gegen Ende der achtziger Jahre", S.2
2 IV.Akt, S.49, Z.13 bis Z.15
3 IV.Akt, S.49, Z.15
4 II.Akt, S.21
5 II.Akt, S.33, Z.34 bis Z.36
6 II.Akt, S.21
7 (Wehrhahn)II.Akt, S.32, Z.22
8 (Wehrhahn)II.Akt, S.30, Z.20
9 Unterlassung eines Wortes in einem Satz
10 I.Akt, S.4, Z.24, 25
11 I.Akt,S.8, Z.31
12 Brechung im Aufbau des Satzes
13 I.Akt, S.16, Z.38
14 I.Akt, S.10, Z.24
15 I.Akt, S.18, Z.19, 20
16 III.Akt, S.35, Z.16
17 III.Akt, S.38, Z.39
Häufig gestellte Fragen zu "Der Biberpelz"
Worum geht es in Hauptmanns Komödie "Der Biberpelz"?
Hauptmanns Komödie "Der Biberpelz" ist ein soziales Drama, eine "Diebskomödie", die in der Ära der Bismarckschen Sozialistenverfolgung spielt. Sie konfrontiert die Waschfrau Frau Wolff mit dem Amtvorsteher von Wehrhahn.
Welche Personengruppierungen gibt es in dem Werk?
Es gibt zwei Hauptpersonengruppierungen: die Familie Wolff (Frau Wolff, ihr Mann, die beiden Töchter und Wulkow) und den Kreis um Wehrhahn (Wehrhahn, Mitteldorf, Glasenapp, Motes und seine Frau). Diese Gruppen stehen in einem Gegensatz zueinander, der aber im Komödienrahmen nicht ausgetragen wird.
Wie wird Wehrhahn charakterisiert?
Wehrhahn wird als eine Figur dargestellt, die von ihrer Aufgabe erfüllt ist und sich als Verkörperung der Autorität sieht. Er betont, eine Rolle spielen zu wollen, und seine Selbsteinschätzung ist religiös eingefärbt. Seine Sprache ist phrasenhaft, und obwohl er ein Vertreter des Militarismus ist, spricht er mit einer "Fistelstimme", was ihn unglaubwürdig macht.
Wie wird Frau Wolff charakterisiert?
Frau Wolff wird als Schelmin dargestellt, die mit dem Recht des Stärkeren ihren eigenen Weg geht. Sie sucht konsequent den Erfolg und gibt Mitleid zweckdienlich vor. Im Gegensatz zu Wehrhahn, der sich in sentimentales Mitgefühl verliert, wird Frau Wolff mit viel Sympathie gezeichnet, obwohl sie die Diebin ist.
Wie ist das Drama aufgebaut?
Das Drama hat einen symmetrischen Aufbau. Es gibt Parallelen zwischen den Abläufen in der Küche der Wolffens und der Amtsstube Wehrhahns. Die Akte sind durch Milieustudien und kontrastierende Darstellungen der Hauptfiguren gekennzeichnet.
Wie ist das Sprachniveau der Figuren?
Das Sprachniveau der Wolffen ist ein Gemisch aus Schlesischem und Berliner Dialekt. Wehrhahn spricht Hochdeutsch, neigt aber zu Abschleifungen. Frau Wolff verwendet eine Sprache der Arbeiterfamilie, die Ellipsen und Anakoluthe enthält. Sie benutzt auch Sprichwörter und Wörter, die fast Homonyme sind, aber eine andere Bedeutung haben.
Welche Bedeutung hat das offene Ende des Stücks?
Das offene Ende des Stücks unterstreicht, dass das wahre Drama ein fortdauernder innerer Kampf ohne Entscheidung ist.
Welche Themen werden in der Analyse des Dramas behandelt?
Die Analyse behandelt die Zuordnung der Personen, die Komposition des Werks und das Sprachniveau, das die Personen benutzen.
Welche Aspekte des Naturalismus werden in Bezug auf "Der Biberpelz" diskutiert?
Die Analyse betrachtet "Der Biberpelz" als ein Beispiel für eine naturalistische Komödie, in der der Mutterwitz und die Pfiffigkeit der Wolffen im Widerspruch zu voreingenommener Rechthaberei Wehrhahns stehen.
- Quote paper
- Julie Deloche (Author), 2000, Die Konfrontation zwischen Frau Wollf und von Wehrhahn in Hauptmanns "Biberpelz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96791