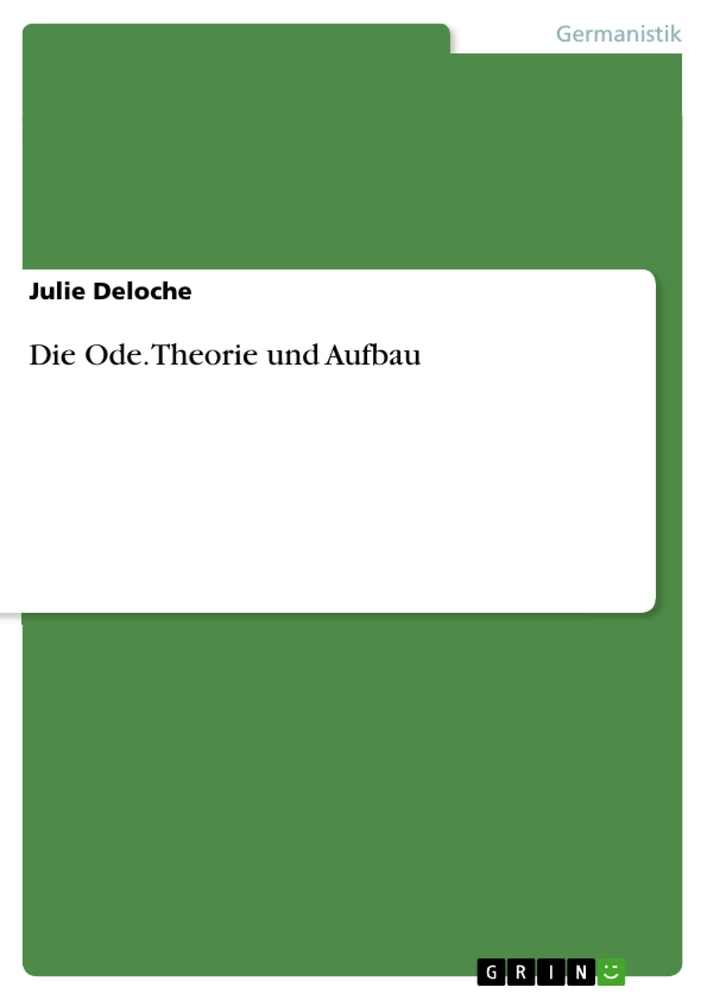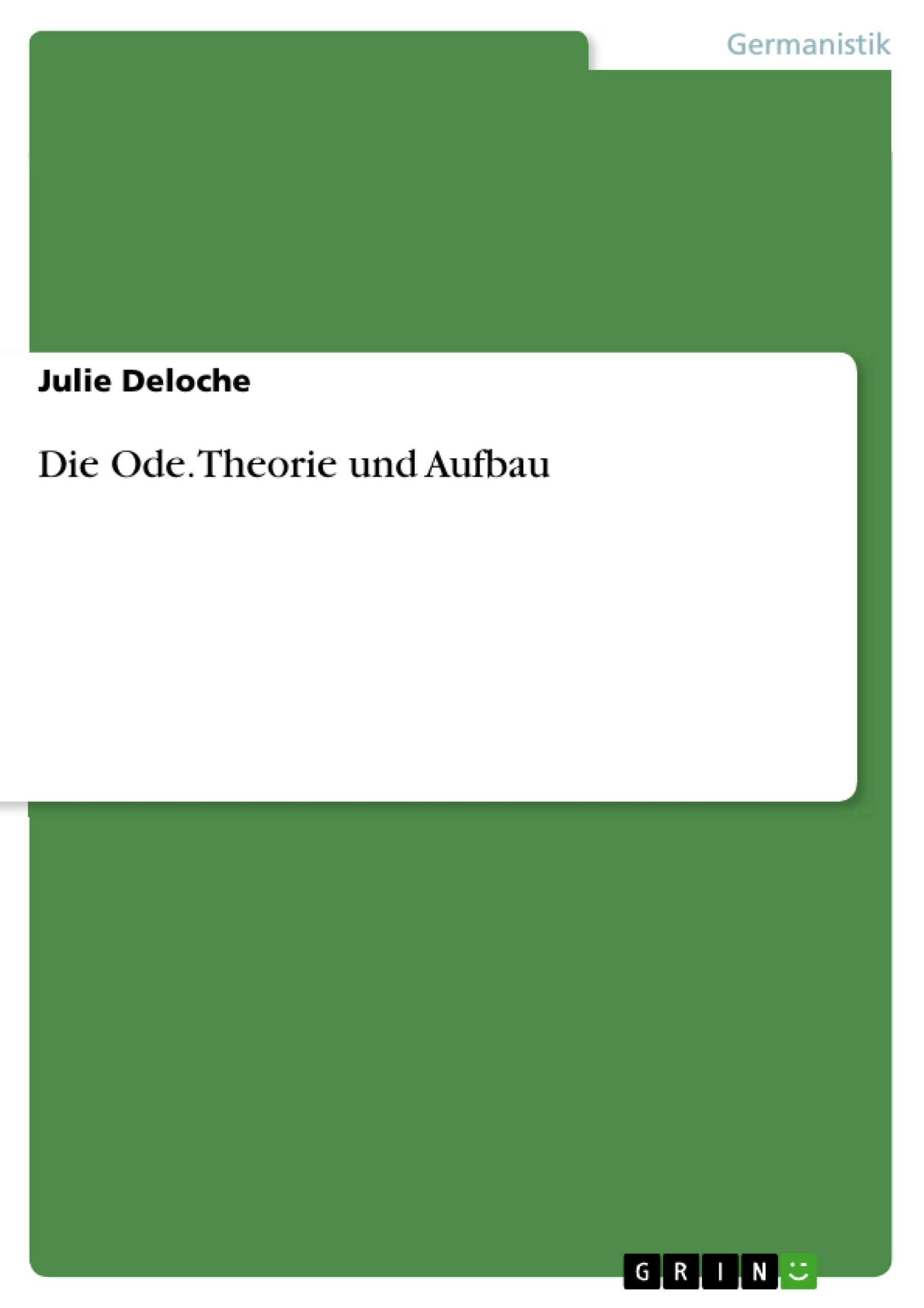Was macht ein Gedicht zu einer Ode? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Oden, einer Gedichtform, die seit der Antike Dichter inspiriert und Leser begeistert. Diese tiefgründige Untersuchung enthüllt die Geheimnisse der Ode, von ihren Ursprüngen als gesungenes Lied bis zu ihrer Entwicklung in den Händen von Meistern wie Pindar, Horaz, Klopstock und Hölderlin. Entdecken Sie die Vielfalt der Oden, von den erhabenen hymnischen und heroischen Formen bis zu den spielerischen anakreontischen Variationen. Erfahren Sie mehr über die Odentheorie der Aufklärung, die die Bedeutung von Gefühl, Lebhaftigkeit und einer "schönen Unordnung" betont. Analysiert werden die traditionellen, ungereimten Bauformen und die antiken Vers- und Strophenformen, wie die sapphische, alkäische und asklepiadeische Strophe, die von deutschsprachigen Lyrikern seit der Renaissance adaptiert und neu interpretiert wurden. Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die Geschichte und Theorie der Ode, sondern auch einen detaillierten Einblick in die metrischen und stilistischen Merkmale, die diese Gedichtform so einzigartig machen. Für Liebhaber der Lyrik, Studierende der Literaturwissenschaft und alle, die die Schönheit und Tiefe der deutschen Dichtung erkunden möchten, ist dies eine unverzichtbare Lektüre. Erschliessen Sie sich die Kunst der Ode und entdecken Sie, wie Dichter durch die Jahrhunderte hindurch ihre tiefsten Empfindungen und Gedanken in dieser zeitlosen Form zum Ausdruck gebracht haben. Lassen Sie sich von der Leidenschaft und dem Pathos der Ode mitreissen und erleben Sie die transformative Kraft der Poesie. Ein Schlüssel zum Verständnis der lyrischen Vielfalt und ein Muss für jeden, der sich für die deutsche Literaturgeschichte interessiert.
Einleitung:
Ode heißt im Grch. Lied. Ursprünglich war sie ein Gedicht, das zum Singen bestimmt war. Man unterscheidet zwischen der heroischen Ode, die als strophischer Chorgesang der grch. Tragödie in gehobenem, feierlichem Ton vorgetragen wurde, und der anakreontischen Ode, die in einem leichten und spielerischen Stil geschrieben ist, und deren Themen um die Liebe, den Wein, und die Anmut kreisen. Bed. Vertreter der eigenständigen Chorlyrik waren Pindar, Alkaios, Sapphos; in der röm. Dichtung: Horaz. In der Neuzeit wurde die Odendichtung v.a. in der Renaissance, im Barock und in der Romantik bevorzugt, in der dt. Literatur v.a. von M. Opitz, G.R. Weckherlin, P. Fleming, A. Gryphius, F.G. Klopstock, F. Hölderlin und A. von Platen.
Die Odentheorie der Aufklärung:
- Wichtige Punkte der Odentheorie ? die Ode muss rühren, ergreifen und erfüllen können.Horaz = Muster der rührenden Poesie sowohl wie der malerischen Schilderung. ? röm. Ode als Muster der Gattung.
- Das Ungeregelte ihres Strophenbaus und der leidenschaftliche Wechsel der Empfindung innerhalb eines Gedicht unterscheiden sie vom Lied.
- Singbarkeit wird ausdrücklich von der Ode gefordert.
- Lebhaftigkeit der Empfindung.
- Mehrere Typen von Oden:
- Hymnische Ode: göttliche Vollkommenheit
- Heroische Ode: heroische Taten (pindarische Ode ? kühne Metaphern, horazische Ode ? ausgeführte Gleichnisse )
- Philosophische ( o. moralische) Ode: Tugend
- „beau désordre“ = schöne Unordnung der Ode. Die erste Schönheit der Ode beruht auf ihrer Anordnung und Einrichtung, die sich leichter empfinden. ? Keine gewissen Regeln.
- In einer Ode wird dem Individuellen wenig Platz eingeräumt.
Der Bau der Ode:
- Oden sind traditionell ungereimt.
- Antike Vers- und Strophenformen: alternierende und nicht alternierende Versarten wurden als gemischte Metren in fest geregelten Strophenmodellen von altertümlichen Dichtern für ihre Ode erfunden und von deutschsprachigen Lyrikern seit der Renaissance, später insbesondere von Klopstock, übertragen, nachgeahmt und abgewandelt. Die bekanntesten antikisierenden Verse sind die der sapphischen, alkäischen und asklepiadeischen Strophe.
- Sapphische Strophe: die ersten drei Verse sind trochäische Fünftakter mit einem Daktylus in ihrer Mitte, der 4. und letzte Vers ist ein Adoneus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis:
- Karl Viëtor, „ Geschichte der deutschen Ode “, Darmstadt, 1961
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Ode laut dieser Einleitung?
Laut dieser Einleitung ist eine Ode im Griechischen ein Lied. Ursprünglich war es ein Gedicht, das zum Singen bestimmt war. Es wird zwischen der heroischen Ode, die als strophischer Chorgesang der griechischen Tragödie in gehobenem, feierlichem Ton vorgetragen wurde, und der anakreontischen Ode unterschieden, die in einem leichten und spielerischen Stil geschrieben ist und deren Themen um die Liebe, den Wein und die Anmut kreisen.
Wer waren bedeutende Vertreter der Chorlyrik und Odendichtung?
Bedeutende Vertreter der eigenständigen Chorlyrik waren Pindar, Alkaios und Sappho. In der römischen Dichtung war Horaz ein wichtiger Vertreter. In der Neuzeit wurde die Odendichtung vor allem in der Renaissance, im Barock und in der Romantik bevorzugt, in der deutschen Literatur vor allem von M. Opitz, G.R. Weckherlin, P. Fleming, A. Gryphius, F.G. Klopstock, F. Hölderlin und A. von Platen.
Welche Punkte der Odentheorie der Aufklärung werden genannt?
Wichtige Punkte der Odentheorie sind: Die Ode muss rühren, ergreifen und erfüllen können. Horaz gilt als Muster der rührenden Poesie sowie der malerischen Schilderung. Die römische Ode dient als Muster der Gattung. Das Ungeregelte ihres Strophenbaus und der leidenschaftliche Wechsel der Empfindung innerhalb eines Gedichts unterscheiden sie vom Lied. Singbarkeit wird ausdrücklich von der Ode gefordert. Lebhaftigkeit der Empfindung ist ein weiteres Merkmal.
Welche Typen von Oden werden erwähnt?
Es werden hymnische, heroische (pindarische und horazische) und philosophische (oder moralische) Oden erwähnt.
Was bedeutet "beau désordre" im Zusammenhang mit der Ode?
"Beau désordre" bedeutet "schöne Unordnung" und beschreibt, dass die erste Schönheit der Ode auf ihrer Anordnung und Einrichtung beruht, die sich leichter empfinden lässt. Es gibt keine gewissen Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen.
Wie ist der Bau der Ode traditionell?
Oden sind traditionell ungereimt. Es werden antike Vers- und Strophenformen verwendet, wobei alternierende und nicht alternierende Versarten als gemischte Metren in fest geregelten Strophenmodellen von altertümlichen Dichtern für ihre Ode erfunden wurden. Diese wurden von deutschsprachigen Lyrikern seit der Renaissance, später insbesondere von Klopstock, übertragen, nachgeahmt und abgewandelt. Die bekanntesten antikisierenden Verse sind die der sapphischen, alkäischen und asklepiadeischen Strophe.
Wie ist eine sapphische Strophe aufgebaut?
Die ersten drei Verse der sapphischen Strophe sind trochäische Fünftakter mit einem Daktylus in ihrer Mitte, der 4. und letzte Vers ist ein Adoneus.
Welche Literatur wird im Literaturverzeichnis aufgeführt?
Das Literaturverzeichnis enthält zwei Einträge: Karl Viëtor, "Geschichte der deutschen Ode" (Darmstadt, 1961) und Daniel Frey, "Einführung in die deutsche Metrik" (UTB 1903, München, 1996).
- Quote paper
- Julie Deloche (Author), 2000, Die Ode. Theorie und Aufbau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96789