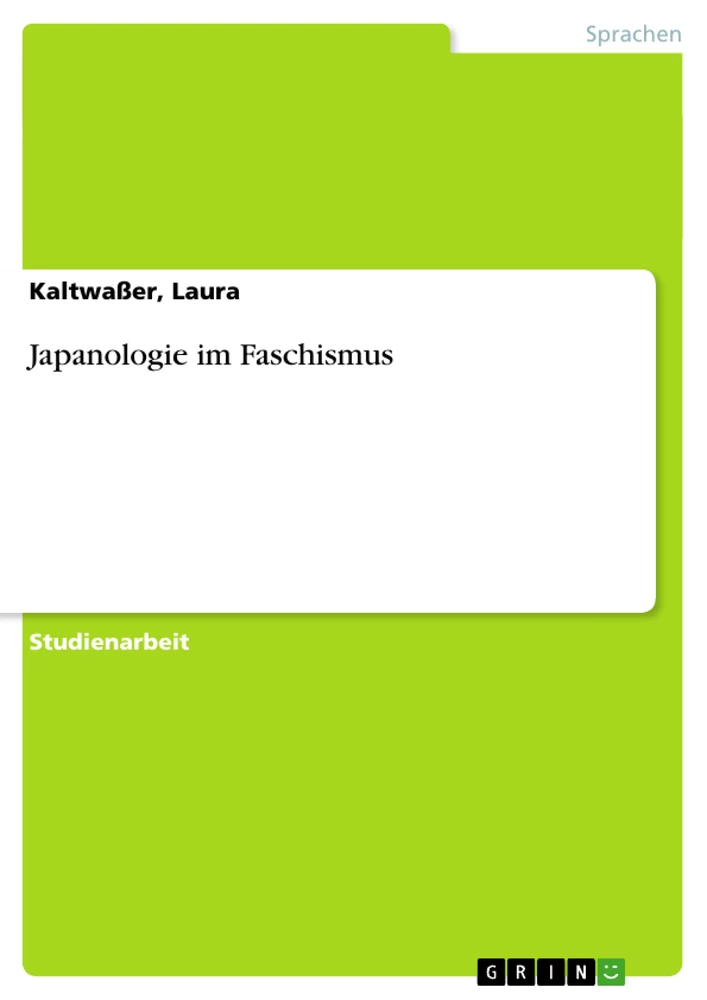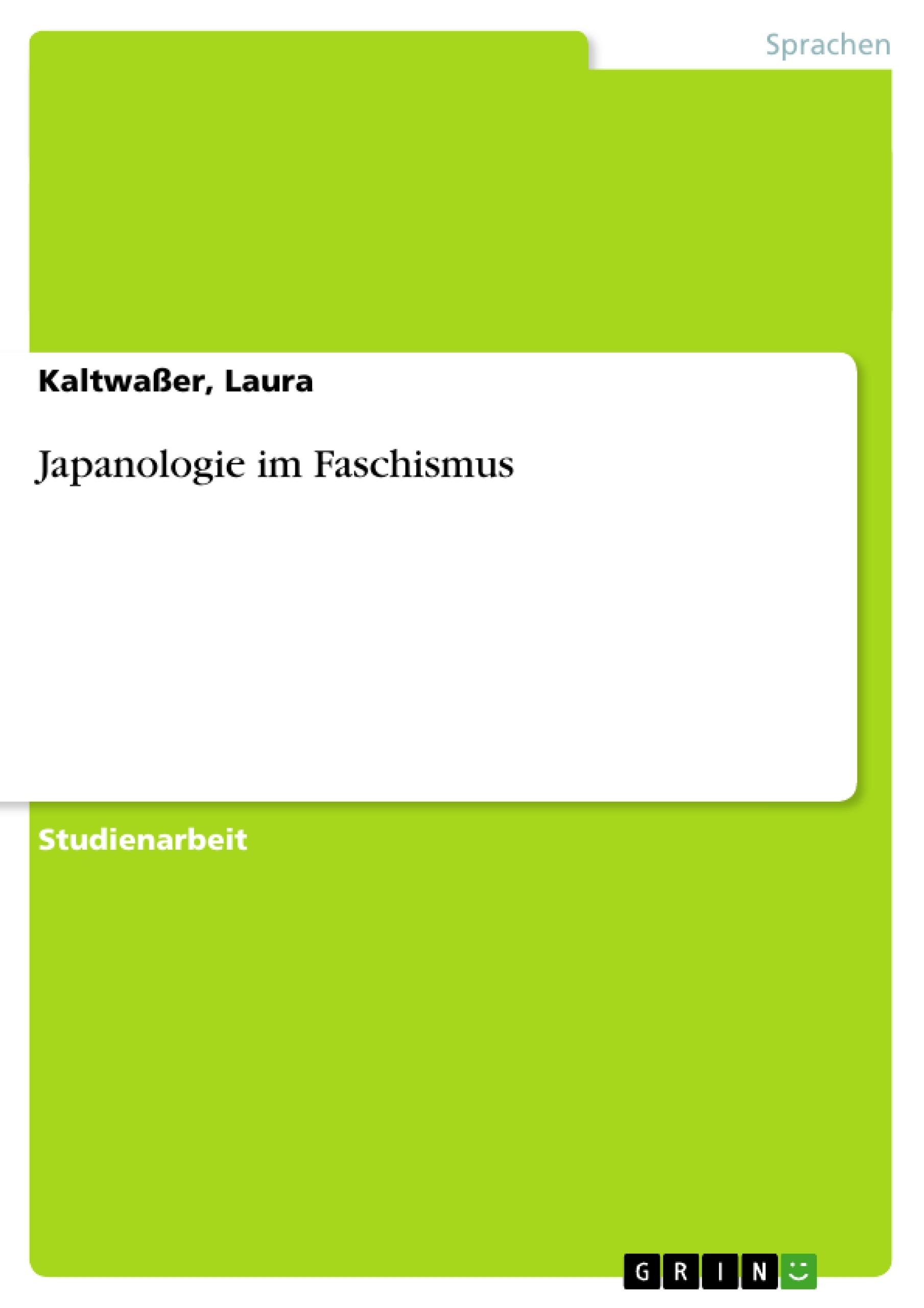Wie konnte es sein, dass im nationalsozialistischen Deutschland, wo Rassenideologie und der Glaube an die Überlegenheit der arischen Rasse Staatsdoktrin waren, Japan als "Bruder im Geiste" stilisiert wurde? Diese Frage steht im Zentrum einer ebenso faszinierenden wie verstörenden Untersuchung der deutsch-japanischen Beziehungen in den 1930er und 1940er Jahren. Entgegen der rassistischen Ideologie, die andere nicht-europäische Völker verachtete, erfuhr Japan eine Sonderbehandlung, die von politischem Kalkül und strategischer Notwendigkeit geprägt war. Die vorliegende Arbeit beleuchtet die vielfältigen Facetten dieser ungewöhnlichen Allianz, analysiert die ideologischen Rechtfertigungsversuche, die unternommen wurden, um die offensichtlichen Widersprüche zu überwinden, und untersucht die realen Auswirkungen auf in Deutschland lebende Japaner und Deutsch-Japaner. Es geht um die Konstruktion von Gemeinsamkeiten, die Betonung vermeintlich "arischer" Züge im japanischen Volk und die Verdrängung rassistischer Vorbehalte im Dienste machtpolitischer Interessen. Die Analyse zeigt, dass die "japanisch-deutsche Freundschaft" weniger auf gegenseitiger Wertschätzung als auf einer Zweckgemeinschaft basierte, die durch die geopolitische Lage und das Streben nach einer neuen Weltordnung motiviert war. Dabei wird die Diskrepanz zwischen ideologischer Propaganda und der tatsächlichen Behandlung japanischstämmiger Menschen in Deutschland ebenso thematisiert wie die ambivalente Haltung Hitlers, der Japan zwar bewunderte, aber gleichzeitig als potentielle Bedrohung wahrnahm. Diese Arbeit bietet einen spannenden Einblick in die komplexen Verflechtungen von Politik, Ideologie und Rassismus im Dritten Reich und zeichnet ein differenziertes Bild der deutsch-japanischen Beziehungen, das weit über die gängigen Klischees hinausgeht. Untersucht werden die Bereiche Japanologie, NS-Zeit, Rassismus, Antikominternpakt, Freundschaft, Propaganda, Ideologie, Politik und Geschichte. Ein Muss für jeden, der sich für die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte und die verworrenen Pfade internationaler Beziehungen interessiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 „Japanisch-Deutsche Freundschaft“
3 Interesse an Japan
4 „Bruder im Geiste“
5 Die Rassenfrage
6 Zusammenfassung
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit der Rechtfertigung des Japanertums in Deutschland zur Zeit der Nationalsozialisten. Ich stellte mir die Frage, wie es kam, daß man versuchte, sich mit dem fernen Japan als „Bruder im Geiste“ zu verstehen. Es war schwer, zu diesem Thema Literatur zu finden, denn es wurde zwar einiges darüber geschrieben, aber leider konnte ich viele Texte nicht lesen, da sie verloren gingen.
Weiterhin untersuchte ich, wie in Deutschland lebende Japaner und Halbjapaner behandelt wurden, denn diese Frage ergibt sich aus den vorangestellten. Hierzu war keine Originalliteraur aufzufinden. Ich fand lediglich einen Aufsatz, der sich mit in Japan lebenden Deutschen befaßte. Es gab jedoch genügend Anlässe, über dieses Thema zu schreiben, denn die Rassenfrage wurde im dritten Reich oft und viel diskutiert.
Da einer der Texte in englischer Sprache ist, bin ich nicht sicher, ob ich die logischen Schlüsse richtig verstanden habe.
2 „Japanisch-Deutsche Freundschaft“
Japanisch-Deutsche Freundschaft Ushiyama Kinichi
„ Entstanden ist das Bündnis, Blutsbrüdern gleich Die Länder beide vereint streben zur Macht empor. Strahlend die Kultur, die Rechtlichkeit erfurchtgebietend, Deutsche Seele wie gleichest Du dem japanischen Geist! “ (Dr. Hammitzsch, 1938:26)
Ich wählte dieses Gedicht für den Beginn meiner Arbeit, denn es gibt einen guten Einstieg in das Thema. Das Gedicht zeigt das Ziel der Japanisch-Deutschen Freundschaft sehr deutlich. Japan und Deutschland litten in den dreißiger Jahren „an einem Zustand der Instabilität als Folge der Weltwirtschaftskrise“ (Krebs 1994:11). Allein waren diese Länder zu schwach, um das Problem der Instabilität zu lösen. Es mußte ein Bündnispartner gefunden werden, der sich in einer ähnlichen Situation befand und somit auch das Bedürfnis nach Veränderung der schlechten Lage hatte. Zusammen mit diesem Staat mußte man stark genug sein, um diesen Zustand verändern zu können. So kam es, daß 1936 der Antikominternpakt von Deutschland und Japan unterschrieben wurde. Jeder fragt sich, wie die Japanisch-Deutsche Freundschaft zustande kommen konnte, wo doch die Japaner ganz und gar nicht dem arischen Bild Hitlers entsprachen. In den folgenden Kapiteln wende ich mich dem Problem noch genauer zu.
Beim Verstehen des Gedichtes muß beachtet werden, daß es von einem Japaner geschrieben worden ist. Die deutsche Übersetzung jedoch stammt von Dr. Horst Hammitzsch, einem deutschen Japanologen aus der NS-Zeit. Daher ist nicht eindeutig, ob die Originalversion sinngemäß der deutschen entspricht. Hammitzsch übersetzt, als wäre die Freundschaft mit den Deutschen das Beste, was ihnen passieren konnte, wobei ich den Eindruck habe, die National- sozialisten sahen die Bindung eher als eine Notwendigkeit und ein Mittel zum Zweck. Ich denke so darüber, weil ich beim Recherchieren mehrmals auf Aussagen gestoßen bin, die diese These bestätigen. Das Gedicht „Japanisch-Deutsche Freundschaft“ vermittelt den Eindruck einer harmonischen Bindung, obwohl die Frage aufkommt, was sich Japan und das Nazi-Deutschland gegenseitig zu geben haben.
3 Interesse an Japan
Im dritten Reich sollten viele innerstaatliche Veränderungen vorgenommen werden. Hierbei orientierte man sich an einem Land, das aufgrund seiner Staatsform zum Vorbild Deutschlands wurde. Japan beeindruckte durch die Einheitlichkeit seines Volkes ebenso wie durch die Idee des Kaiserhauses, die der derzeitigen deutschen Haltung ähnlich war. Japan wurde zum Vorbild aufgrund vielerlei Dinge. Beeindruckend war die Verbindung moderner Errungenschaften mit den traditionellen Werten wie beispielsweise der Staatsaufbau, das Familienrecht, die Wirtschafts-und Sozialordnung und auch das Erziehungs- wesen. Auch in wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fragen orientierte man sich an Japan, denn man war überzeugt, das könne zur Lösung der sozialen Krise, in der sich Europa seit dem 1. Weltkrieg befand, beitragen. Interessant waren ebenfalls Japans Lebens- gewohnheiten, denn laut Professor Heinrich Herrfahrdt scheint es frei von gesellschaftlichem Neid, was er zum Grund der europäischen Krise erklärt. „Daß sich das japanische Volk von sozialem Neid, der Wurzel aller gegenwärtigen europäischen Krisen, bisher im Wesentlichen freigehalten hat, begründet seinen besonderen Wert als Vorbild und Ansporn für eine innere Erneuerung der abendländischen Gesellschaftsordnung.“ (Nippon 1943, Heft 3:52)
4 „Bruder im Geiste“
Deutschland und Japan wurden oft als „Bruder im Geiste“ bezeichnet. Obwohl die beiden rein äußerlich nicht viele Gemeinsamkeiten hatten, ließen sich doch einige Parallelen ziehen. Ich denke, es wurden auch Ähnlichkeiten gesucht, die das Bündnis rechtfertigen sollten. Es wurde gesagt, die beiden wären keine Partner, die austauschen, sondern eher zwei Freunde, „die un- abhängig voneinander die gleichen Schicksale erleben“ (Nippon 1943, Heft 3:49). In der Tat befanden sich Deutschland und Japan in ähnlichen Situationen, denn beide Länder hatten viele Menschen und wenig Platz, sie besaßen kaum Rohstoffe und Absatzgebiete. Die Er- nährungsgrundlage war schlecht, das Verlangen nach Siedlungsland groß (Nippon 1943, Heft 3:49).
Da Deutschland und Japan räumlich durch die UDSSR getrennt sind, störten sie sich nicht in ihren natürlichen Großräumen, die Entfernung war für eventuelle Konflikte einfach zu groß, was eine gute Voraussetzung für eine politische Freundschaft gab. Durch ähnliche Probleme, Aufgaben, Gegner und Widerstände war ein Erfahrungsaustausch gewährleistet. Man konnte sich einerseits am Erfolg des anderen orientieren, andererseits aber auch aus seinen Mißer- folgen und Schwierigkeiten lernen. Weiterhin behauptet Prof. Herrfahrdt, „im Deutschland des dritten Reichs [...] lernt Japan ein gesünderes Europa kennen, das den schlechten Eindruck abendländischer Lebensformen auf Ostasien wieder gut machen kann, ein Europa, [...], in dem echtes Menschentum wieder lebendig wird.“ (Nippon 1943, Heft 3:51). Hierbei wurden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn nun konnte Europa vor anderen Völkern nicht nur in einem neuen Licht dargestellt werden, sondern auch gleichzeitig die geistig- seelische Begegnung mit Ostasien nutzen, um sich auf verlorengegangene Werte rückzube- sinnen.
Die stärksten Ähnlichkeiten aber fanden sich, nach Herrfahrdt, auf außenpolitischem Gebiet, denn für beide Völker bestand die größte Aufgabe wohl darin, einen „Großraum zu befrieden“ (Nippon 1943, Heft 3:52). Denn nun mußten sie ihre durch militärische Mittel angeeigneten Völker auch politisch und kulturell für sich gewinnen. Aber beide Staaten waren stark militärisch orientiert, und das schien auch das einzige zu sein, was in beiden Ländern richtig funktionierte (Nippon 1943, Heft 3:53). Deshalb setzten sich beide das Ziel, die ange- gliederten Völker von den Vorteilen der Angliederung zu überzeugen. Hierbei konnten sie natürlich gut voneinander lernen, indem sie Erfahrungen austauschten. Da beide Länder an einem Wendepunkt ihrer Geschichte standen, war ein Bündnis sehr hilfreich, denn neue Anstöße konnten meist durch die Begegnung mit anderen Völkern erlangt werden. Somit galt die Berührung mit Japan als ein wichtiges Erneuerungselement vor allem in militärischen Fragen.
5 Die Rassenfrage
Als Rassenfanatiker hegte Hitler eine Abneigung gegen nicht-europäische Völker. Die Japaner waren nur bedingt eine Ausnahme, denn sie waren zwar keine „kulturschöpfende Nation wie die Arier, aber auch keine kulturvernichtende wie die Juden“(Krebs 1994:13). Er war jedoch stark beeindruckt von der Tatsache, daß Japans Geschichte nie von Juden durchlaufen worden war. Außerdem bewunderte er ihre militärischen Erfolge gegen Rußland. Trotz allem aber waren seine Pläne, die Welt von Europa beherrschen zu lassen, nicht zu vereinen mit Japans Plänen, den „weißen Mann“ aus Ostasien zu vertreiben, weshalb Hitler noch während der Verhandlungen zum Antikominternpakt einem Engländer ein deutsches Bündnis vorschlug und auch militärische Unterstützung für England nach Japan schickte. Denn trotz aller Bewunderung betrachtete er die Japaner als eine untergeordnete Rasse, obwohl sie in seinen Augen nicht ganz so verächtlich waren wie die Chinesen.
Hier tut sich ein Zwiespalt auf, denn einerseits bewunderte Hitler die Japaner für ihre militärischen Erfolge, andererseits aber sah er aufgrund dieser Erfolge eine große Bedrohung in ihnen, so daß er anderen europäischen Ländern militärische Unterstützung bot. Hitler selbst sah in diesem Bündnis lediglich den Nutzen für Deutschland in Fragen bezüglich der Streitmacht.
Hierbei muß erwähnt werden, daß der japanische Botschafter Nagai das Bündnis nur eingehen wollte, wenn der Ausdruck „farbig“ neu definiert würde, denn er schließe zweifellos die japanische Rasse nicht aus (NOAG 1995:27). Der Minister des Auswärtigen Amtes entschuldigte sich sofort und versprach, den Strafgesetzentwurf zu ändern. Die Japaner sollten von nun an nicht mehr als Nichtarier bezeichnet werden. Eigentlich aber galten die Rassengesetze der Nationalsozialisten ausschließlich für Nichtarier, wobei nach Richtlinien bestimmt wurde, wer als Arier galt und wer nicht. Im allgemeinen waren damit hauptsächlich Juden und Personen mit jüdischer Abstammung gemeint.
Trotzdem gab es auch öffentliche Reden, in denen gegen die „gelbe Rasse“ gesprochen wurde. So hieß es beispielsweise in einer Rede von Alfred Rosenberg : „Wir er-kennen das Selbstbestimmungsrecht der gelben Rasse an, ... Wir wünschen nicht die Europäisierung der gelben Rasse, ... und wir bekämpfen mit allen Kräften eine Vermischung der Rassen.“ (NOAG 1995:29). So kam es, daß in der japanischen Presse einige Fälle von Diskriminierung in Deutschland lebender Japaner und Halbjapaner bekannt wurden, die große Entrüstung mit sich zogen. Der erste Fall betraf ein Mitglied der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft. Dr. Otto Urhan wurde am 18.Mai 1933 entlassen, weil seine Mutter eine Japanerin war. „Dieser Fall ist in der japanischen Presse ausführlich und teilweise leiden- schaftlich besprochen worden. Verschiedene japanische Gesellschaften haben Dr. Urhan eine Stellung in Japan angeboten.“ (NOAG 1995:29) In ihrer Ehre verletzt verlangten die Japaner von der deutschen Regierung eine Nachprüfung der Angelegenheit. Der zweite bekannt ge- wordene Fall betraf die neunjährige Tochter eines Dr. Takenouchi im Oktober 1933. Sie wurde auf dem Weg zur Schule von anderen Kindern beleidigt, weil sie „farbig“ war. Dieser Vorfall entrüstete die japanische Nation, weshalb sich der Außenminister von Neurath bei der japanischen Botschaft in Berlin für das Geschehene entschuldigte. Es gab noch weitaus mehr Fälle von Diskriminierung, die hier nicht im Einzelnen aufgezählt werden sollen.
Im Oktober 1934 schrieb Dr. Johann von Leers, ein nationalsozialistischer Journalist, eine „Denkschrift der DJG zur Frage der Anwendung der Rassengesetzgebung auf die Abkömmlinge aus deutsch-japanischen Mischehen“. Das Ziel dieser Denkschrift war es, die Japaner von der Rassenfrage der Nationalsozialisten zu befreien. (NOAG 1995:32) Denn „das einzige Hemmnis zwischen uns und Japan ist diese unselige Rassenfrage, die, nicht gelöst oder unglücklich gelöst, zur Zerstörung der guten Beziehungen zu führen droht.“ (NOAG 1995:33). Zur Rechtfertigung des Bündnisses wurden unzählige Forschungen angestellt, die beweisen sollten, daß das japanische Volk eine arische Abstammung vorweisen konnte.
Trotz dieser Forschungen wurden Bestimmungen zur Eheschließung von Nachfahren deutschjapanischer Ehen, welche als „Mischlinge“ bezeichnet worden, aufgestellt. Vor einer solchen Heirat mußte ein „Ehetauglichkeitszeugnis“ vorgelegt werden, was eine gute Möglichkeit ergab, „unerwünschte“ Ehen zu verhindern (NOAG 1995:44).
6 Zusammenfassung
Abschließend kann man sagen, daß die Rassenideologie ein so wichtiges Standbein für das NS-Regime war, weshalb die Nazis darauf verzichteten, ihren Rassismus gegenüber den Japanern abzulegen. Dabei war es für sie unwichtig, welche Schwierigkeiten das für die Japanisch-Deutschen Beziehungen brachte.
Ich bin beim Recherchieren mehrmals auf Widersprüche gestoßen. Ich kann nicht sagen, ob die Deutschen das Bündnis mit den Japanern als einen Vorteil in ihrer Entwicklung sahen und andersrum. Ich hatte das Gefühl, die Japaner empfanden die Bindung schon als den Beginn einer Freundschaft, die Deutschen jedoch wollten nur die günstige Gelegenheit nutzen, um ihr Ansehen in der Welt aufzubessern.
Ich konnte nicht herausfinden, wie beide Länder wirklich dazu standen. Fest steht, daß der Antikominternpakt von 1936 das Bestehen der Japanologie während der NS-Zeit ermöglichte, denn durch dieses Bündnis war ein Erfahrungsaustausch zwischen beiden Ländern gewähr- leistet. Wenn auch vor 50 Jahren keine wahre Freundschaft entstehen konnte, so ist uns heute möglich, gemeinsam mit Japan die Vergangenheit zu erforschen, die uns verbindet.
Literaturverzeichnis
Dr. Horst Hammitzsch (1938). „Shigin und Kenbu“. Nachrichten der Deutschen Gesellschaft für Natur-und Völkerkunde Ostasiens. Tôkyô 1938. Nr. 48. S. 25-30
Prof. Heinrich Herrfahrdt (1943). „Was haben sich Deutschland und Japan gegenseitig zu geben?“. Nippon 1943. Heft 3. S. 49-57
Gerhard Krebs (1994). „Die Geschichte der Deutsch-Japanischen Beziehungen 1933-1945“. In: Gerhard Krebs/ Bernd Martin (Hrsg.). Formierung und Fall der Achse Berlin-Tôkyô. München: Iudicium-Verlag. S. 11-56
Roswitha Sudrow (1978). „Die Japanologie zur Zeit des Faschismus“
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit "Rechtfertigung des Japanertums in Deutschland zur Zeit der Nationalsozialisten"?
Die Arbeit untersucht, wie das Japanertum während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland gerechtfertigt wurde. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, wie es zu dem Versuch kam, Japan als "Bruder im Geiste" zu verstehen. Auch die Behandlung von in Deutschland lebenden Japanern und Halbjapanern wird thematisiert.
Was war der Antikominternpakt und welche Rolle spielte er in den deutsch-japanischen Beziehungen?
Der Antikominternpakt wurde 1936 von Deutschland und Japan unterzeichnet. Er war ein Bündnis gegen die Kommunistische Internationale (Komintern) und diente als Grundlage für die weitere Annäherung der beiden Länder. Die Arbeit deutet an, dass der Pakt für beide Länder ein Mittel war, um ihre jeweilige Position in der Welt zu stärken.
Warum wurde Japan im Dritten Reich als Vorbild angesehen?
Japan beeindruckte durch die Einheitlichkeit seines Volkes und die Idee des Kaiserhauses, die der deutschen Haltung ähnelte. Des Weiteren wurden die Verbindung moderner Errungenschaften mit traditionellen Werten, der Staatsaufbau, das Familienrecht, die Wirtschafts- und Sozialordnung sowie das Erziehungswesen als vorbildlich betrachtet. Auch in wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fragen orientierte man sich an Japan, in der Hoffnung, die soziale Krise in Europa zu bewältigen.
Inwiefern wurden Deutschland und Japan als "Brüder im Geiste" betrachtet?
Obwohl äußerlich wenig Gemeinsamkeiten bestanden, wurden Parallelen zwischen Deutschland und Japan gezogen. Beide Länder hatten wenig Platz, kaum Rohstoffe und Absatzgebiete. Zudem waren die Ernährungsgrundlage schlecht und das Verlangen nach Siedlungsland groß. Die räumliche Trennung durch die Sowjetunion verhinderte Konflikte und ermöglichte einen Erfahrungsaustausch.
Wie stand es um die Rassenfrage im Verhältnis zu Japan?
Obwohl Hitler eine Abneigung gegen nicht-europäische Völker hegte, bildeten die Japaner eine Ausnahme. Sie galten zwar nicht als "kulturschöpfende Nation" wie die Arier, aber auch nicht als "kulturvernichtend" wie die Juden. Hitlers Bewunderung für Japans militärische Erfolge stand jedoch im Widerspruch zu seiner Angst vor deren Macht, weshalb er anderen europäischen Ländern militärische Unterstützung anbot. Es gab Fälle von Diskriminierung gegenüber in Deutschland lebenden Japanern und Halbjapanern, was zu Spannungen führte.
Welche Rolle spielte die Japanologie in dieser Zeit?
Der Antikominternpakt von 1936 ermöglichte das Bestehen der Japanologie während der NS-Zeit, da durch dieses Bündnis ein Erfahrungsaustausch zwischen beiden Ländern gewährleistet war.
Gab es öffentliche Kritik an der "gelben Rasse"?
Ja, es gab öffentliche Reden, wie die von Alfred Rosenberg, in denen das Selbstbestimmungsrecht der "gelben Rasse" anerkannt, aber gleichzeitig vor einer Vermischung der Rassen gewarnt wurde.
Wie wurden deutsch-japanische "Mischlinge" behandelt?
Es gab Bestimmungen zur Eheschließung von Nachfahren deutsch-japanischer Ehen, die als "Mischlinge" bezeichnet wurden. Vor einer solchen Heirat musste ein "Ehetauglichkeitszeugnis" vorgelegt werden, um "unerwünschte" Ehen zu verhindern.
- Citar trabajo
- Kaltwaßer, Laura (Autor), 1999, Japanologie im Faschismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96781