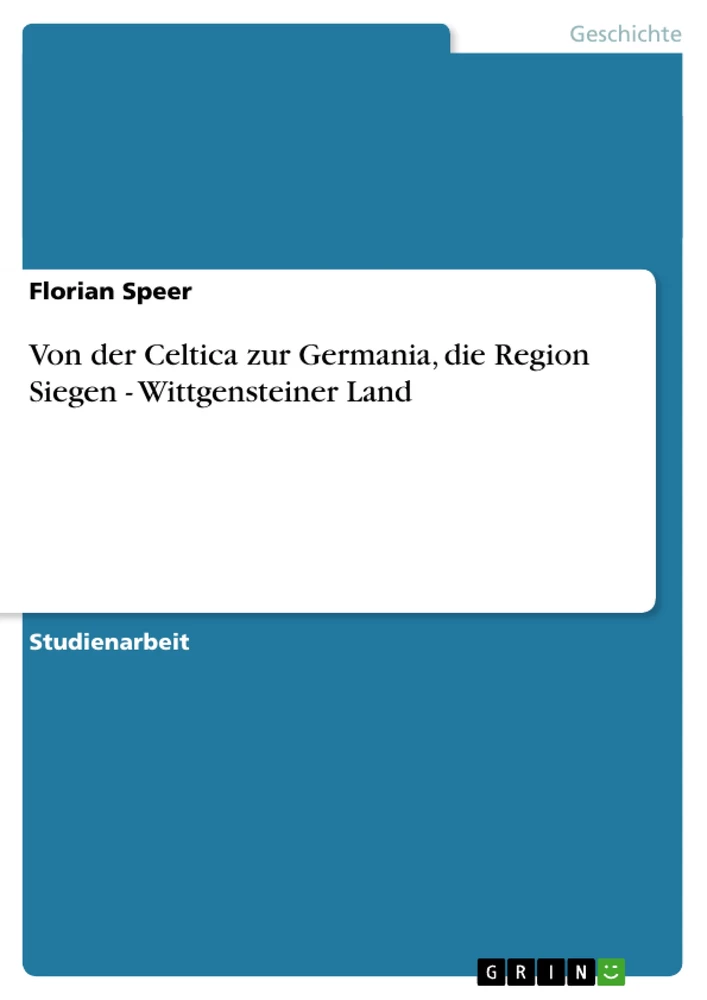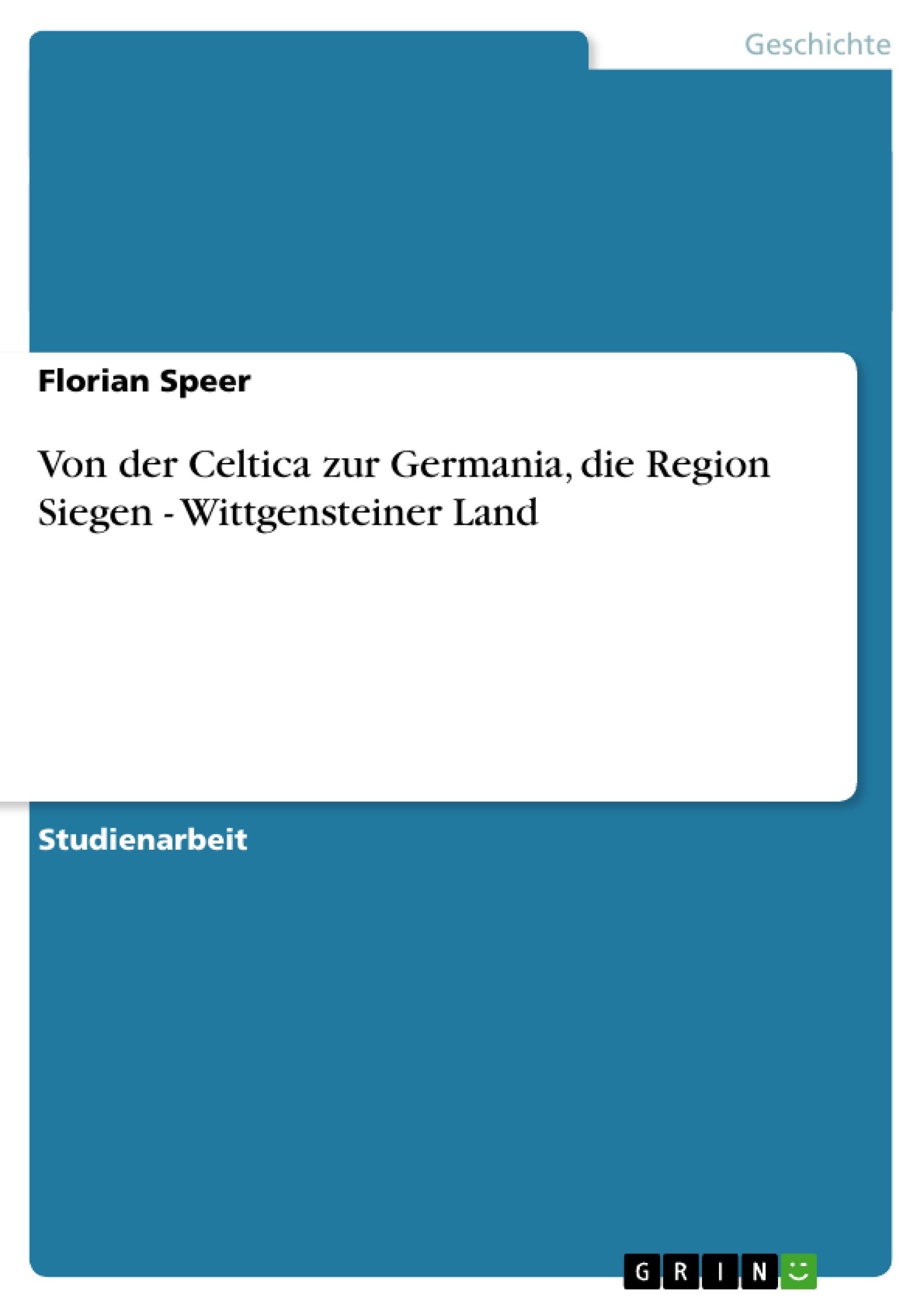Einleitung
Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich vom Siegener Land am Oberlauf der Sieg nach Nordosten in das Rothaargebirge hinein in den Raum um Bad Berleburg, ins südwestfälische Bergland, in das Quellgebiet der Flüsse Sieg, Eder, Lahn und Dill. [A]
Die Forschung setzt in Westfalen zwar schon 1825 durch die Gründung des "Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde Westfalens" recht früh ein, doch fand die Untersuchungsregion im 19. Jahrhundert wenig Aufmerksamkeit. Ein neuer Ansatz erfolgte 1879 durch Gründung eines Regionalvereins für die Kreise Siegen, Olpe, Wittgenstein und Altenkirchen, der aber schon 1887 seine Arbeit wieder einstellte. Eine planmäßige Erforschung und Verzeichnung von Funden erfolgte erst ab den 20er Jahren in diesem Jahrhundert.
Neben dem geringen Interesse an diesem Gebiet kam für die Forschung ein weiteres Problem hinzu: die wirtschaftlich-geographischen Verhältnisse. Auf Grund von weitläufigem Waldbestand, der Weideswirtschaft sowie der mittelalterlichen Haubergswirtschaft wurde die Auffindung vieler Bodendenkmale verhindert oder sie waren verändert oder zerstört worden.
Exkurs Haubergswirtschaft: Urwechselwirtschaft in Form einer Brandwirtschaft. 18 Jahre Wuchs von Niederwald, insbesondere Eichenwald, der gehauen wird und dessen Reste man verbrennt. Die Baumstrünke verbleiben meist im Boden. Auf der Fläche erfolgte dann 2 bis maximal 4 Jahre Anbau von Getreide, in der Regel Roggen, danach wurde sie als Weidefläche benutzt. Die Haubergswirtschaft wurde meist auf kargen Böden praktiziert und war genossenschaftlich organisiert, d.h. der Boden gehörte einer Gemeinschaft, die ihn in einzelne Haue oder Haustücke teilte. Andere Bezeichnungen für Hauberg sind: Rottbusch, Rodebusch oder Ausschlagungswald.
Waren für die Forschung urspünglich nur die Reste von Burgen und alten Wallburgen interessant, so traten in den 20er und 30er Jahren auch Hüttenwesen und Bergbau hinzu. Schwerpunkt der heutigen Forschung in diesem Raum sind die frühen Eisenschmelzen, wobei die LatÜne- oder jüngere Eisenzeit der besonders interessierende Zeitraum ist.
Auf Grund der Funddichte kann festgestellt werden, daß erste Menschen sich in diesem Gebiet während der mittleren Steinzeit nur sporadisch aufhielten (8000-4000 Jahre v.Chr.). Zu einer dünnen, aber dauerhaften Besiedelung kam es in der Jungsteinzeit (4000-1800 v. Chr. Beginn Ackerbau).
Sprunghaft steigen dann die Funde aus der späten Eisenzeit an, die auf eine rasch einsetzende und relativ dichte Besiedelung des Gebietes schließen lassen, das am Rande des Hunsrück-Eifel- Kulturraums lag. Die Besiedlung erfolgte nicht nur in Tallagen, sondern bis auf Höhen von 600 m. Das Interesse der Menschen an diesem Raum ergab sich vor allem durch das Zusammenfallen mehrerer für die Eisenherstellung günstiger Faktoren:
1. Im Gegensatz zu den viel verbreiteten aber nur mühselig zuzubeutenden Raseneisenerzvorkommen, finden sich hier reiche Brauneisensteinvorkommen (Limotit).
2. Die Vorkommen des Brauneisenstein erfolgen in breiten Adern bis dicht an die Oberfläche und waren demzufolge im Tagebau zu gewinnen.
3. Reiche Waldbestände lieferten das notwendig Holz für die Verhüttungsvorgänge.
4. Wasser und Lehm boten die Möglichkeit zum Bau von Verhüttungsöfen.
An Siedlungsspuren dieser Epoche finden sich:
Wallburgen (Dotzlar,Wemlighausen, Aue, Obernau, Laasphe, Burbach, Hesselbach), Siedlungen (Dotzlar, Hemschlar, Rinthe, Wemlighausen),
Hausplätze in Hanglage, sogenannte Podien, sowohl einzeln gelegen als auch innerhalb der Wallburgen, häufig im Zusammenhang mit der Eisenbearbeitung (Alchen, Hermelsbach, Leimbach, Minnerbach, Oberschelden, Trupbach, Zeppenfeld, Ziegenberg bei Wilgersdorf), Verhüttungsplätze (Engsbach, Minnerbach, Trupbach, Arbachtal, Felsenbach, Leimbach, Wenscht), Gräber (Birkefehl, Deuz, Raumland, Obersdorf, Volkersbachtal).
Die Burgen
Uneinheitlich in ihrer Größe von 2 ha (Aue) bis 9,5 ha (Obernau), jedoch alle in exponierter Gipfellage in Höhen von 551 m bis 666 m. Die Bauweise ähnelt. An steilen Hängen, wo der Anlage wenig Gefahr drohte, terrassierte man zur Innenseite und setzte Palisaden, an gefährdeten Stellen sicherte man sich durch Stein-Erdwälle mit Palisadenabschluß zur Außenseite (murus gallicus). Besonders gesicherte Eingangsbereiche mit Tor, bzw. Torhausanlage (Aue, Obernau), z. T. mit überlappenden, parallellaufenden Wallanlagen. Im Inneren, bislang jedoch kaum untersucht Hausplätze mit Steinfundamenten und Steinpflasterboden, Podien. Eine zeitliche Einordnung ist nur auf Grund von Vergleichen möglich, datierbare Einzelfunde sind sehr selten, auf Grund der bislang unterbliebenen Untersuchungen in den Innenbereichen aber erklärbar. Nur in der Wallanlage von Aue kamen Keramikscherben zu Tage, die in das erste vorchristliche Jahrhundert gehören.
Aue [ B-2 ] : Länglich ovale Burganlage auf einer zur Eder steil abfallenden Bergkuppe. Die steile Nord- und Westseiten waren terrassiert und ursprünglich wohl mit Palisaden versehen, heute ein Wirtschaftsweg. Die gefährdeten Ost- und Südhänge waren mit einem heute noch 2,5 m aufragenden Wall versehen. Vor dem Wall befand sich kein Graben, wohl aber dahinter ein breiter Materialentnahmegraben. Bei Grabungen wurden im Bereich des heutigen Zugangsweges die Reste des Torhauses in Form von 6 Pfostenlöchern entdeckt. Bei Untersuchung des Materialentnahmegrabens fand man 1932 zwei Hausgrundrisse von einer Seitenlänge mit 6,5 sowie von 6 m. Bei einer Nachuntersuchung an der Wallanlage wurde 1985 festgestellt, daß die Wallburg von Aue zumindest 2- periodig ist. Die ältere Wallanlage bestand aus einem Holzwerk mit senkrechten Pfosten, verbunden durch Queranker und einem dahinterbefindlichen kleinen Wall mit kleinem Graben auf der Innenseite. Später wurde die zusammengestürzte Holz-Erde-Konstruktion von einem mächtigen Erdwall bedeckt, der eine nicht bekannte Außenversteifung besessen hatte.
Obernau [ B-3 ] : Auf einem der höchsten Berge des Umlandes gelegen, ovale Ringwallanlage mit doppeltem Befestigungssystem. Der Zugang der Anlage war ursprünglich über die Ostseite, wo sich zwei zusätzliche kleinere Sperrwälle befanden. - Der äußere Ring ist an den gefährdeten flacheren Stellen als Wall (Osten und Westen), an den steilen Hängen (Norden und Süden) als Terrassierung erkennbar. Der äußere Wall besteht aus einer steinarmen Lehmaufschüttung mit innerem Holzwerk, der ehemaligen Außenseite hatte man eine Steinpackung vorgelagert. Es wurden zwei, durch Eingriffe vergangener Jahrhunderte kaum noch erkennbare Tore festgestellt, ebenso deuten zwei überlappenden Wallenden auf einen alten Durchgang. - Der innere Ring besteht aus einer Stein-Erde-Schüttung, wozu man das Material aus einem innenseitig gelegenen Materialgewinnungsgraben genommen hatte. Ein Fundamentgraben weist auf eine durchgehende Palisadenfront hin, die mit Querhölzern versteift war. Zwei der heute vorhandenen Durchlässen des inneren Ringes konnten als alte Tore nachgewiesen werden, wobei sich am Nordtor Hinweise fanden, daß es ursprünglich um ein Kastentor mit einer inneren Weite von 2,5m x 5m handelte. Die Toranlage wies wie auch andere Stellen der Burg starke Brandspuren auf. Ein gewaltsames Ende der Anlage kann vermutet werden. Innerhalb der Anlage Hinweise auf Podien.
Die Siedlungen und Hausplätze.
Die Funde an den Siedlungsplätzen deuten auf kontinuierliche langdauernde Siedlungstätigkeit an gleichem Ort hin, insbesondere durch die Konzentration von Funden gleicher Zeiträume die flächenmäßig getrennt nachweisbar waren. Beispiel Wellbach, in Berleburg-Raumland [ B-1 ]. Gefunden wurden Grundrisse einschiffiger Häuser, viereckige Speicher, Backöfen sowie Gruben mit bislang nicht eindeutig erklärbarer Funktion.
Von besonderer Bedeutung sind die sogenannten Podien. Es handelt sich um Einzelhausplätze, die sowohl alleine als auch zu mehreren gelegen aufgefunden wurden [ B-4 ]. In windgeschützter Lage hatte man an sonnenbeschienenen Hängen durch Abgraben und gleichzeitiges Aufschütten Terrassen geschaffen, die problemlos bebaut werden konnten. Diese Plätze, in der Regel 15-40 m lang und 8-15 m breit, waren immer im Nahbereich einer Quelle gelegen. Bei allen Untersuchungen wurden einheitliche Befunde festgestellt: In der Mitte der Podien fand sich eine wannenartige, mehrere Quadratmeter große verziegelte Fläche, wo Hammerschlag, Holzkohlenreste, Schlackenreste, Amboßsteine und Eisenbruch darauf hinwiesen, daß hier metallgewinnendes sowie metallverarbeitendes Gewerbe zu Hause war. Verfärbungen im Boden, aus denen die Pfostensetzung der Häuser hätte entdeckt werden können war auf Grund der Erdbewegung bei der Terrassierung nicht möglich. In einem Ausnahmefall fanden sich Pfostenlöcher die auf ein ein- oder zweischiffiges Haus von 8x7 m hinwiesen. An datierbaren Einzelfunden wurden neben Keramikresten Schmiedewerkzeuge und Schmiedeerzeugnisse gefunden. Da die Fundstücke der Produktpalette in ihrer Art dem Modegeschmack des keltischen Kernlandes entsprechen, kann vermutet werden, daß neben dem eigenen Bedarf auch Handelsware hergestellt wurde. Generell läßt sich für alle Podien feststellen, daß sie nur über wenige Generationen als Siedlungsplatz genutzt wurden und wahrscheinlich bei Erschöpfung der Ressourcsen aufgegeben wurden.
Bislang wurde nur wenige dieser Siedlungsplätze (u.a. Zeppenfeld) systematisch ergraben, wo sich zwei Podien befanden, wovon das eine dem Arbeitsbereich und das andere zu Wohnzwecken diente. Die Podien lagen voneinander rund 25 m entfernt. Die Schmiedestelle wies eine steinreiche, ebene Fläche mit einem muldenförmig eingetieften Ofen im Zentrum auf. Daneben fand sich eine Stelle mit sehr hoher Holzkohlekonzentration sowie eine andere mit Schlackenresten. Ergraben wurde ein Amboß und ein Meißel. Auf Grund von Gefäßfragmenten sowie einem Halbfertigprodukt war eine Datierung in die Spätlatenezeit möglich. Da zweite Podium wies mehrere Pfostengruben auf, die einen Grundriß von 8 x 4,2 m ergaben. Neben vielen Scherben fanden sich Eisenfragmente sowie eine eiserne Herdschaufel, die in den gleichen Zeitraum wie der Schmiedeplatz weisen.
Die Verhüttungsplätze
Die reichhaltigen und gut abbaubaren Eisenerzvorkommen des Siegerlandes waren neben anderem der Grund für den hohen Besiedelungsgrad des Siegerlandes in der Jüngeren Eisenzeit.
Die Roheisengewinnung fand in unmittelbarer Nähe des Wohn- und Weiterverarbeitungsbereichs statt, das heißt, bei den Wohn- und Schmiedepodien in unmittelbarer Wassernähe. Zu erwähnen sind Anlagen in Engsbach, Minnerbach, Oberschelden, Leimbach, Trupbach, Wenscht. Wenig verbreitet, aber auch nachgewiesen waren freistehende Öfen, die meist einen Durchmesser von gerade 30 cm erreichten. Die Mehrzahl der Öfen hatte man, um ausreichende Temperaturen zu erzielen, in die Böschung eingegraben. Neben einem hohen Isolierungsgrad gab das umgebende Erdreich den Schmelzanlagen einen sicheren Schutz vor dem Auseinanderbrechen. Es blieb nur die Ofenbrust sichtbar. Den Hanglehm benutzte man zum Bau des Ofenmantels, der gut 70 cm Stärke erreichen konnte. Die Öfen hatten einen größten Innendurchmesser am Boden von 60-80 cm und eine Brennraumhöhe von rund einem Meter, woraus sich ein Volumen von rund 1,5 cm3 errechnet. Der Ofenkörper selber war bienenkorbähnlich mit einer aufgesetzten zylindrischen Esse, die für den nötigen Zug in der Anlage sorgte. Die Luftzufuhr erfolgte durch einen vorgelagerten Windkanal, von dem aus am Ende die Luft durch ein rund 6 cm rundes Düsenloch in den Ofen geleitet worden war. Auf Grund von aufgefundenen Pfostenlöchern vermutet man, daß einige der Anlagen Arbeitspodeste besaßen, von wo aus die Schmelzanlage beschickt worden war. Die kleinen, freistehenden Öfen besaßen ein Düsenloch von rund 2 cm Durchmesser, dazu allerdings wohl einen Blasebalg zur Erhöhung der Luftzufuhr. Erkennbar an den aufgefundenen metallenen Blasebalgspitzen im Ofenlehm. Ob die Öfen beliebig nebeneinanderher benutzt, oder gegebenenfalls für unterschiedliche Verarbeitungsgänge genutzt wurden, ist bislang nicht auszumachen. Aufgefunden wurden sowohl Einzelanlagen wie auch Betriebsstätten mit bis zu 40 Öfen dicht beieinander, wo einst eine Vielzahl Menschen gleichzeitig tätig war. Diese extensive Metallgewinnung hatte natürlich das Problem, über genügend Holzkohle für die Schmelzen zu verfügen. Vermutet wird, daß schon zu damaliger Zeit eine Art Holzwirtschaft betrieben wurde. Funde ergaben, daß sehr junges, 5-20 Jahre altes Holz verarbeitet wurde, das auf Niederholzwirtschaft weist.
Eine interessante Anlage findet sich in Siegen Oberschelden [ C-1 ]. Bereits in den 30er Jahre wurde der Schmelzofen gefunden, erhalten waren hier verschiedene Mantel-, Düsen- und Keramikfragmente[1]. Eine Untersuchung im Jahre 1987 erbrachte die Feststellung von 4 Podien aus der Jüngeren Eisenzeit (LatÜne D). Im Mittelpunkt von 3 Wohnpodien[3] wurde ein Schmiedepodium[2] gefunden, auf dem ursprünglich ein Gebäude von rund 7 x 8 m gestanden haben muß. Muldenförmig und eingetieft lag in der Mitte ein Schmiedeofen, identifiziert durch verziegelten Lehm, Holzkohlestücke und sogenannten Hammerschlag. An Fundstücken kamen zusammen: viereckig ausgeschmiedeter Draht, eine geflickte Schafschere, mehrere zerbrochene Messerklingen, daneben aber auch Reste von Grob- und Feinkeramik und zwei eiserne Fibeln.
Die Bestattungsanlagen
Im Raum Siegen-Wittgenstein konnten nur bislang nur wenige Grabfunde getätigt werden, die teilweise recht unterschiedlich sind, jedoch alle der älteren und jüngeren Eisenzeit anzugehören scheinen. In den letzten Jahren wurden Fundestätten der älteren Eisenzeit bei Deuz und Birkefehl ausgemacht, die einem ähnlichen Bevölkerungshintergrund zu entstammen scheinen und zwei verschiedene Bestattungsarten nämlich -Urnenbestattung und Knochenlager- aufweisen. Bei beiden Bestattungsarten wurden die Toten verbrannt und die Zusammensetzung der Beigaben ließen soziale Unterschiede nicht erkennen.
An Urnenbestattungen finden sich Tonurnen mit aufgelegter umgestülpter Deckelschale vorgenommen, in regeloser Abfolge, jedoch in kleinen Gruppen beinander. Weiter wurden bauchige breite Urnen mit kurzem ausbiegenden Randbereich und Strichmuster auf der Schulterzoge aufgefunden, ähnlich dem Nienburger Typ. Hier waren unter den Bestattungsresten sehr viele Schmuck- und Kleiderzubehörgegenstände mit Brandspuren gefunden worden, daß vermutet wird, daß die Toten in ihrer vollen Tracht verbrannt wurden. Die in etwa in gleicher Zahl vorgefundenen Leichenbrandnester waren einfache, oft direkt nebeneinander in den Boden eingelassene Gruben. Eine Besonderheit war die Auffindung eines Körpergrabes am Rande des Deuzer Gräberfeldes, wo man an Hand der Beigaben deutliche Parallelen mit Funden aus dem Neuwieder Becken sowie des Mittelrheins feststellen kann. Gleiches wurde bei den Beigaben aus den o.g. bauchigen Urnen festgestellt. Möglicherweise ein Indiz für die Herkunft der Eisenzeitmenschen des Siegerlandes.
Aus der jüngeren Eisenzeit stammt ein Urnenfund der ebenfalls bei Deuz gemacht wurde und um 300 v. Chr. angelegt wurde. [ C-4 ] Der Boden der abgebildeten Schale besitzt in seinem Innern ein Muster vom Typ der sog. Braubacher Schalen. Die Fibeln sind [1,2] mit einer farbigen Glaspaste verziert. Die Urnenfunde von Neunkirchen Zeppenfeld [ C-3 ] sind die jüngsten Funde dieser Region aus der vorrömischen Zeit und waren innerhalb einer Steinsetzung mit einer Kantenlänge von 12 m bestattet.
Mit Beginn der Römerzeit scheint das Gros der Bevölkerung aus dem Siegerland abgewandert zu sein. Die Region ist für die ersten vier nachchristlichen Jahrhunderte nahezu fundleer, wenngleich sich dort eine minimale Population erhalten zu haben scheint. Das wurde durch Pollenuntersuchungen nachgewiesen, bei denen man Getreidereste fand. Die Römerzeit wird durch einige wenige Münzfunde aus der Zeit von nach 62 - nach 313 dokumentiert.
Literatur:
Steuer, Heiko / Zimmermann, Ulrich (Hrsg.): Montanarchäologie in Europa, Berichte zum Internationalen Kolloquium "Frühe Erzgewinnung und Verhüttung in Europa", vom 4.-7. Oktober 1990, Sigmaringen 1993
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Untersuchungsgebiet dieses Textes?
Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich vom Siegener Land am Oberlauf der Sieg nach Nordosten in das Rothaargebirge hinein in den Raum um Bad Berleburg, ins südwestfälische Bergland, in das Quellgebiet der Flüsse Sieg, Eder, Lahn und Dill.
Warum wurde die Region im 19. Jahrhundert wenig beachtet?
Obwohl die Forschung in Westfalen schon 1825 begann, fand die Untersuchungsregion im 19. Jahrhundert wenig Aufmerksamkeit. Ein Regionalverein wurde 1879 gegründet, stellte aber seine Arbeit 1887 wieder ein. Eine planmäßige Erforschung begann erst ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Welche wirtschaftlich-geographischen Verhältnisse erschwerten die Forschung?
Weitläufiger Waldbestand, Weidewirtschaft und die mittelalterliche Haubergswirtschaft erschwerten die Auffindung vieler Bodendenkmale oder führten zu deren Veränderung oder Zerstörung.
Was ist die Haubergswirtschaft?
Die Haubergswirtschaft ist eine Urwechselwirtschaft in Form einer Brandwirtschaft. Dabei wächst 18 Jahre Niederwald (Eichenwald), der gehauen und verbrannt wird. Nach 2-4 Jahren Getreideanbau (Roggen) wurde die Fläche als Weide genutzt. Sie war genossenschaftlich organisiert und wurde auf kargen Böden praktiziert. Andere Bezeichnungen sind Rottbusch, Rodebusch oder Ausschlagungswald.
Welche Aspekte der Forschung traten neben Burgen und Wallburgen hinzu?
In den 20er und 30er Jahren traten auch Hüttenwesen und Bergbau in den Fokus der Forschung. Schwerpunkt der heutigen Forschung sind die frühen Eisenschmelzen, wobei die Latène- oder jüngere Eisenzeit von besonderem Interesse ist.
Wann erfolgte die erste Besiedelung des Gebiets?
Erste Menschen hielten sich während der mittleren Steinzeit nur sporadisch in diesem Gebiet auf (8000-4000 Jahre v.Chr.). Eine dünne, aber dauerhafte Besiedelung erfolgte in der Jungsteinzeit (4000-1800 v. Chr., Beginn Ackerbau).
Warum stieg die Funddichte in der späten Eisenzeit sprunghaft an?
Die Funde aus der späten Eisenzeit lassen auf eine rasch einsetzende und relativ dichte Besiedelung schließen, da das Gebiet am Rande des Hunsrück-Eifel-Kulturraums lag. Das Zusammenfallen mehrerer für die Eisenherstellung günstiger Faktoren begünstigte die Besiedlung:
- Reiche Brauneisensteinvorkommen (Limonit).
- Brauneisensteinvorkommen in breiten Adern bis dicht an die Oberfläche.
- Reiche Waldbestände für die Verhüttung.
- Wasser und Lehm für den Bau von Verhüttungsöfen.
Welche Siedlungsspuren finden sich aus dieser Epoche?
Wallburgen (Dotzlar,Wemlighausen, Aue, Obernau, Laasphe, Burbach, Hesselbach), Siedlungen (Dotzlar, Hemschlar, Rinthe, Wemlighausen), Hausplätze in Hanglage (Podien), Verhüttungsplätze (Engsbach, Minnerbach, Trupbach, Arbachtal, Felsenbach, Leimbach, Wenscht), Gräber (Birkefehl, Deuz, Raumland, Obersdorf, Volkersbachtal).
Wie waren die Burgen beschaffen?
Die Burgen waren uneinheitlich in ihrer Größe (2 ha bis 9,5 ha) und lagen in exponierter Gipfellage (551 m bis 666 m). Sie waren an steilen Hängen terrassiert und mit Palisaden versehen, an gefährdeten Stellen mit Stein-Erdwällen (murus gallicus) gesichert. Besonders gesicherte Eingangsbereiche mit Tor bzw. Torhausanlage waren vorhanden. Im Inneren befanden sich Hausplätze mit Steinfundamenten und Steinpflasterböden (Podien).
Was sind Podien und welche Bedeutung haben sie?
Podien sind Einzelhausplätze, die durch Abgraben und Aufschütten an Hängen Terrassen schufen. In der Mitte der Podien befand sich eine verziegelte Fläche, die auf metallgewinnendes und -verarbeitendes Gewerbe hinweist. Funde deuten darauf hin, dass neben dem eigenen Bedarf auch Handelsware hergestellt wurde. Sie wurden nur über wenige Generationen als Siedlungsplatz genutzt.
Wo fand die Roheisengewinnung statt?
Die Roheisengewinnung fand in unmittelbarer Nähe des Wohn- und Weiterverarbeitungsbereichs statt, das heißt, bei den Wohn- und Schmiedepodien in unmittelbarer Wassernähe (Engsbach, Minnerbach, Oberschelden, Leimbach, Trupbach, Wenscht).
Wie waren die Verhüttungsöfen beschaffen?
Die Mehrzahl der Öfen war in die Böschung eingegraben, um hohe Temperaturen zu erzielen. Der Ofenmantel bestand aus Hanglehm und war ca. 70 cm stark. Der Ofenkörper war bienenkorbähnlich mit einer zylindrischen Esse. Die Luftzufuhr erfolgte durch einen Windkanal. Einige Anlagen besaßen Arbeitspodeste. Einzelanlagen und Betriebsstätten mit bis zu 40 Öfen dicht beieinander wurden gefunden.
Welche Bestattungsarten gab es in der Eisenzeit?
Es gab Urnenbestattungen und Knochenlager. Bei beiden Bestattungsarten wurden die Toten verbrannt. In Deuz wurde auch ein Körpergrab gefunden, das Parallelen zu Funden aus dem Neuwieder Becken und des Mittelrheins aufweist.
Was geschah mit dem Gebiet in der Römerzeit?
Mit Beginn der Römerzeit scheint das Gros der Bevölkerung aus dem Siegerland abgewandert zu sein. Die Region ist für die ersten vier nachchristlichen Jahrhunderte nahezu fundleer.
Welche Literatur wird empfohlen?
- Steuer, Heiko / Zimmermann, Ulrich (Hrsg.): Montanarchäologie in Europa, Berichte zum Internationalen Kolloquium "Frühe Erzgewinnung und Verhüttung in Europa", vom 4.-7. Oktober 1990, Sigmaringen 1993
- Hömberg, Philipp R. / Schubert, Anna Helena (Redaktion): Der Kreis Siegen-Wittgenstein, Stuttgart 1993, (=Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, Bd.25), hrsg. vom Nordwestdeutschen und vom West- und Süddeutschen Verband für Altertumspflege
- Citar trabajo
- Florian Speer (Autor), 1999, Von der Celtica zur Germania, die Region Siegen - Wittgensteiner Land, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96748