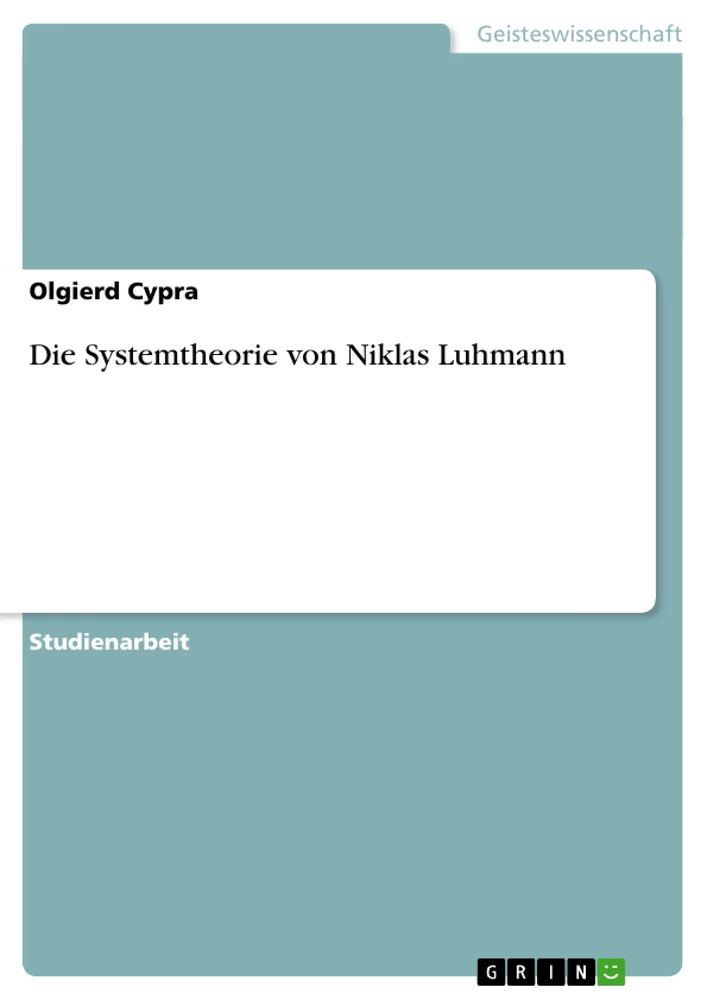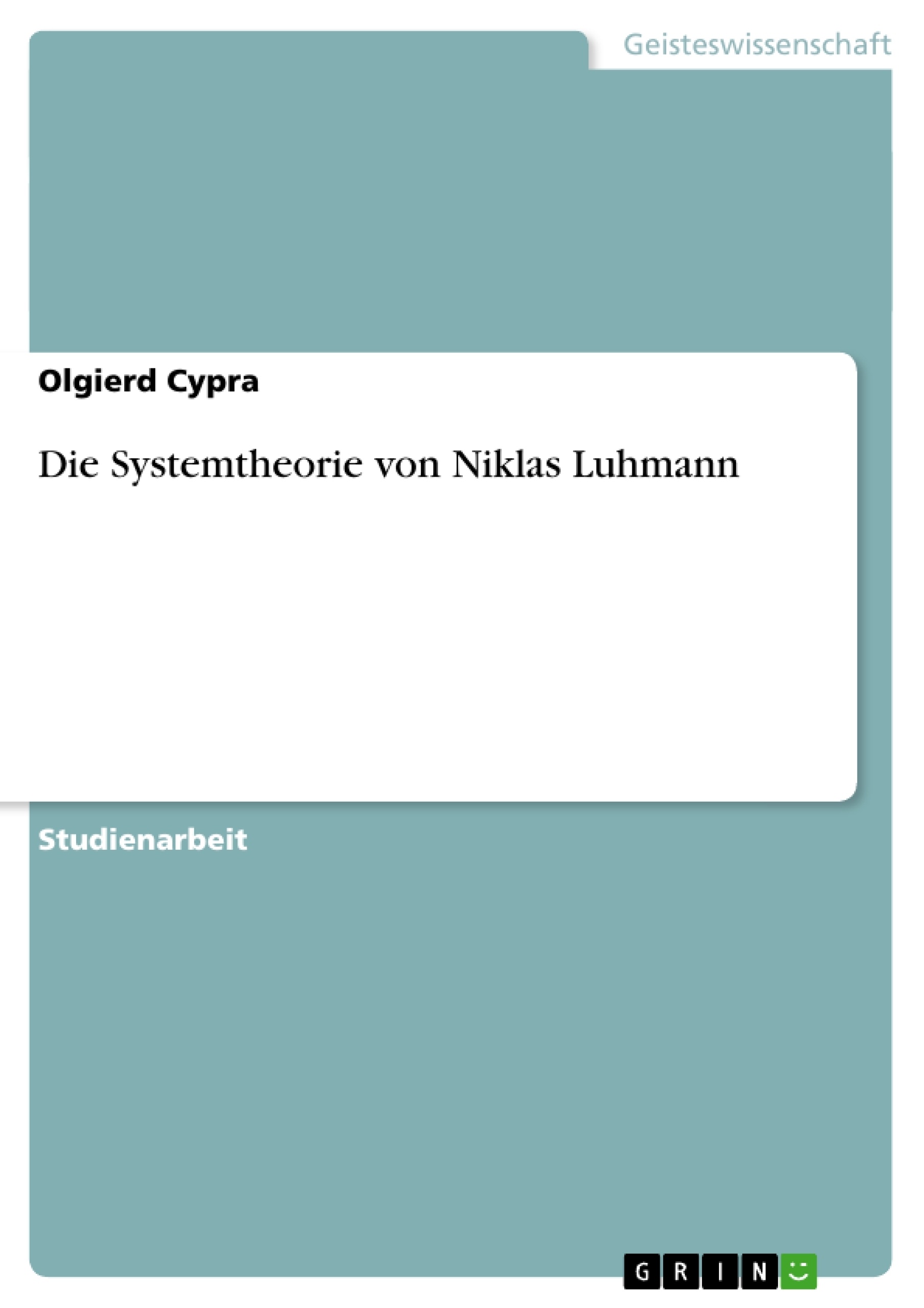Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Gesellschaft nicht durch Individuen, sondern durch Kommunikation selbst geformt wird. Niklas Luhmanns bahnbrechende Systemtheorie, hier leicht zugänglich aufbereitet, fordert unsere traditionellen Vorstellungen vom Sozialen heraus. Diese Einführung entführt Sie in das faszinierende Reich der autopoietischen Systeme, in dem soziale Strukturen als selbstreferentielle, sich selbst erschaffende Einheiten verstanden werden. Entdecken Sie, wie Luhmanns radikaler Ansatz die Soziologie revolutionierte, indem er den Fokus von handelnden Personen auf die dynamischen Prozesse der Kommunikation verlagerte. Verstehen Sie die komplexen Wechselwirkungen zwischen System und Umwelt, die Rolle der Beobachtung und die Bedeutung von Sinnkonstruktionen in einer zunehmend komplexen Welt. Von den Grundlagen der Allgemeinen Systemtheorie über Parsons' strukturfunktionalen Ansatz bis hin zu Luhmanns innovativer Verwendung des Autopoiesis-Konzepts werden die Schlüsselideen dieser einflussreichen Theorie verständlich und nachvollziehbar erläutert. Ergründen Sie, wie soziale Systeme durch Kommunikation Realität konstruieren, Komplexität reduzieren und Ordnung schaffen. Diese Einführung bietet einen umfassenden Überblick über Luhmanns Werk, ideal für Studierende der Soziologie, Kommunikationswissenschaften und alle, die sich für die Funktionsweise moderner Gesellschaften interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt der sozialen Systeme und entdecken Sie neue Perspektiven auf die Dynamik von Organisationen, Interaktionen und der Gesellschaft als Ganzes. Lassen Sie sich von Luhmanns Ideen inspirieren und hinterfragen Sie Ihre eigenen Annahmen über das Wesen des Sozialen. Wagen Sie den Blick hinter die Kulissen der gesellschaftlichen Konstruktion und erlangen Sie ein tieferes Verständnis für die Mechanismen, die unsere Welt im Innersten zusammenhalten. Diese kompakte und informative Darstellung macht Luhmanns komplexe Theorie zugänglich und eröffnet Ihnen neue Denkweisen über die Welt, in der wir leben.
Inhalt
1. Einleitung
2. Allgemeine Systemtheorie
2.1. Verwendung der Systemtheorie in der Soziologie
3. Luhmanns Theorie sozialer Systeme
3.1. Erste Phase der Theorieentwicklung: Die funktional-strukturelle Theorie
3.2. Zweite Phase der Theorieentwicklung: Autopoiesis
3.2.1. Verwendung der Autopoiesis in der Systemtheorie von Niklas Luhmann
3.2.2. Kommunikation
4. Zusammenfassung
1. Einleitung
Systemtheorie ist keineswegs ein Begriff, der nur aus der Soziologie stammt. Ursprünglich fand er vornehmlich in den Naturwissenschaften Verwendung. Zwar benutzten einige Philosophen, wie etwa Hegel, den Systembegriff, doch hatte deren Definition von System mit der heutigen Systemtheorie nur gemein, „daß der Begriff eine Ganzheit anspricht, deren Elemente in einer bestimmten Relation zueinander stehen.“ (Kneer / Nassehi 1997, S.18).
Erst später wurde der Begriff Systemtheorie in der Soziologie aufgegriffen; der wohl bekannteste soziologische Systemtheoretiker dürfte Talcott Parsons sein, der die strukturell-funktionale Theorie aufstellte.
Die Systemtheorie ist seinerzeit sehr populär geworden, wurde aber auch von verschiedener Stelle kritisiert. Niklas Luhmann, ein deutscher Soziologe, versucht seit den 60er Jahren eine eigenständige Systemtheorie zu formulieren. Er nahm die an Parsons formulierte Kritik auf und versuchte, die Systemtheorie an den bemängelten Stellen zu korrigieren. So entstand die inzwischen auch berühmte funktional- strukurelle Theorie, an der Luhmann bis heute arbeitet.
Die vorliegende Hausarbeit hat die Systemtheorie von Niklas Luhmann zum Gegenstand. Zum besseren Verständnis einiger Grundbegriffe in der Systemtheorie wird zunächst auf den in der Disziplin Biologie entstandenen allgemeinen Systembegriff eingegangen. Im Anschluß darauf folgt ein kurzer Überblick über das oben angesprochene Werk Parsons, bevor auf Luhmann selbst eingegangen wird.
Die Theorieentwicklung Luhmanns teilt sich in zwei Phasen auf.
In der ersten Phase entwickelt er die Grundlagen seiner Theorie. In der zweiten Phase greift Luhmann eine neue Entwicklung in der Systemtheorie auf, die wieder von der Biologie ausgeht: die Autopoiesis. Die vorliegende Arbeit setzt sich deshalb mehr mit der zweiten Phase der Theorieentwicklung auseinander. Ein weiterer Grund ist, daß Luhmann in seinem Spätwerk Grundbegriffe seiner Theorie, wie etwa ‚Kommunikation‘, zusammenfaßt.
Abschließend folgt eine Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse.
2. Allgemeine Systemtheorie
Erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand in der Biologie das, was man heute unter Systemtheorie versteht. Ausgangspunkt war die Kritik der Disziplin Biologie an der Disziplin Physik, welche die Welt deduktiv1 zu beschreiben versucht. Mag dieses Verfahren in der Physik gut anwendbar sein, da Einzelphänomene getrennt voneinander beobachtet werden können, sah sich die Biologie nicht imstande ihren eigentümlichen Gegenstand - das Leben - auf isolierte physikalische und chemische Vorgänge von Organismen zu reduzieren. (vgl. Kneer / Nassehi 1997, S. 18f).
Dies führte zu einem Paradigmenwechsel in der Biologie: vom Einzelphänomen zum System. Fortan wurden nicht die einzelnen Elemente des lebendigen Organismus getrennt voneinander untersucht, sondern das System ‚lebendiger Organismus‘: die Verknüpfungen und Abhängigkeiten der einzelnen Teile des Ganzen waren von nun an das Objekt der Forschung.
Bekannt gemacht hat diesen Paradigmenwechsel der Zoophysiologe Ludwig von Bertalanffy in seiner ‚Allgemeinen Systemtheorie‘ (um 1950). Sein Bestreben war, seine Theorie nicht nur in seiner Disziplin bekannt zu machen, sondern sie in der gesamten Wissenschaft zu verbreiten. Ihm war sehr wohl bewußt, daß gerade auch in der Soziologie die Systemtheorie zur Erklärung von gesellschaftlichen Zusammenhängen verwendet werden kann. (vgl. Kneer / Nassehi 1997, S.19).
Der wesentliche Gegenstand Bertalanffys Theorie ist „ die Organisationsform der komplexen Wechselbeziehung zwischen einzelnen Elementen.“ (Kneer / Nassehi 1997, S.21, Hervorhebung durch die Autoren). Er unterscheidet zwischen organisierter und unorganisierter Komplexität. Bei organisierter Komplexität stehen die Elemente in Wechselbeziehung zueinander; die unorganisierte Komplexität zeichnet aus, daß die Einzelphänomene linear verkettet sind und daß so ein Phänomen B von einem vorherigen Phänomen A abhängig ist.
Ebenso wichtig erscheint die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Systemen. Geschlossene Systeme verhalten sich nach Erreichen eines inneren Gleichgewichtszustands stabil und ändern sich fortan nicht mehr; Austauschbeziehungen mit der Umwelt des Systems finden nicht statt. Dem entgegen pflegt ein offenes System sehr wohl Austauschprozesse mit seiner Umwelt und erreicht nicht zwingend ein dauerhaftes inneres Gleichgewicht. Es ist ihm möglich, sich trotz systemexterner Zustandswechsel durch Veränderung der inneren Organisation am Leben zu erhalten.
Was das System aus einem äußeren Einfluß (Input) macht, ist nur an seiner Reaktion (Output) sichtbar. Verborgen bleibt dem Beobachter, was im Inneren des Systems geschieht, deshalb spricht man bei der Verarbeitung der Informationen von einem ‚black box‘-Verfahren. Offene Systeme werden zwar von außen beeinflußt, jedoch löst ein bestimmter äußerer Reiz nicht eine bestimmte Reaktion im Inneren aus. Demnach entscheidet allein das System (beziehungsweise die ‚black box‘), wie mit einem äußeren Einfluß umgegangen wird. Offene Systeme sind demnach selbstorganisierte Systeme. (vgl. Kneer / Nassehi 1997, S.21f).
2.1. Verwendung der Systemtheorie in der Soziologie
Einer der ersten Systemtheoretiker war der Amerikaner Talcott Parsons (1902-1979), der in den 30er Jahren seine strukturell-funktionale Theorie entwickelte. Nach dem 2.Weltkrieg - vor allem in den 50er Jahren - erlangte sie eine außergewöhnlich hohe Popularität in der Soziologie.
Zunächst soll hier auf dessen zentralen Begriffe Struktur und Funktion eingegangen werden.
Struktur (aus dem Lateinischen: ‘Ordnung‘) umschreibt „ein relativ stabiles, bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegendes Gefüge im Aufbau und Ablauf der Beziehungen zwischen (...) unterscheidbaren Elementen eines (...) nach ‚außen‘ abgrenzbaren Systems.“ (Hillmann 1994, S.846). Die Elemente eines Systems sind von kurzfristigen Schwankungen zwischen dem Innen und dem Außen unabhängig; Struktur ist demzufolge ein statischer Begriff. Im Gegensatz dazu sind die Funktionen dynamisch. Funktionen sind die sozialen Prozesse, die das System am Leben erhalten sollen.
Ein Systemtheoretiker bestimmt erst die Struktur eines sozialen Systems, um dann die Funktionen zu ermitteln. An einem Beispiel verdeutlicht heißt das, daß die Institution ‚Parlament‘ - ein Strukturelement im sozialen System - die Funktion hat, politische Entscheidung zu fällen (indem Gesetze verabschiedet werden). Damit ein System ‚funktioniert‘, bedarf es vier grundlegender Funktionen. Parsons machte diese vier Funktionen unter den Namen ‚AGIL‘- Schema bekannt, wobei jeder der Buchstaben die Abkürzung für den englischen Begriff der Funktion ist. ‚A‘ steht für adaption, ‚G‘ für goal attainment, ‚I‘ für integration und schließlich ‚L‘ für latent pattern maintenance.
Dies soll nun am Beispiel des Sozialsystems verdeutlicht werden:
Das ökonomische System dient dazu, sich der Umwelt anpassen und Ressourcen für das System bereitzustellen (‚A‘). Ziele zu definieren und nach Möglichkeiten deren Verwirklichung zu suchen (‚G‘) fällt in den Aufgabenbereich des Politischen Systems. Das obige Beispiel ‚Parlament‘ erfüllt demnach die Funktion ‚G‘. Außerdem müssen die Funktionen ‚I‘ und ‚L‘ erfüllt werden: dies übernehmen das Gemeinschaftssystem und das sozialkulturelle System.
3. Luhmanns Theorie sozialer Systeme
Niklas Luhmann wurde am 8.12.1927 in Lüneburg geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg übte er zunächst eine Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung aus. Erst 1960/61 studierte er Soziologie an der renommierten Harvard University. Im Anschluß darauf arbeitete Luhmann an verschiedenen Forschungseinrichtungen in Deutschland, etwa als Abteilungsleiter an der Sozialforschungsstelle in Dortmund (1965) und war zwischen 1977 und 1980 Mitherausgeber der ‚Zeitschrift für Soziologie‘. (vgl. Hillmann 1994, S.501).
Luhmann entwickelt seine Theorie sozialer Systeme seit den 60er Jahren. Im Laufe der Entwicklung verbesserte er seine Theorie ständig, so daß sich sein Werk in zwei Phasen aufteilen läßt. Einen erneuten Paradigmenwechsel in der Systemtheorie übernimmt Luhmann in seinem 1984 erschienen Buch ‚Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie'. Außerdem werden in diesem Werk die Grundbegriffe seiner Theorie genau erklärt. Mit ‚Soziale Systeme‘ beginnt die zweite Phase der Theorieentwicklung. Zunächst soll auf die in den 60er Jahren entwickelten Ansätze eingegangen werden.
3.1. Erste Phase der Theorieentwicklung: Die funktional-strukturelle Systemtheorie
Zu Recht erinnert die Bezeichnung funktional-strukturelle Systemtheorie stark an Parsons. Luhmann lag es daran, Parsons Theorie in seinen entscheidenden Schwachstellen zu verbessern. Kritiker der strukurell- funktionalen Theorie unterstellen, daß Parsons sozialen Wandel und Konflikt unterschlägt. Dies kommt dadurch zustande, daß die Theorie von Strukturen ausgeht und anschließend die Funktionen untersucht, die geleistet werden müssen, um das System am Leben zu erhalten. Luhmann versucht dies zu verbessern, indem er den Funktionsbegriff dem der Struktur überordnet. Dadurch will er Parsons in zwei wichtigen Punkten berichtigen:
Zum ersten, daß soziale Systeme über differenzierte Wertorientierungen verfügen. Durch die Rückstellung des Strukturbegriffs müssen soziale Systeme nicht durch ein bestimmtes Strukturmuster geprägt sein. Miteinander verknüpfte Handlungen von Personen bilden dann ein System mit einer bestimmten Wertorientierung. Alle mit diesem System nicht verknüpften Handlungen bilden die Umwelt dieses Systems.
Zum zweiten geht Luhmann davon aus, daß soziale Systeme nicht auf unabdingbar vorhandene Funktionen angewiesen sind, sondern daß sie durch alternative Leistungen ersetzt werden können. Diese Idee ist jedoch nicht neu. Schon Robert K. Merton, ein Schüler von Parsons, stellte in seiner ‚Paradigm for Functional Analysis in Sociology‘ klar, daß durch die Aufgabe der Annahme, daß bestimmte soziale Strukturen unentbehrlich sind, ebenso auch ein Begriff der funktionalen Alternative gebraucht wird. (vgl. Merton 1996 [1949], S.84).
Bildet bei Parsons der Bestand sozialer Systeme die oberste Bezugseinheit der Analyse, so ist es bei Luhmann die ‚Welt‘. Anders als man zunächst annehmen könnte ist die Welt jedoch nicht das größte aller Systeme - ganz im Gegenteil. Sie bildet kein System, da sie kein Außen besitzt. Zu einem System gehört immer ein Inneres und ein Äußeres. Bei der Welt sind diese Bedingungen nicht gleichzeitig erfüllt. Doch nicht die Welt ‚an sich‘, sondern genauer gesagt die Komplexität der Welt ist die oberste Analyseeinheit der funktional-strukturellen Theorie. ‚Komplex‘ meint zunächst, daß ein Gegenstand zumindest zwei Zustände annehmen kann. Die ‚Welt‘ verfügt aber natürlich über mehr als nur zwei Zustände; man kann sagen, daß sie unbestimmbar viele Zustände annehmen kann. Die Aufgabe sozialer Systeme besteht darin, diese Komplexität der Welt auf ein für den Mensch annehmbares Maß zu reduzieren, da er durch die unzählig vielen Zustände ständig überfordert ist. Sie vermitteln zwischen der Komplexität der Welt und dem Maß an Komplexität, die der Mensch verarbeiten kann, indem sie bestimmte Zustände der Welt ausschließen und im System nicht vorkommen lassen. (vgl. Kneer / Nassehi 1997, S.40f).
Luhmann unterscheidet drei Typen von sozialen Systemen:
In ‚Interaktionssystemen‘ handeln Personen, die sich gegenseitig wahrnehmen können. Ein Beispiel für ein solches Interaktionssystem ist das Handeln von Kunden und Händler in einem Kaufhaus. So gehört der Kauf einer Ware, das Verkaufsgespräch des Händlers und so weiter zum Innen des Systems, während alles, was sich vor der Tür des Kaufhauses abspielt, dessen Umwelt ist. Das Interaktionssystem ist dann beendet, wenn die Handelnden auseinandergehen. Das ist spätestens dann der Fall, wenn der Händler abends seinen Laden schließt.
Den zweiten Typ bilden die ‚Organisationssysteme‘. Die Mitgliedschaft in jenen Systemen sind an Bedingungen geknüpft, etwa wie die Mitgliedschaft in einem Sportverein. Es lassen sich verschiedene Gruppen innerhalb diese Gefüges unterscheiden ( Vereinsfunktionär, Trainer, Schiedsrichter und so weiter). Innerhalb des Systems sind Handlungsabläufe geregelt, die man so in der Umwelt des System nicht annehmen darf. So ist es im Training einer Fußballmannschaft durchaus legitim und gewollt, wenn der Trainer seine Spieler dazu auffordert, seinen Anweisungen nachzugehen. In der Umwelt des Systems ‚Sportverein‘ hat der Trainer diese Kompetenzen nicht mehr; er kann von einem Spieler, den er zufällig auf der Straße trifft, nicht das verlangen, was er im Sportverein von ihm verlangen könnte - erst Recht nicht kann er dies von einem Nicht-Mitglied.
Unter dem letzten Typ ‚Gesellschaftssystem‘ versteht Luhmann das größte soziale System. Alle Interaktions- und Organisationssysteme sind Teil der Gesellschaft. Aber sie ist an sich kein Interaktionssystem, da jeder zur Gesellschaft gehört - auch die Menschen, die nicht gerade miteinander handeln - und sie ist ebenso kein Organisationssystem, da die Mitgliedschaft in der Gesellschaft nicht an formelle Bedingungen geknüpft ist. (vgl. Kneer / Nassehi 1997, S.42f).
3.2. Zweite Phase der Theorieentwicklung: Autopoiesis
Das Schlagwort Autopoiesis bezeichnet einen erneuten Paradigmenwechsel in der Systemtheorie. Wieder ist es die Biologie, in der dieser Durchbruch erreicht wurde.
Das Konzept der Autopoiesis geht auf die beiden chilenischen Biologen Francisco J. Varela und Humberto R. Maturana zurück. Der Begriff ist ein von ihnen erschaffenes Kunstwort; es setzt sich aus den griechischen Worten autos (für ‚selbst‘) und poiein (für ‚machen‘) zusammen. Frei übersetzt bedeutet der Begriff demnach soviel wie ‚Selbstherstellung‘. (vgl. Kneer / Nassehi 1997, S.47f).
Autopoietische Systeme sind selbstherstellende und selbsterhaltende Systeme. Dies geschieht, indem die zur Erhaltung des Systems notwendigen Bestandteile vom System selbst ständig reproduziert werden. Sie stehen im Austausch mit der Umwelt, welche die für die Systemerhaltung benötigten Ressourcen stellt.
Autopoietische Systeme operieren selbstreferentiell2 ; sie öffnen sich der Umwelt nur für die Ressourcenaufnahme. Deshalb definiert man autopoietische Systeme als geschlossene Systeme.
Dies läßt sich am Beispiel einer Zelle verdeutlichen:
Eine Zelle ist durch ihre Zellwand optisch deutlich von ihrer Umwelt getrennt. Im Inneren der Zelle werden die zur Systemerhaltung benötigten Bestandteile, etwa Proteine und Lipide, hergestellt. Um diese Substanzen herstellen zu können bedarf es jedoch an Ressourcen, welche die Zelle der Umwelt entzieht. (vgl. Kneer / Nassehi 1997, S.50f).
Wie man am Beispiel der Zelle sieht, sind autpoietische Systeme zwar autonom, aber nicht autark. Autark wären sie, wenn die den Austausch mit der Umwelt nicht benötigten.
Maturana und Varela beziehen den Begriff der Autopoiesis nur auf lebende Organismen: „Nicht-lebende Maschinen sind hingegen keine autopoietischen Systeme, sie sind vielmehr allopoietisch 3 organisiert. (...) Alle Lebewesen, aber auch nur sie, sind autopoietisch organisiert.“ (Kneer / Nassehi 1997, S.49; Hervorhebung durch die Autoren). Aus dem Grund sprechen sich die beiden Biologen dagegen aus, das von Ihnen formulierte Paradigma auf soziale Systeme anzuwenden.
3.2.1. Die Verwendung der Autopoiesis in der Systemtheorie von Niklas Luhmann
Entgegen der Empfehlung von Maturana und Varela benutzt Luhmann den Autopoiesis-Begriff jedoch sehr wohl in seiner Systemtheorie. Er begreift fortan soziale Systeme als selbstreferentielle, autopoietische Systeme. Die Anwendung des neuen Paradigmas läutet die zweite Phase seiner Theorieentwicklung ein.
Um die Autopoiesis in seine Theorie einzubringen, hielt es Luhmann für notwendig den Begriff zu generalisieren. Er benutzt einen allgemeinen Autopoiesis-Begiff zur Beschreibung unterschiedlicher Systemarten, wie etwa psychische und soziale Systeme.
Am Beispiel von Bewußtseinssystemen zeigt Luhmann, daß diese autopoietisch operieren. Die kleinsten Einheiten in jenen Systemen sind ‚Gedanken‘. Diese werden ständig aufs Neue reproduziert, da sie, kaum daß sie aufgetaucht sind, auch schon wieder verschwunden sind. Damit das Bewußtseinssystem imstande ist, Gedanken herzustellen, bedarf es an Ressourcen: ohne ständige Sauerstoffzufuhr, um nur ein Beispiel zu nennen, könnte das Gehirn nicht arbeiten. Diese Ressourcen verschafft sich das System von seiner Umwelt.
Nun darf man aber nicht annehmen, daß das Gehirn an sich Gedanken herstellt; dies macht das Bewußtseinssystem. Jedoch ist das Bewußtseinssystem auf Gehirntätigkeiten angewiesen; diese Beiträge sind Voraussetzung für die Gedankenproduktion. Trotzdem arbeiten Bewußtsein und Gehirn isoliert voneinander und sind füreinander Umwelt.
Dieses Abhängigkeitsverhältnis bezeichnet Luhmann als ‚strukturelle Kopplung‘. (vgl. Kneer / Nassehi 1997, S.58ff).
3.2.2. Kommunikation
Wendet man den Autopoieseis-Begriff auf soziale Systeme an, so sind deren kleinsten Benstandteile Kommunikationen. Dies ist insofern bemerkenswert, als daß in der soziologischen Tradition stets der Mensch das letzte, nicht auflösbare Teil des Sozialsystems war. Nach Luhmann hingegen besteht der Mensch selbst aus einer Reihe von Systemen: Das organische System, das Nervensystem, das Bewußtseinssystem und so weiter. So läßt sich auch seine plakative Aussage „Nur die Kommunikation kann kommunizieren" (Luhmann 1995, S.113) erklären. Es ist kein Produkt menschlichen Handelns, da die unterschiedlichen Systeme des Menschen keine kommunikativen Beziehungen zu den Systemen eines anderen Menschen aufnehmen können. Das geht deshalb nicht, da organische, neurale und physische Systeme geschlossen sind (sie sind autopoietische Systeme), und so einen direkten Kontakt zu einem anderen System unmöglich machen. Um nun Kommunikation zu ermöglichen, bedarf es einer neuen Art von Systemen: den sozialen Systemen. Jene sind ebenso autopoietisch organisiert, was bedeutet, daß ständig Kommunikation an Kommunikation anschließen muß, damit das System erhalten bleiben kann.
Natürlich kann Kommunikation nicht ohne Menschen funktionieren; ohne organische, neurale und psychische Systeme ist das Bestehen von Kommunikation nicht denkbar. Trotzdem darf nicht angenommen werden, daß diese Systeme Kommunikation herstellen. Sie sind nur ein funktionales Erfordernis für soziale Systeme. Außerdem sind immer mindestens zwei Menschen vonnöten, da das soziale System nicht bestehen kann, wenn nicht jeder Kommunikation eine weitere folgen würde. So ist es ausgeschlossen, daß ein Mensch mit sich selbst kommuniziert. (vgl. Kneer / Nassehi 1997, S.65ff)
Eine Sonderstellung innerhalb der für die Kommunikation benötigten Systeme bildet das psychische System, welches als einziges in der Lage ist, Kommunikation zu beeinflussen. Es kann das Kommunikationssystem reizen, stören oder irritieren, ohne daß es ihm zugänglich wäre; es liegt eine strukturelle Kopplung vor: „keine Kommunikation ohne Bewußtsein und kein Bewußtsein ohne Kommunikation“ (Kneer / Nassehi 1997, S. 71).
Um diese abstrakten Behauptungen zu veranschaulichen, folgt nun ein Beispiel:
In einer Stadtratsdebatte kommuniziert gerade die Kommunikation über den Neubau eines Fußballstadions. Abgeordneter Müller, welcher immer schon wenig für Sport übrig hatte, ist mit seinen Gedanken jedoch längst im Urlaub in der Karibik.
Im nächsten Moment kann er sich aber auch schon wieder auf die Diskussion zurückbesinnen und an der Kommunikation beteiligen; er kann die Kommunikation stören, reizen oder irritieren. Das Bewußtseinssystem des Abgeordneten wird durch die Kommunikation wiederum selbst irritiert, da die Kommunikation sein Bewußtseinssystem dazu veranlaßt, ständig Nachfolgegedanken herzustellen.
Zwar erzeugt das soziale System ständig Kommunikation und das Bewußtseinssystem ständig Gedanken, doch läßt sich aus der Kommunikation nicht erschließen, was die beteiligten Bewußtseinssysteme im Laufe der Kommunikation denken. Daß Abgeordneter Müller während der Diskussion schon von seinem Urlaub träumt, bleibt den anderen Bewußtsseinssystemen verschlossen, da jene Systeme nicht miteinander kommunizieren können. Kommunikation kann ausschließlich auf der Ebene des sozialen Systems stattfinden. Deshalb ist es „unmöglich, in die Köpfe unserer Kommunikationspartner hinein zu sehen, wir werden niemals - auch mit Hilfe der Kommunikation nicht - erfahren, was sie denken.“ (Kneer / Nassehi 1997, S.72).
Luhmann beschreibt Kommunikation als ein Auswahlverfahren, in dem ‚Information‘, ‚Mitteilung‘ und ‚Verstehen‘ miteinander kombiniert werden müssen. Kommunikation besteht erst, wenn alle drei Leistungen erbracht sind.
Wieder läßt sich das am einfachsten an einem Beispiel zeigen: Ein Mann trifft einen alten Bekannten in der Stadt. Er sagt zu ihm: „Na hallo, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen! Wie geht es Dir denn so?“.
Die Begrüßung des Mannes enthält die Information, daß er zu einem Gespräch mit seinem alten Bekannten bereit ist. Die Floskel ‚Wie geht es Dir denn so?‘ deutet seinem Gegenüber an, daß er nun an der Reihe ist, etwas zu sagen. Auch diese Frage beinhaltet Information, nämlich die, daß der Mann eine Anschlußkommunikation erwartet. Der Mann hätte seinem Bekannten diese Informationen jedoch auch anders mitteilen können. Er hätte auch sagen können: „Kannst Du Dich noch an mich erinnern?“. Im Grunde ist die Information dieselbe geblieben. Es gibt eine große Auswahlmöglichkeit, wie man die Information einem anderen mitteilt.
Bevor man von Kommunikation sprechen kann, ist zudem ein Verstehen nötig.
Der Bekannte muß durch eine Anschlußkommunikation zeigen, daß die Information verstanden wurde. Er könnte beispielsweise sagen: „Mir geht es gut, ich kann nicht klagen.“ Wie man sich leicht vorstellen kann, ist auch hier eine große Auswahlmöglichkeit gegeben.
Verstehen bedeutet allerdings nicht, daß notwendigerweise der Sinn der vorangegangen Aussage von dem Bekannten verstanden wurde. Es bedeutet nur, daß diese für den Bekannten anschlußfähig ist. Hätte er geantwortet „heute ist Mittwoch“, dann wären die von Luhmann gestellten Bedingungen für Kommunikation auch erfüllt gewesen. Natürlich ist die Gefahr dann sehr groß, daß die Aussage des Bekannten für den Freund nicht mehr anschlußfähig ist, und daß sich das soziale System auflöst, weil dieser kopfschüttelnd weitergeht.
Die Kommunikation versteht sich selbst als Handlungssystem, obwohl sie keines ist. Sie faßt sich selbst als „Mitteilungshandlung“ (Kneer / Nassehi 1997, S.88) auf, das heißt, daß sie so verfährt als bestünde sie nur aus einer Mitteilung, obwohl sie, wie oben erklärt, noch ‚Information‘ und ‚Verstehen‘ beinhalten muß. Diese Vereinfachung auf nur eine der drei erforderlichen Leistungen ermöglicht es, Kommunikation als Handlung zwischen mehreren Personen aufzufassen. Dies hat den Sinn, daß „Anknüpfungspunkte für weitere Kommunikationen“ (Kneer / Nassehi 1997, S.88) gebildet werden. Das hat wiederum zur Folge, daß eine Anschlußkommunikation die vorangegangene Kommunikation als Handlung auffaßt.
Dabei darf folgendes nicht vergessen werden: „Daß der Mensch etwas mitteilt oder kommuniziert, ist einzig eine kommunikative Behauptung“ (Kneer / Nassehi 1997, S.90). Der Mensch kann Kommunikation nicht bewußt herbeiführen; er ist nicht der Urheber der Kommunikation. Wir wollen uns an Luhmanns Aussage erinnern, der behauptet, daß nur die Kommunikation kommunizieren kann.
4. Zusammenfassung
Luhmanns Systemtheorie ist eine Theorie, die den Anspruch hat, den gesamten Gegenstandsbereich der Soziologie erklären zu können.
Soziologie ist nach Luhmann „‘die Wissenschaft von sozialen Systemen‘“ (Luhmann 1967, S.113, zitiert nach Kneer / Nassehi 1997, S.33), was demnach bedeutet, daß jede Art von ‚Sozialem‘ - sei es Handeln, Kommunikation und so weiter - ein soziales System darstellt. An sich ist der systemtheoretische Ansatz nicht neu (siehe Parsons), aber die Verwendung des Autopoiesis-Begriffs in der soziologischen Systemtheorie und die damit verbundene Behauptung, daß nicht Menschen, sondern Kommunikationen die kleinsten Teile eines Sozialsystems sind, beweisen Eigenständigkeit und Mut. Kneer und Nassehi finden diese Entwicklung gar sensationell, denn sie sind der Meinung, daß „eine solche Auffassung fast der gesamten philosophischen und soziologischen Tradition widerspricht.“ (Kneer / Nassehi 1997, S.65).
Wie schon mehrfach erwähnt, arbeitet Luhmann seit nunmehr über dreißig Jahren an seiner Theorie sozialer Systeme. In dieser Zeit hat haben sich die Arbeiten zu diesem Thema angehäuft; sein Werk ist komplex, differenziert und „selbst für Eingeweihte nur schwer zu überschauen“ (Kneer / Nassehi 1997, S.33). Natürlich ist es unmöglich, Luhmanns gesamten Ideen und Ansätze in einer solchen Hausarbeit zusammenzufassen. Zum Beispiel wurde das ‚Beobachten‘, ein weiterer Grundbegriff in Luhmanns Theorie, gar nicht behandelt, und die behandelten Themen sind verkürzt dargestellt. In vorliegender Hausarbeit wurde versucht, einen groben Überblick über die Systemtheorie - und dabei besonders Luhmanns Beitrag zu diesem Thema - zu verschaffen.
Literaturliste
Hillmann, Karl-Heinz 1994: Wörterbuch der Soziologie, Stichwörter: „Luhmann“ und „Strukur“, 4., überarbeitete Auflage, Stuttgart: Kröner Verlag
Kneer, Georg / Nassehi, Armin 1997: Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung, 3. Auflage, München: Wilhelm Fink Verlag
Luhmann, Niklas 1995: Soziologische Aufklärung, Band 6: Die Soziologie und der Mensch, Opladen: Westdeutscher Verlag
Merton, Robert K. 1996 [1949]: Paradigm for Functional Analysis in Sociology. In: Ders.: On Social Structure and Science. London, Chicago: The University of Chicago Press, S.85-96
[...]
1 deduktiv: den Einzelfall aus dem Allgemeinen ableiten
2 „auf sich selbst bezogen“, „selbstbezüglich“
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über Luhmanns Systemtheorie?
Dieses Dokument ist eine Hausarbeit, die sich mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann auseinandersetzt. Es beginnt mit einer Einleitung in die Systemtheorie im Allgemeinen, gefolgt von einer Erläuterung der allgemeinen Systemtheorie, wie sie in der Biologie entstanden ist. Anschließend wird Luhmanns Theorie sozialer Systeme vorgestellt, wobei die Entwicklung in zwei Phasen unterteilt wird: die funktional-strukturelle Theorie und die Theorie der Autopoiesis. Das Dokument schließt mit einer Zusammenfassung und einem Literaturverzeichnis ab.
Was ist Systemtheorie und woher stammt sie?
Systemtheorie ist ein Konzept, das ursprünglich aus den Naturwissenschaften, insbesondere der Biologie, stammt. Sie befasst sich mit der Untersuchung von Systemen als Ganzheiten, deren Elemente in Beziehung zueinander stehen. Ludwig von Bertalanffy trug maßgeblich zur Verbreitung der allgemeinen Systemtheorie bei.
Wer war Niklas Luhmann und was ist seine Theorie sozialer Systeme?
Niklas Luhmann war ein deutscher Soziologe, der eine eigenständige Systemtheorie entwickelte. Seine Theorie befasst sich mit der Funktionsweise sozialer Systeme und wie sie Komplexität reduzieren. Er unterteilte die Theorieentwicklung in zwei Phasen: die funktional-strukturelle Systemtheorie und die Autopoiesis.
Was ist der Unterschied zwischen Luhmanns funktional-struktureller Systemtheorie und der strukturell-funktionalen Theorie von Parsons?
Luhmann versuchte, die Theorie von Parsons in ihren Schwachstellen zu verbessern. Kritiker warfen Parsons vor, sozialen Wandel und Konflikte zu vernachlässigen. Luhmann ordnet den Funktionsbegriff dem der Struktur über, um zu betonen, dass soziale Systeme differenzierte Wertorientierungen haben und Funktionen alternativ ersetzt werden können. Bei Luhmann ist die 'Welt' die oberste Bezugseinheit, deren Komplexität durch soziale Systeme reduziert wird.
Was versteht Luhmann unter Interaktions-, Organisations- und Gesellschaftssystemen?
Luhmann unterscheidet drei Typen von sozialen Systemen: Interaktionssysteme (Handeln von Personen, die sich gegenseitig wahrnehmen), Organisationssysteme (Mitgliedschaft an Bedingungen geknüpft, geregelte Handlungsabläufe) und Gesellschaftssystem (größtes soziales System, umfasst alle Interaktions- und Organisationssysteme).
Was bedeutet Autopoiesis und wie wird sie in Luhmanns Theorie verwendet?
Autopoiesis, ursprünglich von Maturana und Varela entwickelt, bezeichnet selbstherstellende und selbsterhaltende Systeme. Luhmann verwendet den Begriff, um soziale Systeme als selbstreferentielle, autopoietische Systeme zu beschreiben. Er generalisiert den Autopoiesis-Begriff, um verschiedene Systemarten wie psychische und soziale Systeme zu beschreiben.
Was ist die Rolle der Kommunikation in Luhmanns Theorie?
In Luhmanns Theorie sind Kommunikationen die kleinsten Bestandteile sozialer Systeme. Er argumentiert, dass "nur die Kommunikation kommunizieren kann". Kommunikation ist ein Auswahlverfahren, in dem 'Information', 'Mitteilung' und 'Verstehen' kombiniert werden müssen.
Was ist strukturelle Kopplung nach Luhmann?
Strukturelle Kopplung bezeichnet das Abhängigkeitsverhältnis zwischen verschiedenen Systemen, beispielsweise zwischen Bewusstseinssystem und Gehirn. Das Bewusstseinssystem ist auf Gehirntätigkeiten angewiesen, diese sind Voraussetzung für die Gedankenproduktion, aber Bewusstsein und Gehirn arbeiten isoliert voneinander und sind füreinander Umwelt.
Warum kann man laut Luhmann nicht "in die Köpfe" der Kommunikationspartner sehen?
Weil Kommunikation ausschließlich auf der Ebene des sozialen Systems stattfindet. Die Bewusstseinssysteme der beteiligten Personen können nicht direkt miteinander kommunizieren, daher bleibt verschlossen, was diese während der Kommunikation denken.
- Quote paper
- Olgierd Cypra (Author), 2000, Die Systemtheorie von Niklas Luhmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96681