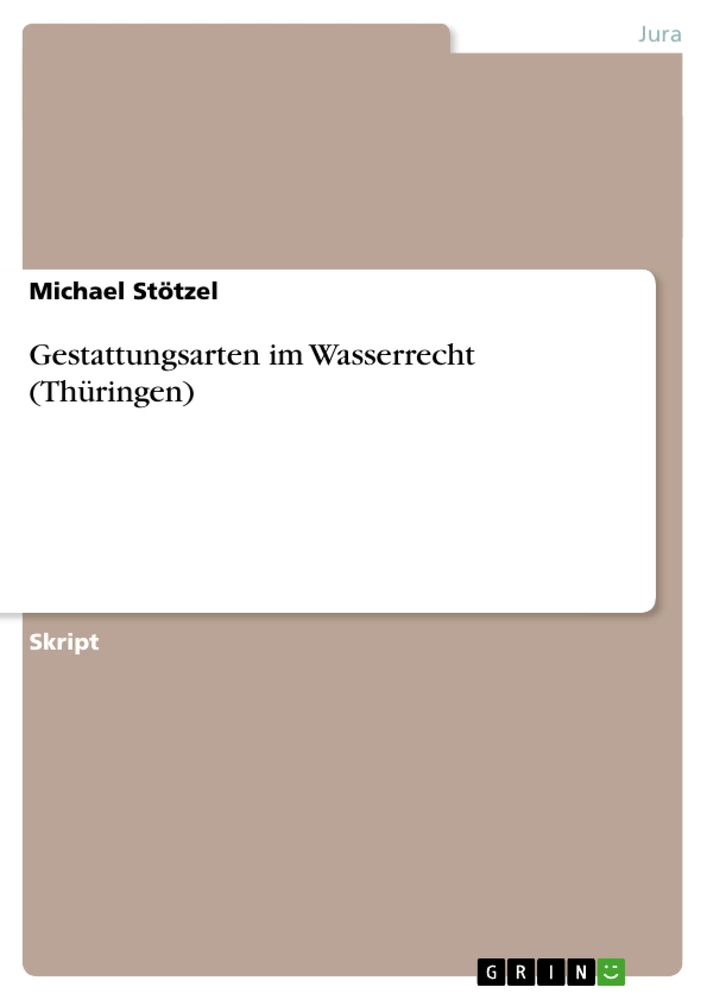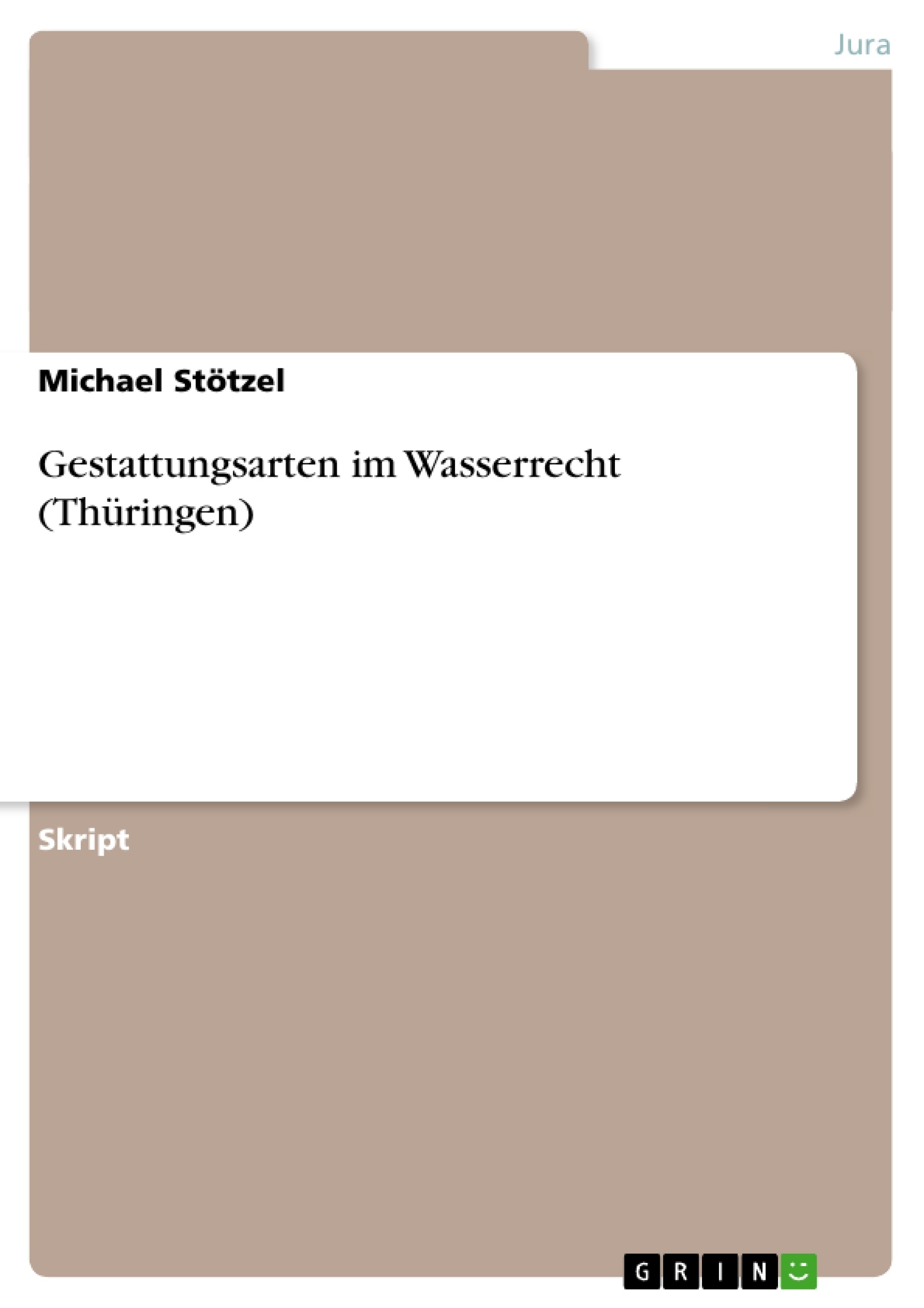ARTEN DER WASSERRECHTLICHEN GESTATTUNGEN IM FREISTAAT THÜRINGEN
1 Bewilligung
1.1 Begriff und Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage der Bewilligung ist § 8 i.V.m. § 6 WHG. Die Bewilligung gewährt das Recht, ein Gewässer in einer nach Art und Maß bestimmten Weise zu benutzen. Demnach muss der Grundtatbestand der Benutzung (§ 3 WHG, § 15 ThürWG) vorliegen.
1.2 Tatbestandsvoraussetzungen
1.2.1 Kein Bewilligungsausschluss gegeben
Das Wasserhaushaltsgesetz sieht in § 8 Abs. 2 Satz 2 vor, dass für das Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewässer (§ 3 Abs. 1 Nr. 4, 4a, 5 WHG), sowie für die unechte Benutzung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG keine Bewilligung erteilt werden darf. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 2 ThürWG für die landesrechtlichen Benutzungen im Sinne des § 15 Abs. 1 ThürWG. Wichtig ist dabei jedoch noch., dass nach § 8 Abs. 2 Satz 3 WHG dieser Bewilligungsausschluss nicht für das Wiedereinleiten von nicht nachteilig verändertem Triebwasser bei Ausleitungskraftwerken gilt (in Bezug auf § 3 Abs. 1 Nr. 4, 4a, 5 WHG ⇒ Wasserkraftwerke).
Sofern eine dieser Benutzungen vorliegt, darf demnach keine Bewilligung erteilt werden. Vielmehr muss in einem weiteren Schritt geprüft werden, ob eine der schwächeren Gestattungen in Form der gehobenen Erlaubnis bzw. der Erlaubnis erteilt werden kann.
1.2.2 Investitionsschutzbedürfnis des Antragstellers
Das Investitionsschutzbedürfnis ergibt sich aus § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG. Es dient dem Antragsteller, da die Bewilligung zum Beispiel bei der Neueinrichtung einer wasserrechtlichen Anlage oftmals als Sicherheit bei Banken gefordert wird. Bei der Errichtung wasserrechtlicher Anlagen, die mit hohen Investitionen bzw. Krediten verbunden sind, ist das Investitionsschutzbedürfnis regelmäßig gegeben.
1.2.3 Planmäßiges Vorgehen bei der Verwirklichung der Benutzung
Das planmäßige Vorgehen bei der Verwirklichung der Benutzung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG meint den Plan für die konkrete Nutzung der Bewilligung. Wenn eine Bewilligung für die Nutzung von 10.000 Liter Was- ser je Tag erteilt werden soll, muss aus dem Plan hervorgehen, dass man die 10.000 Liter pro Tag auch nutzen kann. Damit will man sicherstellen, dass einerseits unverzüglich nach Erteilung der Bewilligung mit der Benut- zung begonnen wird und andererseits, dass die Bewilligung auch komplett ausgenutzt wird. Grund dafür ist die strenge Reglementierung im Wasserrecht und die damit verbundene starke Kontrolle. Dies ist für die behördliche Planung unumgänglich. Eine Gestattung auf Vorrat ist mithin nicht möglich. Sofern sich die Nutzungsmenge nachträglich verringert, ist auch ein Teilwiderruf der Bewilligung hinsichtlich der Wassermenge denkbar.
1.2.4 Keine Beeinträchtigung bzw. Verletzung von Rechten Dritter und keine Verletzung von Interessen Dritter
Das bloße Vorliegen einer Rechtsverletzung reicht nicht aus, man muss diese auch geltend machen. Rechts in diesem Sinne sind absolute Recht (Rechte, die gegen jeden wirken und auch von jedem zu beachten sind), wie zum Beispiel das Eigentum, die Fischereirechte, das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und nicht zu vergessen auch bereits erteilte Bewilligungen, den sie gewähren ja ein solches Recht. Sofern man im Wege der Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass eine Rechtsverletzung vorliegt und dagegen Einwendungen erhoben worden sind, so ist die Teilprüfung beendet. Anderenfalls folgt die Prüfung einer mögli- chen Interessenverletzung (§ 22 ThürWG), wobei auch diese bei der Behörde geltend gemacht werden muss.
1.2.5 Keine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit
Nach § 6 Abs. 1 WHG ist die Bewilligung zu versagen, soweit von der beabsichtigten Benutzung eine Beein- trächtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung, zu erwarten ist, die nicht durch Auflagen verhütet oder ausgeglichen wird. Man unterscheidet dabei in das wasser- wirtschaftliches und in das außerwasserrechtliche Wohl der Allgemeinheit, wobei beide berücksichtigt werden müssen.
1.2.5.1 Wasserwirtschaftliches Wohl der Allgemeinheit
Erste Konkretisierung des wasserwirtschaftlichen Wohls der Allgemeinheit ist dabei im Verbot der Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung zu sehen (§ 6 Abs. 1 WHG). Daraus resultieren drei Prinzipien: 1. schonen- der Umgang mit dem knappen Wasserdargebot, 2. geringst mögliche Belastung durch Schadstoffe und 3. Erhaltung der Qualität des Grundwassers für die Trinkwasserversorgung. Ob diese Prinzipien eingehalten werden, geht aus den entsprechenden Gutachten der Fachämter hervor.
Zweite Konkretisierung kann in den Anforderungen an das Einleiten von Abwasser des § 7a WHG in Verbin- dung mit der Abwasserverordnung gesehen werden. Demnach muss eine Anlage dem Stand der Technik entsprechen. Die Abwasserverordnung (beachte die Übergangsvorschriften dazu) bestimmt dabei welche Stoffe und in welcher Konzentration diese Stoffe eingeleitet werden dürfen. Die gesetzlichen Grenzwerte müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf verwiesen, dass es hier um die Einlei- tung geht, woraus sich ergibt, dass dieser Punkt nur bei der Erlaubnis bzw. der gehobenen Erlaubnis zu prüfen ist. Die Bewilligung ist infolge des gesetzlichen Ausschlusses für den Tatbestand Einleiten nicht zulässig (§ 8 Abs. 2 WHG).
1.2.5.2 Außerwasserrechtliches Wohl der Allgemeinheit
Ein Gesichtspunkt dieses Punktes ist der Schutz von Leben und Gesundheit der Menschen. Anderer ist der Punkt, dass neben dem Wasserrecht bestehenden Rechtsgebiete, wie z.B. das Naturschutzrecht, das Immissionsschutzrecht oder das Baurecht, nicht verletzt werden dürfen. Daraus resultiert die Tatsache, dass eine wasserrechtliche Nutzung nicht gegen andere einschlägige Fachgesetze verstoßen darf und diese im Rahmen der Gestattung entsprechend durch die Fachämter anhand des einzelnen Vorhabens zu prüfen sind.
1.2.6 Keine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme
Das Gebot der Rücksichtnahme stammt aus der Rechtsprechung und wurde aus dem Baurecht übernommen. Es setzt sich aus den folgenden Teilkomponenten zusammen.
Es ist ein Abwehranspruch der vorhandenen Nutzer gegen neue Nutzungen, die sie unverhältnismäßig belasten. Es verhindert somit die schutzlose Auslieferung im Hinblick auf § 2 Abs. 2 WHG und führt zu dessen Ein- schränkung.
Mithin ist es möglich, dass bei einer Einschränkung der bisherigen Nutzung zwar keine Rechtsverletzung vor- liegt, die neue Nutzung nach dem Gebot der Rücksichtnahme dennoch unzulässig und damit zu versagen ist.
1.2.6.1 Rücksichtnahme
Jede neue Gewässerbenutzung muss auf bereits vorhandene Gewässerbenutzungen Ricksicht nehmen.
1.2.6.2 Maß der Rücksichtnahme
Das Maß der Rücksichtnahme ergibt sich aus dem konkreten Einzelfall. Dabei gilt, je unabweisbarer die neue Nutzung ist, desto weitergehendere Einschränkungen sind für bestehende Nutzungen möglich (Bedeutung der neuen Nutzung). Der Umkehrfall, d.h. je unbedeutender die neue Nutzung ist, desto weniger Einschränkungen sind für die bestehende Nutzung möglich, gilt entsprechend (Bedeutung der alten Nutzung).
1.2.6.3 Nachbarschutz
Das Gebot der Rücksichtnahme ist nachbarschützend für alle Nutzer, die von der neuen Nutzung qualifiziert und individualisierbar betroffen sind.
1.2.6.3.1 Qualifizierte Betroffenheit
Die Beeinträchtigung muss messbar und merklich sein, d.h. bei ca. 20 - 30 % Minderung (Richtwert) bzw. bei starker Einschränkung der Benutzung. Eine Wertlosigkeit (d.h. Rechtsverletzung vorhanden) der bestehenden Bewilligung ist nicht erforderlich.
1.2.6.3.2 Individualisierbare Betroffenheit
Der Kreis der qualifiziert betroffenen Nutzer muss abgrenzbar sein, d.h. es muss erkennbar sein, welche Nutzer genau betroffen sind.
1.3 Rechtsfolge
Sofern eine der Tatbestandsvoraussetzungen nicht vorliegt, ist die Bewilligung nach § 6 Abs. 1 WHG zu versa- gen. Hierbei handelt es sich um eine gebunden Entscheidung. Einen Anspruch auf Erteilung einer Bewilligung auch bei Vorliegen aller Tatbestandsvoraussetzungen besteht nicht (BVerfG Entscheidung vom 15.07.1981, AZ: 1 BvL 77/78). Es handelt sich um ein repräsives Verbot, woraus eine rein behördliche Ermessensentscheidung resultiert.
1.4 Nebenbestimmungen
Nach § 4 WHG sind Benutzungsbedingungen und Auflagen grundsätzlich möglich. § 16 ThürWG enthält Rege- lungen zu dieser Problematik. Bei einer solchen Auflage handelt es sich um eine Auflage im Sinne von § 36
ThürVwVfG. Bedingungen in o.g. Sinne hingegen sind keine Bedingungen im Sinne des § 36 ThürVwVfG, sondern verstehen sich eher als eine Art Inhaltsbestimmung (Benutzungsbedingungen). Darüber hinaus sind Bewilligungen nach § 8 Abs. 5 WHG zu befristen, wobei die Frist nur ausnahmsweise län- ger als 30 Jahre sein darf. Ungeachtet der grundsätzlichen Möglichkeit Nebenbestimmungen zu treffen, sind in der Bewilligung weder der Widerrufsvorbehalt, noch eine auflösende Bedingung möglich. Grund dafür ist in der Natur der Bewilligung zu sehen - sie gewährt ein Recht und ist nicht bloß eine einfache Erlaubnis.
1.5 Rücknahme und Widerruf
Die Rücknahme einer rechtswidrigen Bewilligung erfolgt mangels Spezialvorschrift nach § 48 ThürVwVfG. Ein Widerruf einer Bewilligung kann nur über die Spezialnorm des § 12 WHG erfolgen. Der Widerruf kann nur für den Fall erfolgen, dass sich der Betroffenen nicht an die Regelungen der Bewilligung hält.
1.6 Verfahren
Nach § 9 WHG muss ein solches Verfahren durchgeführt werden, indem sowohl Bürger als auch Behörden Einwendungen gegen ein Vorhaben einbringen können. Das Land Thüringen hat dafür im § 115 Abs. 2 ThürWG das Planfeststellungsverfahren gewählt. Dazu wurden jedoch etliche Ausnahmen (§ 115 Abs. 1 und 2 ThürWG) vorgesehen. Hingewiesen sei dabei auch auf die Tatsache, dass das Planfeststellungsverfahren nicht mit einem Planfeststellungsbeschluss, sondern mit der Erteilung der Bewilligung endet. Mithin kann man wohl eher von einem stark verkürzten Planfeststellungsverfahren sprechen.
1.7 Sonstiges
Die Bewilligung geht auf den Rechtsnachfolger über, es sei denn, es wurde in der Bewilligung ausdrücklich ausgeschlossen. Die Bewilligung ist ein begünstigender Verwaltungsakt und wird nur auf Antrag erteilt.
2 Erlaubnis
2.1 Begriff und Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage der Erlaubnis sind die § 7 WHG i.V.m. § 6 WHG. Die Erlaubnis gewährt die widerrufliche Befugnis, ein Gewässer zu einem bestimmten in einer nach Art und Maß bestimmten Weise zu benutzen. Dem- nach muss der Grundtatbestand der Benutzung (§ 3 WHG, § 15 ThürWG) vorliegen. Wichtig ist, dass die Erlaubnis nur eine Befugnis und kein Recht gewährt. Sie ist das schwächste Instrument der wasserrechtlichen Gestattungsarten.
2.2 Tatbestandvoraussetzungen
2.2.1 Keine Beeinträchtigung des Wohl der Allgemeinheit
Nach § 6 Abs. 1 WHG ist die Erlaubnis zu versagen, soweit von der beabsichtigten Benutzung eine Beeinträch- tigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung, zu erwarten ist, die nicht durch Auflagen verhütet oder ausgeglichen wird. (vgl. Ausführungen bei Bewilligung)
2.2.2 Keine wesentliche Beeinträchtigung der Gewässergüte
Nach § 18 Abs. 1 ThürWG darf die Erlaubnis nur dann erteilt werden, wenn durch die Einleitung eine wesentli- che Beeinträchtigung der vorhandenen Gewässergüte nicht zu besorgen ist. Wichtig ist hierbei, dass diese Voraussetzung nur bei der Erlaubniserteilung für eine Benutzung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 4 WHG, d.h. für das Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer, in Betracht kommt und zu prüfen ist.
2.2.3 Keine wesentliche Beeinträchtigung des Gewässers in seiner Gesamtheit
Nach § 18 Abs. 2 ThürWG darf die Erlaubnis für die landesrechtlichen Benutzungen im Sinne des § 15 Abs. 1 ThürWG nur dann erteilt werden, wenn eine wesentliche Beeinträchtigung von Gewässern nicht zu besorgen ist.
2.2.4 Keine Verletzung des Gebots der Rücksichtnahme
Das Gebot der Rücksichtnahme wurde durch die Rechtsprechung entwickelt und ist immer zu berücksichtigen. (vgl. Ausführungen bei der Bewilligung)
2.3 Rechtsfolge
Sofern eine der Tatbestandsvoraussetzungen nicht vorliegt, ist die Erlaubnis nach § 6 Abs. 1 WHG zu versagen. Hierbei handelt es sich um eine gebunden Entscheidung. Einen Anspruch auf Erteilung einer Erlaubnis auch bei Vorliegen aller Tatbestandsvoraussetzungen besteht nicht (BVerfG Entscheidung vom 15.07.1981, AZ: 1 BvL 77/78). Es handelt sich um ein repräsives Verbot, woraus eine rein behördliche Ermessensentscheidung resul- tiert.
2.4 Nebenbestimmungen
Nach § 4 WHG sind Benutzungsbedingungen und Auflagen grundsätzlich möglich. § 16 ThürWG enthält Regelungen zu dieser Problematik. Bei einer solchen Auflage handelt es sich um eine Auflage im Sinne von § 36 ThürVwVfG. Bedingungen in o.g. Sinne hingegen sind keine Bedingungen im Sinne des § 36 ThürVwVfG, sondern verstehen sich eher als eine Art Inhaltsbestimmung (Benutzungsbedingungen).
2.5 Rücknahme und Widerruf
Da im WHG und im ThürWG keine Regelungen über die Rücknahme bzw. den Widerruf einer wasserrechtli- chen Erlaubnis enthalten sind, finden die §§ 48, 49 ThürVwVfG entsprechende Anwendung. Demnach ist die Rücknahme einer rechtswidrigen Erlaubnis nach § 48 ThürVwVfG möglich. Der Widerruf einer rechtmäßigen Erlaubnis erfolgt nach § 49 Abs. 2 Ziff. 1 ThürVwVfG, da die Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 Satz 1 WHG kraft Ge- setz widerruflich ist. Der Widerruf ist hierbei eine Ermessensentscheidung. Nach h.M. ist der Widerruf der Erlaubnis auch dann möglich, wenn ein Grund des § 12 Abs. 2 WHG vorliegt. Grund hierfür ist die Tatsache, dass wenn schon die (qualitativ hochwertigere) Bewilligung widerrufbar ist, dann muss die (schwächere) Er- laubnis erst recht widerrufbar sein.
2.6 Verfahren
Nach § 108 i.V.m. § 115 ThürWG richtet sich das Verfahren nach dem ThürVwVfG. Da kein bestimmtes Verfahren (besonderes Verwaltungsverfahren / Planfestellungsverfahren) vorgegeben ist, kann nur das einfache Verwaltungsverfahren im Sinne der §§ 9 bis 30 ThürVwVfG gemeint sein.
2.7 Sonstiges
Die Erlaubnis geht auf den Rechtsnachfolger über, es sei denn, es wurde in der Erlaubnis ausdrücklich ausgeschlossen. Die Erlaubnis ist ein begünstigender Verwaltungsakt und wird nur auf Antrag erteilt.
3 Gehobene Erlaubnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Bewilligung im Thüringer Wasserrecht?
Eine Bewilligung ist eine wasserrechtliche Gestattung, die gemäß § 8 i.V.m. § 6 WHG das Recht gewährt, ein Gewässer in einer bestimmten Art und Weise zu nutzen. Sie setzt voraus, dass der Grundtatbestand der Gewässernutzung gemäß § 3 WHG und § 15 ThürWG erfüllt ist.
Wann darf keine Bewilligung erteilt werden?
Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 WHG darf keine Bewilligung für das Einbringen und Einleiten von Stoffen in ein Gewässer (§ 3 Abs. 1 Nr. 4, 4a, 5 WHG) sowie für die unechte Benutzung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG erteilt werden. Dies gilt auch nach § 15 Abs. 2 ThürWG für die landesrechtlichen Benutzungen im Sinne des § 15 Abs. 1 ThürWG. Eine Ausnahme besteht gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 WHG für das Wiedereinleiten von nicht nachteilig verändertem Triebwasser bei Ausleitungskraftwerken.
Welche Tatbestandsvoraussetzungen müssen für eine Bewilligung erfüllt sein?
Für die Erteilung einer Bewilligung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Kein Bewilligungsausschluss darf vorliegen.
- Ein Investitionsschutzbedürfnis des Antragstellers muss gegeben sein.
- Ein planmäßiges Vorgehen bei der Verwirklichung der Benutzung muss erkennbar sein.
- Rechte Dritter dürfen nicht beeinträchtigt oder verletzt werden, und Interessen Dritter dürfen nicht verletzt werden.
- Das Wohl der Allgemeinheit darf nicht beeinträchtigt werden.
- Das Gebot der Rücksichtnahme darf nicht verletzt werden.
Was passiert, wenn eine der Tatbestandsvoraussetzungen für eine Bewilligung nicht vorliegt?
Wenn eine der Tatbestandsvoraussetzungen nicht vorliegt, ist die Bewilligung gemäß § 6 Abs. 1 WHG zu versagen. Dies ist eine gebundene Entscheidung, es besteht kein Anspruch auf Erteilung.
Welche Nebenbestimmungen sind bei einer Bewilligung möglich?
Gemäß § 4 WHG sind Benutzungsbedingungen und Auflagen grundsätzlich möglich. Bewilligungen sind nach § 8 Abs. 5 WHG zu befristen, wobei die Frist nur ausnahmsweise länger als 30 Jahre sein darf. Widerrufsvorbehalte und auflösende Bedingungen sind in der Bewilligung nicht möglich.
Unter welchen Umständen kann eine Bewilligung zurückgenommen oder widerrufen werden?
Die Rücknahme einer rechtswidrigen Bewilligung erfolgt nach § 48 ThürVwVfG. Ein Widerruf einer Bewilligung kann nur über die Spezialnorm des § 12 WHG erfolgen, wenn sich der Betroffene nicht an die Regelungen der Bewilligung hält.
Wie läuft das Verfahren zur Erteilung einer Bewilligung ab?
Gemäß § 9 WHG muss ein Verfahren durchgeführt werden, in dem Bürger und Behörden Einwendungen gegen ein Vorhaben einbringen können. In Thüringen wird dafür gemäß § 115 Abs. 2 ThürWG das Planfeststellungsverfahren angewendet, wobei es etliche Ausnahmen gibt (§ 115 Abs. 1 und 2 ThürWG). Das Verfahren endet mit der Erteilung der Bewilligung.
Was geschieht mit der Bewilligung bei einem Rechtsnachfolger?
Die Bewilligung geht auf den Rechtsnachfolger über, es sei denn, dies wurde in der Bewilligung ausdrücklich ausgeschlossen.
Was ist eine Erlaubnis im Thüringer Wasserrecht?
Die Erlaubnis ist eine wasserrechtliche Gestattung, die gemäß § 7 WHG i.V.m. § 6 WHG die widerrufliche Befugnis gewährt, ein Gewässer in einer bestimmten Art und Weise zu nutzen. Sie ist das schwächste Instrument der wasserrechtlichen Gestattungsarten.
Welche Tatbestandsvoraussetzungen müssen für eine Erlaubnis erfüllt sein?
Für die Erteilung einer Erlaubnis müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Das Wohl der Allgemeinheit darf nicht beeinträchtigt werden.
- Keine wesentliche Beeinträchtigung der Gewässergüte darf vorliegen (bei Einleitungen).
- Keine wesentliche Beeinträchtigung des Gewässers in seiner Gesamtheit darf vorliegen (bei landesrechtlichen Benutzungen).
- Das Gebot der Rücksichtnahme darf nicht verletzt werden.
Unter welchen Umständen kann eine Erlaubnis zurückgenommen oder widerrufen werden?
Da im WHG und im ThürWG keine Regelungen über die Rücknahme bzw. den Widerruf einer wasserrechtlichen Erlaubnis enthalten sind, finden die §§ 48, 49 ThürVwVfG entsprechende Anwendung. Demnach ist die Rücknahme einer rechtswidrigen Erlaubnis nach § 48 ThürVwVfG möglich. Der Widerruf einer rechtmäßigen Erlaubnis erfolgt nach § 49 Abs. 2 Ziff. 1 ThürVwVfG, da die Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 Satz 1 WHG kraft Gesetz widerruflich ist.
Was ist eine Gehobene Erlaubnis?
Die Gehobene Erlaubnis ist eine Zwischenstufe zwischen der Erlaubnis und der Bewilligung im Thüringer Wassergesetz.
- Quote paper
- Michael Stötzel (Author), 2000, Gestattungsarten im Wasserrecht (Thüringen), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96621