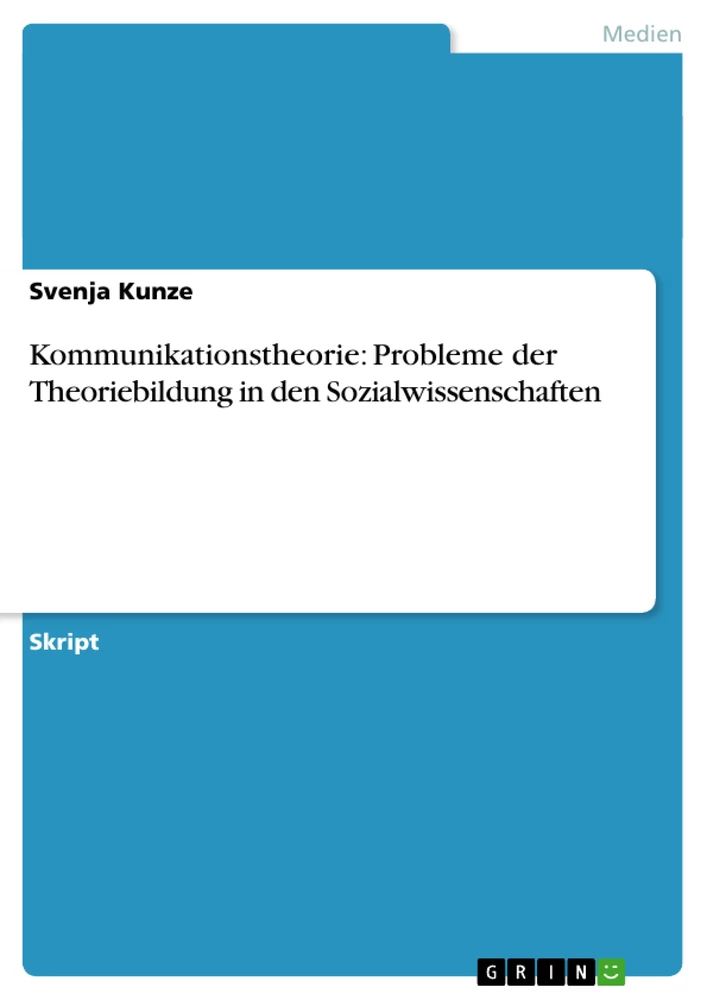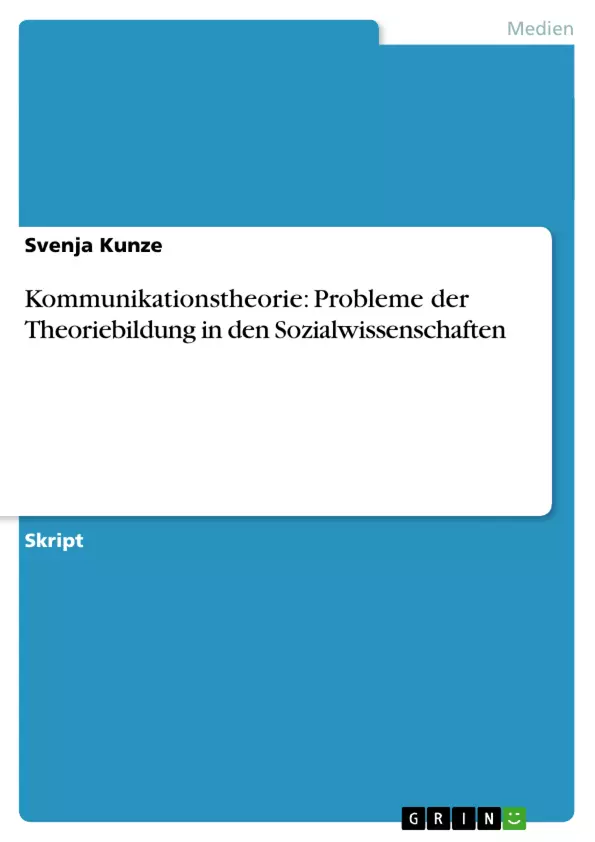Probleme der Theoriebildung in den Sozialwissenschaften
1. Das Werkzeug Sprache
1.1 Begriffe und Wirklichkeit
Mit Worten und deren Bedeutungen werden Erscheinungen unserer Wirklichkeit erfaßt, geordnet und in einen Zusammenhang gebracht. Sprache ist also ein Werkzeug zum Begreifen der Wirklichkeit. Über die Zuordnung von Bezeichnungen zu Erscheinungen werden Begriffe geschaffen.
Allerdings besteht ein Spannungsfeld zwischen Begriffen und Wirklichkeit: die Zahl der Er- scheinungen der Wirklichkeit ist unendlich, entsprechend müßte es unendlich viele Begriffe geben (-> Quantitätsproblem) und die Beschaffenheit dieser Erscheinungen ist nicht erschöpfend zu beschreiben (-> Qualitätsproblem). Außerdem kann ein Begriff je nach Gebrauch unter- schiedliche und unterschiedlich viele Erscheinungen umfassen. Für den wissenschaftlichen Ge- brauch ist nun eine eindeutige Klärung der Begriffe, also dessen, was eine Bezeichnung "bedeuten" soll, unumgänglich.
Jeder Begriff läßt sich in eine Aussage auflösen (-> Definition), jede Aussage kann zu einem Begriff verdichtet werden.
1.2 (Sozial-) Wissenschaft
Wissenschaft ist ein Kommunikationsprozeß mit dem Ziel der Entdeckung neuer Erkenntnisse, der durch regelgeleitetes, methodisches Vorgehen, die Definition von Begriffen und die Auf- stellung und Überprüfung von Hypothesen ermöglicht und so zur Vergrößerung gesicherten Wissens führt.
Ziel der modernen Sozialwissenschaft, begründet durch Comte und Durkheim, ist es, das Zusammenleben von Menschen zu untersuchen mit dem Ziel, generalisierbare Aussagen zu gewinnen. Aus dem Gegenstandsbereich ergeben sich Probleme:
- Da der Forscher selbst Teil seines Untersuchungsgegenstandes, des Sozialen, ist, ist es schwierig, die nötige Distanz und Neutralität gegenüber dem Untersuchten zu gewinnen. Die Sprache als Werkzeug der Erkenntnis schiebt sich verbindend zwischen Subjekt und Objekt und macht somit Distanz unmöglich
- Die soziale Wirklichkeit besitzt aufgrund der unendlichen Menge ihrer Elemente und der Korrelationen zwischen diesen eine ungeheure Komplexität und Vielschichtigkeit.
- Die soziale Wirklichkeit ist dynamisch, was unendlich viele Problemstellungen produziert. Außerdem bedeutet der stetige Wandel des Untersuchungsgegenstandes, daß bereits ge- wonnene neue Erkenntnisse rasch wieder veraltet sind.
- Es ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch, Regelhaftigkeiten zu fin den und Erkenntnisse zu generalisieren und der Notwendigkeit, das individuelle, subjektive und zeitgebundene Elemente sozialer Phänomene zu berücksichtigen.
1.3 wissenschaftliche Aussagen
- Logische Aussagen stellen Zusammenhänge formal her. Durch logisches Schließen gewonneue Aussagen sind immer nur logisch, nicht aber unbedingt empirisch wahr.
- Faktische Aussagen drücken empirisch erfahbare Erscheinungen aus und lassen sich in des-- kriptive und explikative Aussagen unterscheiden.
- Normative Aussagen schreiben vor, erlassen Regeln, Gebote oder Empfehlungen, enthal ten Werturteile.
- Technologische Aussagen geben einen Zweck vor und beschreiben Mittel, mit denen die ser Zweck zu erreichen ist.
Diese Unterscheidung ist jedoch idealtypisch, in der Realität tauchen Mischformen auf. In der Sozialwissenschaft werden faktische und normative Aussagen am häufigsten auftreten; wichtig ist, daß sich der SozWiss über den Status seiner Aussagen bewußt ist.
2. Sprachtheorie und Begriffsbildung
2.1 Semiotik
Der Grundgedanke der Semiotik besagt, daß jedes Zeichen/jeder Begriff drei Dimensionen aufweist:
- Die pragmatische Dimension, d.h. das Verhältnis Mensch-Zeichen, denn jedes Zeichen wird uf eine bestimmte Weise von jemandem verwendet und übermittelt.
- Die syntaktische Dimension, d.h. das Verhältnis von Zeichen zu Zeichen, denn jedes Zei- chen ist Teil eines Zeichensystems.
- Die semantische Dimension, d.h. das Verhältnis von Zeichen und dem, was damit gemeint ist, also die Bedeutung. Eine sinnvolle Folge von sprachlichen Zeichen ist ein Ausdruck, die Bedeutung eines Ausdrucks ist ein Begriff.
2.2 Begriffsbildung
Die Bedeutungen von Ausdrücken, also die Begriffe, sind geprägt von der Gesellschaft, in der sie entstanden sind bzw. in der sie verwendet werden. Es bilden sich in einer Gesellschaft Überinkünfte über die Bedeutung von Ausdrücken heraus, Begriffe werden gesellschaftlich konvenTionalisiert. Verständigungsprobleme zwischen A und B tauchen dann auf, wenn sie mit den ausgetauschten Zeichen oder Ausdrücken verschiedene Bedeutungen verbinden. Derartige Bedeutungsdifferenzen und Bedeutungswandel allgem. sind v.a. bedingt durch Schichtzugehö- rigkeit, Zeit, funktionsbedingte Sondersprachen, Ideologie, persönliche Erfahrungen.
2.3 Begriffsdefinitionen
Um Verständigungsprobleme zu reduzieren, müssen in der Wissenschaft Begriffe für den je- weiligen Gebrauch definiert werden. Definition bedeutet die Bestimmung von Begriffen und ihre Bindung an eine Zeichenfolge. Dabei wird die Bedeutung eines Begriffes häufig mit Hilfe anderer bereits bestimmter Begriffe festgelegt, was auf einen unendlichen Regreß hinausläuft. Es gibt verschiedene Arten von Begriffsbestimmungen:
- Die Realdefinition oder Wesensdefinition ist der Versuch, eine direkte Beziehung zwischen Ausdruck und Objekt herzustellen und somit das Objekt definitiv und erschöpfend zu be- stimmen. Eine Realdefinition ist in den SozWiss unmöglich.
- Die Begriffsexplikation will den allgemein üblichen Gebrauch eines Begriffes erläutern.
- Die Nominaldefinition stellt eine Übereinkunft über einen Begriff und seine Verwendung für einen bestimmten Zweck in einem eingrenzbaren Zusammenhang dar. Eine Nominalde- finition spielt sich allein auf der Ebene der Begriffe ab, kann keinen direkten Bezug zur Wirklichkeit herstellen und damit keinen Anspruch auf Wahrheit erheben.
- Die operationale Definition zielt darauf, Begriffe in einer Zahl mit Maßeinheit auszudrüc??k- ken undf unktioniert in Reinform nur in den Naturwissenschaften. In den SozWiss: Codie rung.
3. Theorien
Eine Theorie ist ein System logisch miteinander verbundener, widerspruchsfreier Hypothesen. Sie enthält eine Reihe von unabhängigen Aussagen aus denen weitere Aussagen, Gesetze und Theoreme mittels Regeln abgeleitet werden. (-> Friedrichs)
3.1 Funktionen von Theorien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2 Ansprüche an Theorien
- Informationsgehalt
- Präzision und innere Widerspruchsfreiheit
- Bewährtheit/ empirische Überprüfbarkeit
- Intersubjektivität/ Nachvollziehbarkeit
- Kommunikabilität/ Verständlichkeit
- Authentizität/ Validität
3.3 Theoriearten
Theorien werden unterschieden nach Reichweite, Abstraktionsgrad und Komplexität. Reihenfolge nach zunehmender Komplexität und Abstraktion:
empirische Regelhaftigkeit -> ad-hoc-Theorie -> Theorie mittlerer Reichweite -> Theorie hoher Komplexität
3.4. Notwendigkeit einer theoriegeleiteten Empirie
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Probleme der Theoriebildung in den Sozialwissenschaften"?
Der Text befasst sich mit den Problemen der Theoriebildung in den Sozialwissenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von Sprache als Werkzeug, die Komplexität der sozialen Realität und die Notwendigkeit theoriegeleiteter Forschung.
Wie wird Sprache im Kontext der Sozialwissenschaften betrachtet?
Sprache wird als ein Werkzeug betrachtet, um die Realität zu erfassen, zu ordnen und in einen Zusammenhang zu bringen. Allerdings wird auch das Spannungsfeld zwischen Begriffen und der unendlichen Komplexität der Realität hervorgehoben.
Welche Probleme ergeben sich aus der Untersuchung der sozialen Wirklichkeit?
Mehrere Probleme werden genannt: die Schwierigkeit, als Forscher Distanz zu seinem eigenen Untersuchungsgegenstand zu wahren, die Komplexität und Vielschichtigkeit der sozialen Wirklichkeit, ihre Dynamik und das Spannungsverhältnis zwischen Generalisierung und der Berücksichtigung individueller Elemente.
Welche Arten von wissenschaftlichen Aussagen werden unterschieden?
Es werden logische, faktische (deskriptive und explikative), normative und technologische Aussagen unterschieden.
Was ist Semiotik und welche Dimensionen beinhaltet sie?
Semiotik ist die Lehre von Zeichen und deren Bedeutung. Sie beinhaltet die pragmatische (Mensch-Zeichen), syntaktische (Zeichen-Zeichen) und semantische (Zeichen-Bedeutung) Dimension.
Wie werden Begriffe gebildet und welche Probleme können dabei auftreten?
Begriffe werden gesellschaftlich konventionalisiert, d.h. es bilden sich Überinkünfte über die Bedeutung von Ausdrücken. Verständigungsprobleme entstehen, wenn unterschiedliche Personen verschiedenen Bedeutungen mit denselben Zeichen verbinden. Diese Differenzen können durch Schichtzugehörigkeit, Zeit, Sondersprachen, Ideologie oder persönliche Erfahrungen bedingt sein.
Welche Arten von Begriffsdefinitionen gibt es und was sind ihre Merkmale?
Es werden Realdefinitionen, Begriffsexplikationen, Nominaldefinitionen und operationale Definitionen unterschieden. Realdefinitionen sind in den Sozialwissenschaften nicht möglich. Nominaldefinitionen stellen Übereinkünfte über die Verwendung eines Begriffs dar, während operationale Definitionen Begriffe messbar machen sollen.
Was ist eine Theorie und welche Funktionen hat sie?
Eine Theorie ist ein System logisch miteinander verbundener, widerspruchsfreier Hypothesen. Ihre Funktionen umfassen unter anderem die Beschreibung, Erklärung, Prognose und Kritik von Phänomenen.
Welche Ansprüche werden an Theorien gestellt?
An Theorien werden Ansprüche wie Informationsgehalt, Präzision, innere Widerspruchsfreiheit, empirische Überprüfbarkeit, Intersubjektivität, Kommunikabilität und Validität gestellt.
Welche Arten von Theorien werden unterschieden?
Theorien werden nach Reichweite, Abstraktionsgrad und Komplexität unterschieden, wobei eine Reihenfolge von empirischer Regelhaftigkeit über Ad-hoc-Theorie und Theorie mittlerer Reichweite bis zur Theorie hoher Komplexität besteht.
Warum ist eine theoriegeleitete Empirie notwendig?
Eine theoriegeleitete Empirie ist notwendig, um systematisch Ausschnitte der Wirklichkeit zu erfassen, Komplexität zu reduzieren, Intersubjektivität zu gewährleisten und Abstraktion zu ermöglichen.
- Quote paper
- Svenja Kunze (Author), 2000, Kommunikationstheorie: Probleme der Theoriebildung in den Sozialwissenschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96600