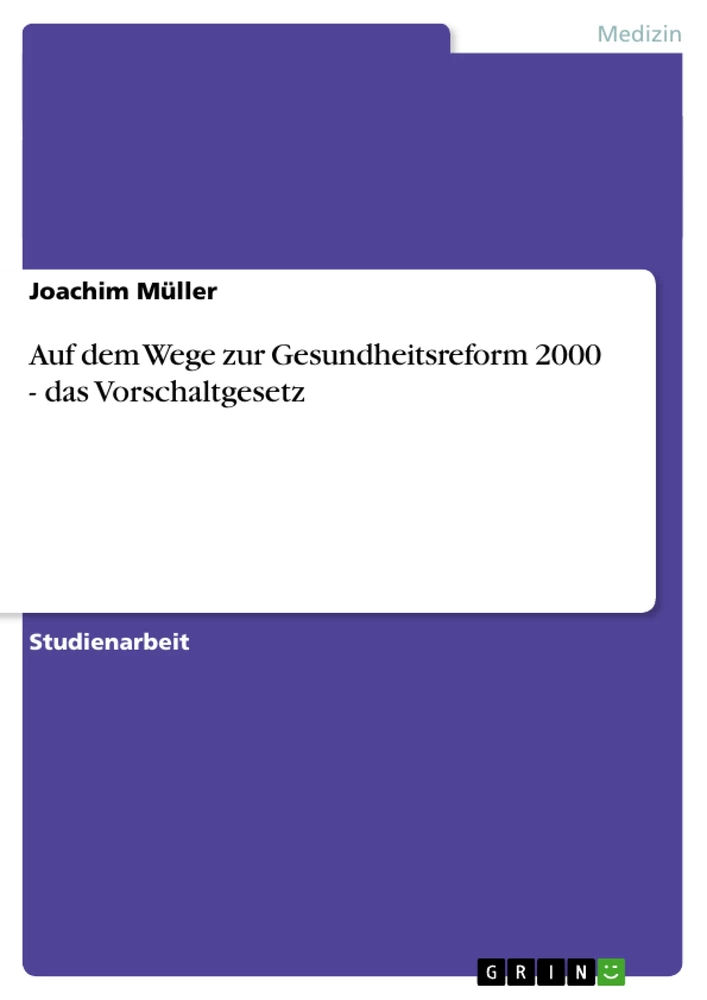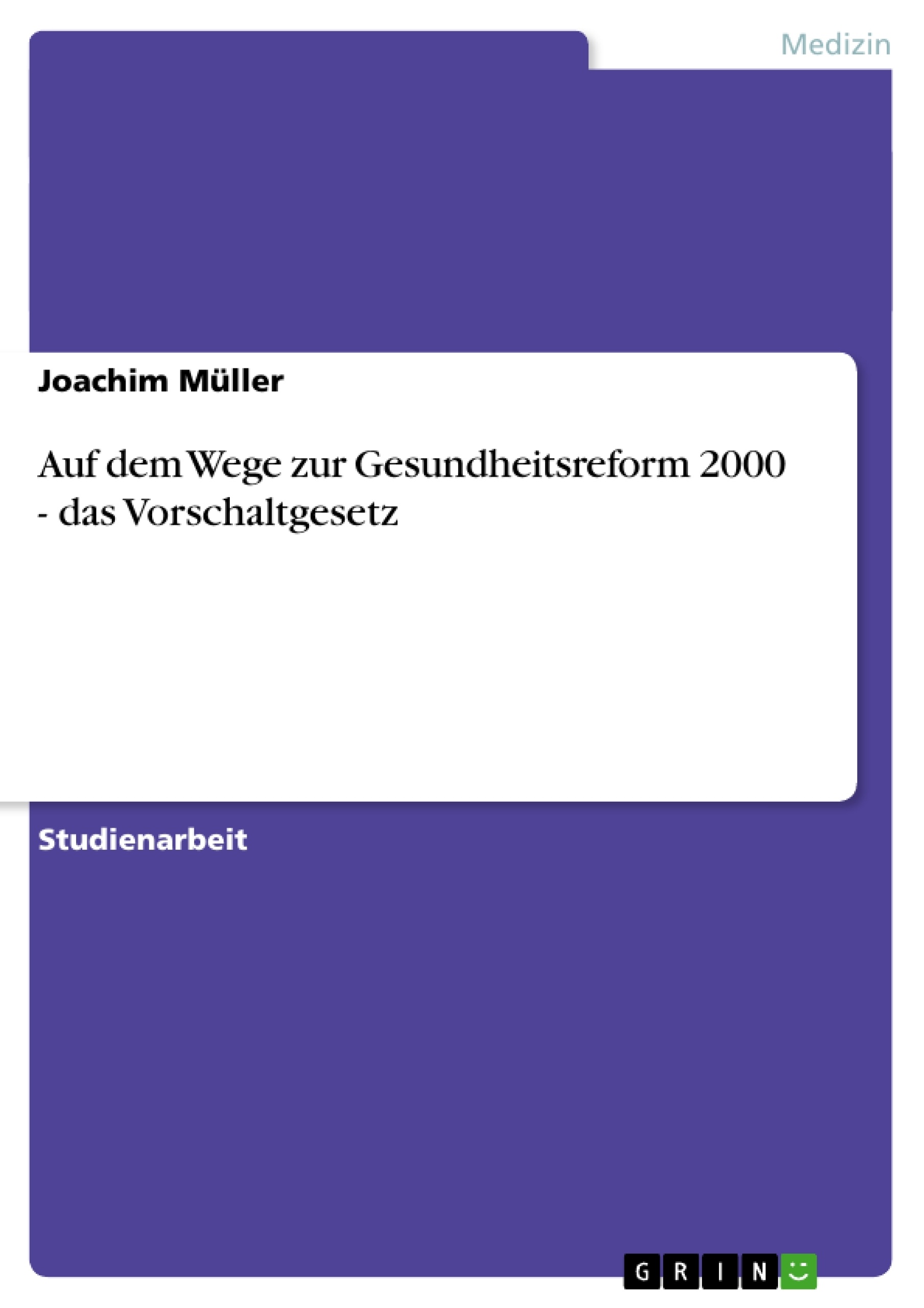Inhaltsverzeichnis
1. DAS VORSCHALTGESETZ
2. BEGRÜNDUNG DER REGIERUNG SPD UND BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ZUM GKV-SOLIDARITÄTSSTÄRKUNGSGESETZ
2.1. Sozial- und Gesundheitspolitische Ziele der neuen Bundesregierung
2.2. Die Strukturreform
2.2.1. Inhalte der geplanten Strukturreform
3. INHALTE UND MAßNAHMEN DES GKV- SOLIDARITÄTSSTÄRKUNGSGESETZ SOWIE STELLUNGNAHMEN DER NEUEN REGIERUNG
3.1. Rücknahme von Leistungsausgrenzungen und Zuzahlungen
3.1.1. Senkung der Arzneimittelzuzahlung
3.1.2. Veränderte Chronikerregelung
3.1.3. Zahnersatz für Kinder und Jugendliche
3.1.4. Ernährungstherapeutika
3.1.5. Zuzahlungserhöhungen
3. 2. Aussetzung des Krankenhausnotopfers
3.3. Rücknahme von Elementen der privaten Krankenversicherung
3.4. Vorläufige Begrenzung der Ausgaben
3.4.1. Vertragsärztliche Versorgung
3.4.2. Vertragszahnärztliche Versorgung
3.4.3. Stationäre Krankenhausversorgung
3.4.4. Arznei und Heilmittel
3.4.5. Preisbegrenzungen für Rettungsdienste, Heilmittel und Zahnersatz
3.6. Allgemeinmedizinische Weiterbildung durch Mitfinanzierung der Krankenkassen
4. SOZIAL- UND GESUNDHEITSPOLITISCHE SICHT
4.1. Maßnahmen zur Steuerung der Nachfrage/ Inanspruchnahme
4.2. Maßnahmen zur Steuerung der Produktion von Gesundheitsgütern
4.3. Maßnahmen zur Steuerung der Vermittlung von Gesundheitsgütern
4.4. Maßnahmen zur Steuerung des Angebots
4.5. Auswirkungen des Vorschaltgesetzes auf die privaten Haushalte
4.6. Die Gegenfinanzierung des Gesetzes und dessen Auswirkungen
5. KONSEQUENZEN FÜR DIE PFLEGE
6. SCHLUßBEMERKUNG
1. Das Vorschaltgesetz
Die ,,dritte Stufe" der Gesundheitsreform umfaßte verschiedene Einzelgesetze. Zu den wichtigsten gehörten die SGB- Änderungsgesetze Nr. 5-8 sowie das Krankenhaus-Stabilisierungsgesetz, das Beitragsentlastungsgesetz, das 1. und 2. GKV-Neuordnungsgesetz (NOG) und das Wachstum- und Beschäftigungsförderungsgesetz.
Die neue Bundesregierung von SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN verständigten sich am 20. 10. 1998 im Rahmen einer Koalitionsvereinbarung, auf eine Richtungsänderung in der Gesundheitspolitik. Es galt zu einer sozial gerechten Krankenversicherung zurückzufinden, die auf dem Solidar- und Sachleistungsprinzip beruht. Mit dem Ziel die Finanzgrundlagen zu stabilisieren und die Voraussetzungen für eine grundlegende Strukturreform in der gesetzlichen Krankenversicherung zum Jahr 2000 zu schaffen, wurde am 19. 12. 1998 das ,,Gesetz zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung" (GKV- Solidaritätsstärkungsgesetz - GKV-SolG -,,Vorschaltgesetz") auf den Weg gebracht. Dieses Sofortprogramm welches am 01. 01. 1999 in Kraft trat, nahm zahlreiche Regelungen der 3. Stufe der Gesundheitsreform zurück.
2. Begründung der Regierung SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zum GKVSolidaritätsstärkungsgesetz
2.1. Sozial- und Gesundheitspolitische Ziele der neuen Bundesregierung
Die Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme und die Senkung der Lohnnebenkosten sieht die Koalitionsfraktion SPD, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN als primäre Aufgabe an. Dieses soll durch den Abbau der Arbeitslosigkeit und durch Strukturreformen erreicht werden. Eine ökologische Steuer- und Abgabenreform soll dazu die Grundlagen schaffen. Um diese Ziele umsetzen zu können, müssen auch die Krankenversicherungsbeiträge dauerhaft stabilisiert werden.
Das ,,Beitragsentlastungsgesetz" sowie das ,,1. und 2. GKV-Neuordnungsgesetz" der alten Bundesregierung von CDU/CSU und FDP konnten eine Stabilisierung bzw. Senkung des Beitragssatzes nicht umsetzen. So stiegen bis Mitte 1997 die Beitragssätze weiterhin, was unter anderem eine Ursache für den Anstieg der Lohnnebenkosten auf über 42% war. Dies führte wiederum zur Schwächung der internationalen Wettbewerbsposition Deutschlands und beschleunigte auch das Wachstum der Arbeitslosigkeit. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken will die neue Bundesregierung die Lohnnebenkosten auf unter 40% absenken. Stabile Krankenversicherungsbeiträge und die Absenkung des Beitragssatzes der gesetzlichen Rentenversicherung stellen einen ersten Schritt in diese Richtung dar.
2.2. Die Strukturreform
Die Umkehr zu einer solidarisch finanzierten, paritätischen sozialen Krankenversicherung, die aber für mehr Qualität, Wirtschaftlichkeit und verbesserte Versorgungsstrukturen sorgen soll, ist nach der Aussage der neuen Bundesregierung nur mit einer Strukturreform möglich. Stabile Grundlagen für diese Reform, sollte das GKV-SolG mit seiner Ausgabenbegrenzung schaffen.
2.2.1. Inhalte der geplanten Strukturreform
1. Streichung medizinisch fragwürdiger Leistungen und Arzneimittel aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen.
2. Einführung eines Globalbudgets für die Ausgaben der Krankenkassen.
3. Stärkung der hausärztlichen Versorgung unter Beachtung der freien Arztwahl.
4. Bessere Zusammenarbeit von Hausärzten, Fachärzten und Krankenhäusern, z.B. durch gemeinsame Nutzung teurer Medizintechnik.
5. Neuordnung des Arzneimittelmarktes durch Einführung einer Positivliste und Verstärkung der Re-Importe von Arzneimitteln.
6. Neuordnung der ambulanten und stationären Vergütungssysteme im Rahmen der Vertragsgebührenordnungen und Pflegesätze einschließlich monistischer Krankenhausfinanzierung.
7. Vorrang von Rehabilitation vor Frühverrentung und Pflege.
8. Reform der ärztlichen Ausbildung und Überprüfung der Berufsbilder der Medizinalfachberufe.
9. Stärkung der Patientenrechte, des Patientenschutzes und der Qualitätssicherung sowie die Verbesserung der Gesundheitsberichterstattung.
(vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.2 ff)
3. Inhalte und Maßnahmen des GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz sowie Stellungnahmen der neuen Regierung
3.1. Rücknahme von Leistungsausgrenzungen und Zuzahlungen
Das Gesetz sieht eine Absenkung der Arzneimittelzuzahlung, eine Veränderung der Regelung für chronisch Kranke, die Wiedereinführung von Zahnersatz für Kinder und Jugendliche und die Rechtsgrundlage für Ernährungstherapeutika vor. Auch die bereits gesetzlich vorgesehenen Zuzahlungserhöhungen für das Jahr 1999 wurden herausgenommen.
3.1.1. Senkung der Arzneimittelzuzahlung
Die erhöhte Zuzahlung die auf das Beitragsentlastungsgesetz und dem
1. GKV-Neuordnungsgesetz zurück zuführen ist, wird für die Packungsgröße N1 von 9,- DM auf 8,- DM, für die Packungsgröße N2 von 11,- DM auf 9,- DM und für die Packungsgröße N3 von 13,- DM auf 10,- DM reduziert. (SGB V, §31, Abs. 3)
Dazu argumentieren die SPD, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN: ,,Eine darüber hinausgehende kurzfristige Absenkung der Zuzahlungsbeträge und damit verbundene Mehrausgaben wären mit der Notwendigkeit der Sicherung der Beitragssatzstabilität in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht vereinbar."
(vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.5) http://www.bmgesundheit.de/themen/gkv/diskus/übersi2.htm
3.1.2. Veränderte Chronikerregelung
Es wurde eine neue Belastungsgrenze der Zuzahlung für chronisch Kranke geschaffen. Diese besagt das diejenigen, die Zuzahlungen zu Fahrkosten, Arznei-, Verband- und Heilmitteln in Höhe von 1 v.H. der Jahresbruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt leisten müssen und wegen derselben Krankheit in dauernder Behandlung sind, für die Fortdauer der Behandlung von der Zuzahlung zu befreien sind. Alle zwei Jahre ist die Dauerbehandlung nachzuweisen und gegebenenfalls vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung zu überprüfen. Die Zuzahlungsbefreiung betrifft nur den Versicherten der wegen derselben Krankheit in Dauerbehandlung ist.
(SGB V, §62, Abs. 1; Satz 2, 4)
Begründung der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN: ,,Die völlige Freistellung gilt allerdings nicht für die übrigen Familienmitglieder. Da die besonderen Belastungen bei chronisch Kranken entfallen, ist kein Grund mehr vorhanden, diese Familien hinsichtlich der Belastungsgrenze anders zu behandeln als alle übrigen Familien von Versicherten in einem Haushalt."
(vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.5) http://www.bmgesundheit.de/themen/gkv/diskus/übersi2.htm
3.1.3. Zahnersatz für Kinder und Jugendliche
Nach dem Beitragsentlastungsgesetz wurde der Anspruch auf Zahnersatz für Versicherte, die nach 1978 geboren wurden, aufgehoben.
Mit dem neuen Gesetz haben nun wieder alle Versicherten einen Anspruch auf medizinisch notwendige Versorgung mit Zahnersatz. Die neue Bundesregierung begründet dies mit ,,Dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Generationen ..."
(vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.6 ff) http://www.bmgesundheit.de/themen/gkv/diskus/übersi2.htm Auch die Zahnmedizinische Prophylaxe und Zahnerhaltung werden wieder gefördert. (SGB V, §30)
3.1.4. Ernährungstherapeutika
Es wurde eine Rechtsgrundlage geschaffen, die in medizinisch notwendigen Fällen z.B. Sondennahrung in die Versorgung mit Arzneimitteln, zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung, einbezieht. Die Höhe der Zuzahlung des Versicherten pro Verordnung beträgt 8,- DM.
(SGB V, §31, Abs. 1, Abs. 3)
3.1.5. Zuzahlungserhöhungen
Nach dem ,,Psychotherapeutengesetz", welches am 01.01.1999 in Kraft trat, wurde die vorgesehene Zuzahlung von 10,- DM pro Sitzung aufgehoben.
(Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten)
Der §62a im SGB V der die ,,Dynamisierung" bestehender Zuzahlungen festlegte, wurde gestrichen.
Auch der §221 SGB V wurde aufgehoben. Dieser beinhaltete den sogenannten ,,Koppelungsmechanismus", dieser sah eine automatische Zuzahlungserhöhung vor, wenn der Beitragssatz einer Kasse sich erhöhte. Hierzu erklären SPD, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN:
,,Dies wäre nicht nur für die betroffenen Versicherten und Patienten mit erheblichen inakzeptablen Mehrbelastungen verbunden. Es hätte auch zu erheblichen Wett- bewerbsverzerrungen zwischen den Krankenkassen geführt ..."
(vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.5 ff) http://www.bmgesundheit.de/themen/gkv/diskus/übersi2.htm
3. 2. Aussetzung des Krankenhausnotopfers
Für die Jahre 1998 und 1999 wurde diese Zahlung aufgehoben und dann auf Dauer abgeschafft. Zahlungen die bereits erfolgt sind, werden von den Krankenkassen zurückerstattet.
Die Regierungsparteien beurteilen die Mindereinnahmen als vertretbar: ,,Die Einnahmeausfälle durch die Aussetzung des Krankenhaus-Notopfers bereits in 1998 führt vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzentwicklung nach der in diesem Jahr mit einem GKV- Überschuß von ca. 2 Mrd. DM gerechnet werden kann, nicht zu unvertretbaren Finanzproblemen."
(vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.6)http://www.bmgesundheit.de/themen/gkv/diskus/übersi2.htm
3.3. Rücknahme von Elementen der privaten Krankenversicherung
Das Beitragsentlastungsgesetz sowie das 1. und 2. GKV-Neuordnungsgesetz brachten einige Inhalte der privaten Versicherungswirtschaft in die gesetzliche Krankenversicherung mit ein. Diese Elemente (Selbstbehalt, Beitragsrückzahlungen, Zuzahlungserhöhungen und erweiterte Leistungen der einzelnen Krankenkassen durch Satzungsregelungen) wurden zurück genommen, denn sie beeinträchtigen laut SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ,,nicht nur den solidarischen Ausgleich zwischen Gesunden und Kranken, Jungen und Alten, Beziehern höherer und niedrigerer Einkommen sowie zwischen Ledigen und Familien mit Kindern. Sie führen auch zu Fehlsteuerungen und können das vermeintliche Ziel, zu einer sparsameren Leistungsinanspruchnahme und wirtschaftlicheren Leistungserbringung beizutragen, nicht erreichen."
(vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.7)
Die Wahlmöglichkeit für Versicherte zwischen Sachleistung und Kostenerstattung wird auf freiwillig Versicherte beschränkt. Da : ,,Die Einführung der Kostenerstattung ..., die durch das 2. GKV-Neuordnungsgesetz erfolgte, ... sich nicht bewährt und zu unvertretbaren Belastungen bei den Versicherten geführt ..." hat, dies stellte die jetzige Bundesregierung fest. (vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.7 ff)
Auch im Bereich des Zahnersatzes tritt nunmehr anstelle des Festzuschusses in Kombination mit der Kostenerstattung, die Sachleistung mit der Eigenbeteiligung (50 von Hundert) des Versicherten. Die Bonusregelung wird beibehalten.
SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN verweisen darauf, daß ,,Die Erfahrung mit Festzuschüssen ..., insbesondere aber bei Härtefällen zu Problemen führt, die in einem standardisierten Festzuschußmodell nie vollkommen ausgeschlossen werden können. Außerdem hat die Umstellung auf Festzuschüsse in vielen Fällen auch zu einer Erhöhung der Gesamtkosten je Fall geführt."
(vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.8 ff)
3.4. Vorläufige Begrenzung der Ausgaben
Die Sicherstellung der Stabilität des Beitragssatzes und die Vermeidung von Defiziten in der gesetzlichen Krankenversicherung soll laut Regierungserklärung erreicht werden, indem die Ausgaben der Kassen sich nur dann im Volumen verändern, wenn sich die beitragspflichtigen Einnahmen erhöhen.
Da bestehende gesetzlichen Regelungen für das Jahr 1999 zwangsläufig Ausgabensteigerungen erbrachten, die über den Grundlohnanstieg hinausgingen, setzte die Bundesregierung für die wichtigsten Leistungsbereiche der Krankenkassen eine Budgetierungsregelung ein.
,,Die Budgetierungsregelungen, die auf das Jahr 1999 begrenzt sind, stellen insgesamt sicher, daß sich die Zuwächse bei den Gesamtausgaben der GKV im Rahmen der Grundlohnentwicklung bewegen und damit eine defizitäre Finanzentwicklung und eine damit verbundene Gefahr einer Steigerung des Beitragsniveaus vermieden wird." (vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.9 ff)
Die Budgetierungen umfassen die Leistungsbereiche:
- Vertragsärztliche Versorgung
- Vertragszahnärztliche Versorgung · Stationäre Krankenhausversorgung · Arznei- und Heilmittel
- Preisbegrenzungen für Rettungsdienste, Heilmittel und Zahnersatz
3.4.1. Vertragsärztliche Versorgung
Die Gesamtvergütung für die ärztliche Versorgung 1999 wächst nur im Gleichschritt mit der Grundlohnentwicklung von 1998. Eine entsprechende Honorarverteilung erfolgt durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung.
3.4.2. Vertragszahnärztliche Versorgung
Für das Jahr 1999 wird eine Ausgabenobergrenze eingeführt. Die betroffenen Bereiche sind die Zahnerhaltung und Zahnersatz/ Kieferorthopädie. Zwei getrennte Budgets werden vorgeschrieben, das Budget: Zahnersatz und Kieferorthopädie und das Budget: konservierend-chirurgische Zahnbehandlung.
Die Bundesregierung betont hierzu: den ,,... Vorrang der Prophylaxe und Zahnerhaltung gegenüber dem Zahnersatz..."
(vgl. Argumentationspapier zum GKV-SolG der Fraktionen SPD und B Ü NDNIS 90/ DIE GR Ü NEN, Dez. 1998, S.10)
3.4.3. Stationäre Krankenhausversorgung
Das Gesamtbudget 1999 richtet sich nach dem Vorjahr zuzüglich einer Rate, die sich aus beitragspflichtigen Mehreinnahmen für das Jahr 1998 ergibt. Für jedes Krankenhaus wird ein eigenes Budget vereinbart, indem auch notwendige Ausnahmetatbestände erfaßt werden.
3.4.4. Arznei und Heilmittel
Die Begrenzung der Ausgaben in diesem Bereich soll nach der Bundesregierung ein hohes Einsparungspotential in sich bergen. Sie stellt fest, daß trotz erhöhter Zuzahlungen der Versicherten, die Ausgaben der Krankenkassen über den medizinisch begründbaren Bedarf stiegen. Somit sind Wirtschaftlichkeitsreserven vorhanden, die ausgeschöpft werden sollen. Bei Überschreitung des Arzneimittelbudgets 1999 der Vertragsärzteschaft, beträgt das Rückzahlungsvolumen max. 5% des Budgets.
Die Festbeträge für Arzneimittel sollen im unteren Drittel der Preise für die jeweilige Arzneimittelgruppe liegen.
3.4.5. Preisbegrenzungen für Rettungsdienste, Heilmittel und Zahnersatz
Die Preissteigerungen dieser Leistungen werden an den Grundlohnzuwachs gekoppelt. Im Bereich der Hilfsmittel sehen die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN keinen kurzfristigen Handlungsbedarf.
3.5. Dauerhafter Risikostrukturausgleich
Es wird argumentiert, daß mit dem Wegfall der zeitlichen Befristung des gesamtdeutschen Risikostrukturausgleichs was im GKV-Finanzstärkungsgesetz geregelt war, auch in Zukunft die Ausgleichszahlungen zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen in den alten Ländern sicher gestellt werden sollen. Somit wird eine Beitragssatzerhöhung in den neuen Ländern vermieden.
Zur Verbesserung der Ausgleichsergebnisse werden Vorschriften in Kraft treten, die zu einem gerechteren Risikostrukturausgleich führen werden. Begleitend zu diesem neuen Ausgleichsinstrument wird ein Korrekturverfahren notwendig sein. Diese Korrekturen umfassen eine zeitliche Streckung von Verpflichtungen (Ausgleichszahlungen) einzelner Krankenkassen sowie einer zumutbaren zeitlichen Streckung der Zahlungen an die ausgleichsberechtigten Krankenkassen.
3.6. Allgemeinmedizinische Weiterbildung durch Mitfinanzierung der Krankenkassen
Für die Jahre 1999 und 2000 wird eine Mitfinanzierung der Kassen an der allgemeinmedizinischen Weiterbildung festgelegt. Aus Sicht der Bundesregierung besteht ein gesundheitspolitischer Konsens, der die Förderung der allgemeinmedizinischen Weiterbildung rechtfertigt.
Des weiteren soll ein ,,Initiativprogramm zur Sicherstellung der allgemeinmedizinischen Versorgung" erarbeitet werden.
Die Vorschrift regelt die Beteiligungen der Krankenkassen sowie der Kassenärztlichen Vereinigungen an den zusätzlichen max. 6000 Stellen, um dieses Programm umzusetzen. Eine Einbindung in die Finanzierung erwartet man von den privaten Krankenversicherungen, die sich entsprechend ihrem Marktanteil beteiligen sollen.
3.7. Finanzierung des Gesetzes für das Jahr 1999
Die geschätzten Belastungen von ca. 2,1 Mrd. DM stehen nach der rot-grünen Regierung ca. 2,5 Mrd. DM Entlastungen gegenüber.
Die Hauptentlastungen setzen sich aus den Einsparungen bei den Arznei- und Heilmittelbudgets von ca. 1,0 Mrd. DM und durch Mehreinnahmen paralleler Korrekturgesetze in der Sozialversicherung von ca. 1,3- 1,4 Mrd. DM (Einbeziehung geringfügig Beschäftigter in die GKV), ca. 120 Mio. DM (Wiedereinführung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) zusammen.
Durch die Budgetierungen wird gewährleistet, daß der Zuwachs der GKV- Gesamtausgaben sich im Rahmen der beitragspflichtigen Einnahmen bewegt. Dies wirkt einer defizitären Entwicklung der GKV entgegen und fördert die Stabilität des Beitragssatzniveaus. Dazu Andrea Fischer, Bundesministerin für Gesundheit: ,,Mit dem Gesetz zur Stärkung der Solidarität der gesetzlichen Krankenversicherung ist eine gute Ausgangsbasis für die Reform geschaffen worden. Einerseits wurden die unzuträglichen finanziellen Belastungen für Patientinnen und Patienten gesenkt und die Leistungen verbessert, andererseits wurde ein ausgeglichenes Finanzergebnis im Jahr 1999 ermöglicht. Das ist eine solide Grundlage für die Reform ab dem Jahr 2000."
(vgl. { http://www.dialog-gesundheit.de:80/ThemaderWoche2/Themader Woche25.htm })
4. Sozial- und Gesundheitspolitische Sicht
Die alte Bundesregierung orientierte sich in der Gesundheitspolitik am Modell des Neoliberalismus, das heißt die staatlichen Aktivitäten wurden reduziert. Beispiele dafür sind das 1. und 2. Neuordnungsgesetz, Selbstverwaltungsorgane erhielten mehr Befugnisse. Die neue Bundesregierung dagegen weitete die staatliche Verantwortung wiederum aus, was sich im GKV-SolG wiederfand.
Der Solidaritätsgedanke ist hier dominierend und zeigte sich in der Reduzierung der Zuzahlungen, in der Rücknahme der Leistungsausgrenzungen und Elementen der privaten Versicherungswirtschaft sowie in der Sicherung eines dauerhaften Risikostrukturausgleichs. Durch Deregulierungen und Interventionen verfolgt man einen Weg der den Sozialstaatsansatz in sich bürgt.
4.1. Maßnahmen zur Steuerung der Nachfrage/ Inanspruchnahme
Das verstärkte Sachleistungsprinzip führt zu einer gesundheitspolitisch gewollten ,,Abkoppelung der Möglichkeit der Inanspruchnahme von der Einkommens- und Vermögensverteilung...", dem sogenannten Bedarfsprinzip (Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, 1981, S.578). Durch die Reduzierung von Zuzahlungen (z.B. Arzneimittelzuzahlung) und den Verzicht auf Zahlungen (z.B. Aussetzung des Krankenhausnotopfers), soll die Inanspruchnahme von kurzfristigen finanziellen Erwägungen der Versicherten unabhängig gemacht werden.
Eine generelle Streichung der Arzneimittelzuzahlungen ist ausgeschlossen, sie wird mit den damit verbundenen Mehrausgaben begründet. Dies mag ohne Zweifel auch zu treffen, allerdings kann man es auch als Instrumentarium sehen, um mißbräuchlicher Inanspruchnahme Einhalt zu gebieten. Besonders große anonyme Versichertenorganisationen stehen vor dem Problem der mißbräuchlichen Inanspruchnahme. Das heißt, Versicherte versuchen ein Mehr an Leistungen zu beziehen, die Auswirkungen infolge des Solidarausgleichs spüren sie selber nicht oder kaum (Rationalitätsprinzip). Beitragssatzerhöhungen sind oft die Folge.
4.2. Maßnahmen zur Steuerung der Produktion von Gesundheitsgütern
Die ,,Sicherstellung des Leistungsangebots und Qualitätssicherung" (Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, 1981, S.578) bilden die Grundlage.
Die Schaffung von monopolähnlichen Strukturen und die Sicherung von Qualität, wird in der Regelung der Mitfinanzierung der Krankenkassen an der allgemeinmedizinischen Weiterbildung deutlich. Im GKV-SolG werden zwar nur die ,,Weichen" für die verbesserte Position des Hausarztes gestellt, aber mit dem Ziel einer Effizienzsteigerung und somit einer qualitativ besseren Versorgung der Versicherten.
Die Qualitätssicherung findet sich im Gesetz als durchgängiges Gestaltungsprinzip, so z.B. wurde die zahnmedizinische Prophylaxe aus der Budgetierung heraus genommen, um auch im Jahr 1999 notwendige Steigerungsraten präventiver Leistungen zu ermöglichen.
4.3. Maßnahmen zur Steuerung der Vermittlung von Gesundheitsgütern
Der Prozeß der Vermittlung von Gütern zwischen Produzenten und Verbrauchern ,,Distribution" (Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, 1981, S.578), findet sich auch im Vorschaltgesetz wieder. Im Bereich Arznei- und Heilmittel wird eine Preisregulierung vorgenommen. Die Festbeträge sollen sich im unteren Drittel der Preisspanne für die jeweilige Arzneimittelgruppe bewegen, um diese Wirtschaftlichkeitsreserve auszuschöpfen.
4.4. Maßnahmen zur Steuerung des Angebots
Das Angebot an Gesundheitsgütern wird nicht zuletzt durch die Produktion und Distribution bestimmt. Eine ,,gesonderte Analyse der Formen, Verfahren und Techniken des Angebots an Gesundheitsleistungen unmittelbar an die Verbraucher (u.a. Patienten) rechtfertigt sich zunächst wegen der zahlreichen (z.T. soziologischen und sozialpsychologischen) Besonderheiten der Vermittlungsprozesse ..." (Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, 1981, S.579)
In dem GKV-SolG werden neue Rahmenbedingungen für diese Vermittlungsprozesse (Gesetzliche Krankenkassen- Leistungserbringer) mit den Budgetierungen, (Arzt- Patienten- Beziehung) mit der allgemeinmedizinischen Weiterbildung, usw. geschaffen. Wie effektiv diese Ordnungspolitik ist, muß man durch geeignete Instrumentarien prüfen.
4.5. Auswirkungen des Vorschaltgesetzes auf die privaten Haushalte
Das Einkommen eines Haushaltes begrenzt den Umfang der Aufwendungen für seine Versorgung mit Konsumgütern, wenn man zusätzliche Mittel (Vermögenswerte, Kredite ...) außer acht läßt. Zu Ausgabezwecken kann aber nur das verfügbare Einkommen (Nettoeinkommen) verwendet werden. (Zerche/ Gründger, 1996, S.70 ff) Auf Grund verschiedener Regelungen im GKV-SolG wird die Einkommensposition, durch den Wegfall von Soziallasten (Aussetzung des Krankenhausnotopfers) gestärkt. Weitere verbesserte Einkommenspositionen betreffen aber nur die Haushalte, die auch Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Anspruch nehmen. Durch die Reduzierung der Arzneimittelzuzahlungen, die Zuzahlungsbefreiung für chronisch Kranke die mehr als 1% des Jahresbruttoeinkommen aufwenden, den Wegfall der Zuzahlung bei psychotherapeutischer Behandlung, die Schaffung einer Rechtsgrundlage für den Bedarf an Ernährungstherapeutika und die Wiedereinführung von Zahnersatz für Versicherte die nach 1978 geboren wurden sowie die Wiedereinführung von Sachleistung beim Zahnarzt, wurde ein höherer Verbleib bezogen auf das Geldeinkommen erzielt. Auch die Wiedereinführung der vollen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall begünstigt die Einkommensposition. Steigt also das Einkommen, was hier zu treffen würde, kann sich der davon betroffene Haushalt mehr Güter leisten, was zum Zuerwerb von Gut führen kann. Das heißt letztendlich nichts anderes, daß man den Lebensstandard bestimmter Bevölkerungskreise (Kranke, chronisch Kranke, Familien mit Kindern) wieder angehoben hat.
4.6. Die Gegenfinanzierung des Gesetzes und dessen Auswirkungen
Das Gesetz weist nach Aussage der Bundesregierung eine solide Finanzierung auf. Diese setzt sich aus den Einsparungen der ausgabenbegrenzenden Regelungen, den Mehreinnahmen aus der Wiedereinführung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie der Einbeziehung geringfügig Beschäftigter in die GKV zusammen.
Das Ziel staatlicher Sozialpolitik muß nicht immer generell die Anhebung bzw. der Schutz des Lebensstandards einer Haushaltsschicht, sondern kann auch die Sicherung der Versorgung aller mit bestimmten Gütern sein. Am Beispiel der Einbeziehung geringfügig Beschäftigter in die GKV wird dies deutlich.
Für den geringfügig Beschäftigten bedeutet das allerdings eine Verschlechterung der Einkommensposition, auf Grund der neuen Soziallast. Somit wird dieser Haushalt sich weniger Güter leisten können, was mit einer Minderung des materiellen Lebensstandards verbunden ist. Eine eindeutige Zuordnung der betroffenen Bevölkerungsschichten erweist sich als schwierig, da die geringfügige Beschäftigung mittlerweile in weiten Teilen der Gesellschaft verbreitet ist.
5. Konsequenzen für die Pflege
Verschiedene Regelungen des Gesetzes werden auch den Bereich der Pflege treffen. Dazu gehört der Artikel 6 (Änderung der Bundespflegesatzverordnung), in der sich eine ,,entsprechende Berichtigungsrate" auch auf die Vergütung der Pflegenden auswirken wird. Auf Grund der Budgetierungen ist außerdem zu erwarten, daß auch die Krankenhäuser vor einem Betrag an Personalkosten stehen werden, der auf Dauer unzureichend gedeckt sein dürfte. Ein Stellenabbau auch im Pflegebereich muß in Betracht gezogen werden. Auch die Regelungen des Arznei- und Heilmittelbudgets stellen für einige Bereiche der Pflege ein Problem dar. Die Verknüpfung des Budget mit der Gesamtvergütung für die vertragsärztliche Versorgung bleibt bestehen, die Kosten für die Verordnung häuslicher Krankenpflege wurden hier aber nicht berücksichtigt. Ungeklärt ist auch die Kostenträgerschaft für die Behandlungspflege in Pflegeeinrichtungen nach SGB XI. (Rehwinkel, BALK-Info, Juni `99, S.10 ff)
Eine Nachbesserung wäre hier angebracht, da hier ebenfalls ein Stellenabbau von qualifizierten Pflegepersonal in diesem Bereich droht.
Man kann abschließend feststellen, obwohl die Pflege ein nicht unbedeutender Träger der Gesundheitspolitik ist wurde ihr kaum Beachtung geschenkt. Das Problem der Pflege seine politischen Anliegen und Interessen in die Gestaltung des Gesundheitswesen mit einzubringen, liegt bei ihr selbst. Sie muß sich auf allen Ebenen der Meinungsbildung einbringen und Themen der Gesundheitspolitik aufgreifen und selber weiter entwickeln.
Das trifft auch auf die Diskussionen zur Gesundheitsreform 2000 (z.B. Globalbudget) zu. Öffentlich relevante Vertreter (z.B. Deutscher Pflegerat) müssen auch nach dem Inkrafttreten des GKV-Gesundheitsreform 2000, die Bedeutung der pflegerischen Leistungen allen relevanten Gruppen im Gesundheitswesen vor Augen führen.
6. Schlußbemerkung
Das GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz stellt ohne Zweifel ein Gesetz dar, was eine gute Grundlage für eine umfassende Reform auf der Basis des Solidar- und Sachleistungsprinzip bietet. Man muß allerdings die Frage stellen, ob in Bezug auf die notwendige Modernisierung und langfristige Stabilisierung der GKV eine Weiterentwicklung der wettbewerblichen Orientierung nicht vorteilhafter gewesen wäre ?!
Die rot-grüne Bundesregierung verweist in ihren Argumentationspapier zum GKV-SolG auf die ,,Eckpunkte einer Strukturreform" die unter anderem die Stärkung der Prävention, Selbsthilfe und Patientenrechte beinhalten. Im Vorschaltgesetz sind bereits Ansätze für eine Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung (Zahnmedizinische Prophylaxe/ Zahnerhaltung) zu erkennen. Ein sozial gerechtes Krankenversicherungssystem müßte auch die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung aller PatientenInnen achten und ihre Eigenkompetenz stärken. Dieses setzt allerdings Wahlmöglichkeiten voraus, und diese wiederum bedeuten automatisch Wettbewerb. Die vorliegende Regelung im Artikel 1, §13, Abs. 2 (Wahl der Kostenerstattung für freiwillige Mitglieder) betrifft nun aber nur einen begrenzten Kreis der Versicherten.
Folgt das vorliegende Gesetz dieser auf Selbstbestimmung sowie wettbewerbliche Steuerung ausgerichtete Reformperspektive auch wirklich ?
Es zeigt sich, das ein bloßes Krisenmanagement nur begrenzt, grundsätzliche Herausforderungen einer finanzierbaren, leistungsfähigen und sozial gerechten Gesundheitspolitik verfolgen kann. Für die weitere Entwicklung der GkV werden weiterhin Diskussionen notwendig sein, auf welche Weise Rationalisierungsreserven im Versorgungssystem angegangen werden können, in bezug auf die Qualität und Humanität der Patientenversorgung sowie zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.
Literaturliste
Beck-Texte, Sozialgesetzbuch, München, dtv, 25.Auflage, 1999
Bundesministerium für Gesundheit, Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998 Teil I Nr. 85, Gesetz zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung, Bonn, Dez. 1998
Bundesministerium für Gesundheit, Argumentationspapier zum Gesetz der Fraktion SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung, Stand: Dez. 1998
,,http://www.bmgesundheit.de/themen/gkv/diskus/übersi2.htm"
Bundesministerium für Gesundheit, Pressemitteilung Nr. 99, 16.12.99
,,http://www.dialog-gesundheit.de:80/Presse2/Pressemitteilungen/1612.htm"
Bundesministerium für Gesundheit, Andrea Fischer, Bundesministerin für Gesundheit, Thema der Woche, v. 06.01.00
,,http://www.dialog-gesundheit.de:80/ThemaderWoche2/ ThemaderWoche25.htm"
Rehwinkel I., BALK-Info, Juni 1999, Artikel: Standpunkt- Anlaß zur Sorge- Das Eckpunkte- Papier zur Gesundheitsreform 2000 läßt viele Fragen zur pflegerischen Versorgung offen
Zerche/ Gründger, Sozialpolitik, Düsseldorf, Werner-Verlag, 2.Auflage, 1996
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Vorschaltgesetz?
Das Vorschaltgesetz, offiziell das "Gesetz zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung" (GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz - GKV-SolG), war ein Sofortprogramm der neuen Bundesregierung von SPD und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, das am 19.12.1998 auf den Weg gebracht wurde und am 01.01.1999 in Kraft trat. Es nahm zahlreiche Regelungen der 3. Stufe der Gesundheitsreform zurück und zielte darauf ab, eine sozial gerechte Krankenversicherung wiederherzustellen, die auf dem Solidar- und Sachleistungsprinzip beruht.
Was waren die sozial- und gesundheitspolitischen Ziele der neuen Bundesregierung?
Die neue Bundesregierung setzte sich als primäre Aufgabe die Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme und die Senkung der Lohnnebenkosten. Dies sollte durch den Abbau der Arbeitslosigkeit und Strukturreformen erreicht werden, unterstützt durch eine ökologische Steuer- und Abgabenreform. Ein wichtiges Ziel war die dauerhafte Stabilisierung der Krankenversicherungsbeiträge.
Was beinhaltete die geplante Strukturreform der Krankenversicherung?
Die Strukturreform umfasste mehrere Punkte, darunter: die Streichung medizinisch fragwürdiger Leistungen und Arzneimittel, die Einführung eines Globalbudgets, die Stärkung der hausärztlichen Versorgung, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Krankenhäusern, die Neuordnung des Arzneimittelmarktes, die Neuordnung der Vergütungssysteme, der Vorrang von Rehabilitation vor Frühverrentung und Pflege, die Reform der ärztlichen Ausbildung, sowie die Stärkung der Patientenrechte und der Qualitätssicherung.
Welche Leistungsausgrenzungen und Zuzahlungen wurden zurückgenommen?
Das Gesetz sah eine Absenkung der Arzneimittelzuzahlung, eine Veränderung der Regelung für chronisch Kranke, die Wiedereinführung von Zahnersatz für Kinder und Jugendliche und die Rechtsgrundlage für Ernährungstherapeutika vor. Auch die bereits gesetzlich vorgesehenen Zuzahlungserhöhungen für das Jahr 1999 wurden herausgenommen.
Was war die veränderte Chronikerregelung?
Die neue Belastungsgrenze für chronisch Kranke besagte, dass diejenigen, die Zuzahlungen zu Fahrkosten, Arznei-, Verband- und Heilmitteln in Höhe von 1 v.H. der Jahresbruttoeinnahmen leisten müssen und wegen derselben Krankheit in dauernder Behandlung sind, für die Fortdauer der Behandlung von der Zuzahlung befreit sind. Alle zwei Jahre ist die Dauerbehandlung nachzuweisen.
Was bedeutete die Aussetzung des Krankenhausnotopfers?
Für die Jahre 1998 und 1999 wurde diese Zahlung aufgehoben und dann auf Dauer abgeschafft. Bereits erfolgte Zahlungen wurden von den Krankenkassen zurückerstattet.
Welche Elemente der privaten Krankenversicherung wurden zurückgenommen?
Elemente wie Selbstbehalt, Beitragsrückzahlungen, Zuzahlungserhöhungen und erweiterte Leistungen durch Satzungsregelungen wurden zurückgenommen, da sie den solidarischen Ausgleich beeinträchtigen und Fehlsteuerungen verursachen könnten. Die Wahlmöglichkeit zwischen Sachleistung und Kostenerstattung wurde auf freiwillig Versicherte beschränkt.
Wie wurde die Ausgabenbegrenzung vorläufig geregelt?
Um die Stabilität des Beitragssatzes zu sichern, wurden die Ausgaben der Kassen vorläufig begrenzt, so dass sie sich nur im Volumen verändern, wenn sich die beitragspflichtigen Einnahmen erhöhen. Für 1999 wurden Budgetierungsregelungen für die wichtigsten Leistungsbereiche eingeführt.
Welche Bereiche umfasste die Budgetierung?
Die Budgetierungen umfassten die Bereiche: vertragsärztliche Versorgung, vertragszahnärztliche Versorgung, stationäre Krankenhausversorgung, Arznei- und Heilmittel, sowie Preisbegrenzungen für Rettungsdienste, Heilmittel und Zahnersatz.
Was waren die Konsequenzen für die Pflege?
Es gab Bedenken, dass die Budgetierungen und die Berichtigungsrate in der Bundespflegesatzverordnung sich negativ auf die Vergütung der Pflegenden und auf die Personalkosten in Krankenhäusern auswirken könnten. Es wurde auch auf die ungeklärte Kostenträgerschaft für die Behandlungspflege in Pflegeeinrichtungen nach SGB XI hingewiesen.
Wie wurde das Gesetz für das Jahr 1999 finanziert?
Die Finanzierung erfolgte durch Einsparungen bei den Arznei- und Heilmittelbudgets, Mehreinnahmen durch die Einbeziehung geringfügig Beschäftigter in die GKV, und die Wiedereinführung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
- Quote paper
- Joachim Müller (Author), 2000, Auf dem Wege zur Gesundheitsreform 2000 - das Vorschaltgesetz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96580