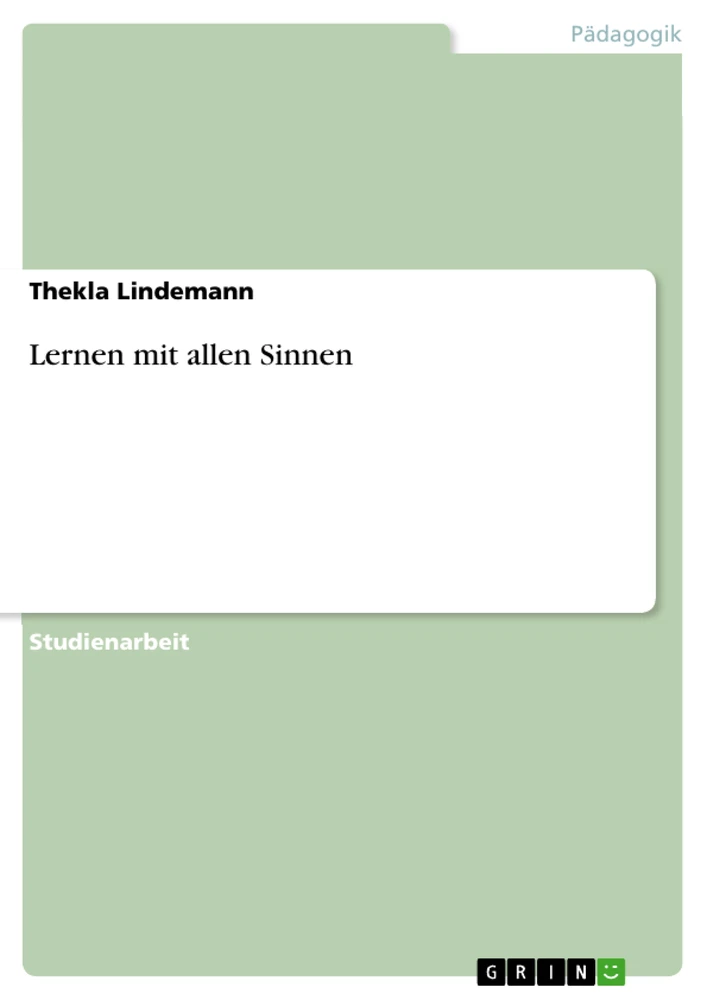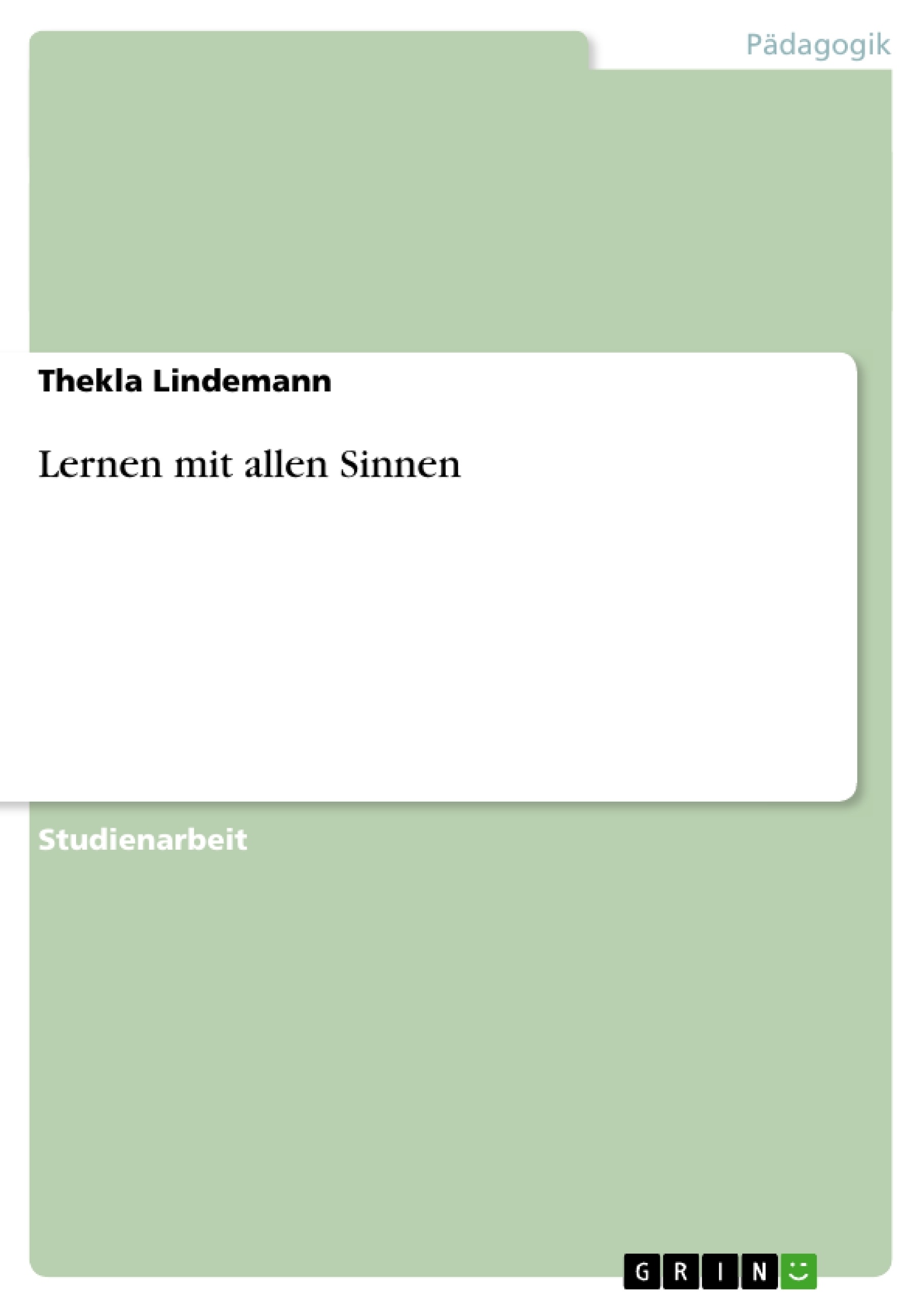Herkömmliche Unterrichtsmethoden scheinen den Schüler der heutigen Zeit nicht mehr so zu erreichen, wie es von den meisten Pädagogen gewünscht wird. Aus diesem Grund werden immer wieder neue Methoden entwickelt, von denen man sich erhofft, daß der Schüler aufgrund dieser ein besseres Lernverständnis erzielt. Diese vermeintlich neuen Methoden sind in ihren Ursprüngen teilweise schon sehr alt, können sich aber gerade in den letzten Jahrzehnten einer besonderen Beliebtheit erfreuen. Auch das Lernen mit allen Sinnen, mit dem wir uns in dieser Arbeit beschäftigen, beruht nicht nur auf neuesten Erkenntnissen, da schon Aristoteles Hinweise auf die Bedeutung sinnlicher Wahrnehmungen gab. Im 17. Jahrhundert setzte dann Comenius diese Tradition in seiner Didactica magna fort: „Man möge alles, was die Schüler auswendig lernen sollen, ihnen so klar darlegen und auseinandersetzen, daß sie es wie die eigenen fünf Finger vor sich haben, und damit alles sich leichter einpräge, möge man alle möglichen Sinnestätigkeiten heranziehen.“
Ebenfalls im 17. Jahrhundert prägte Locke den Grundsatz: „Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war.“
Eine andere heute noch oft verwendete Forderung „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ stammt von Pestalozzi. Anhand dieser Forderungen wird deutlich, daß die Idee des Lernens mit allen Sinnen nicht als etwas revolutionär Neues einzuordnen ist.
Verständlicherweise wurden diese Grundsätze nicht nur übernommen, sondern auch weiterentwickelt, so daß man heutzutage - nicht wie zu Zeiten der Reformpädagogik - von einer Trennung sinnlicher Erfahrungen und geistiger Erkenntnis ausgeht. „Sinnlichkeit und Vernunft, Sinne und Verstand sind vielmehr als aufeinander angewiesene Bestandteile einer Einheit zu verstehen, die gleichermaßen in der Erziehung und Bildung von Kindern berücksichtigt werden sollten.“ Anhand unserer Arbeit wollen wir aufzeigen, was man unter dem Begriff Lernen mit allen Sinnen versteht. Hierfür erscheint es uns notwendig, erst einmal die klassischen Sinne zu erläutern, bevor die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung für den Unterricht beschrieben werden kann. Da diese Arbeit im Rahmen eines Seminars für Erstlese- und Erstschreibunterricht verfaßt wird, soll im weiteren von der allgemeinen Bedeutung auf die spezielle Bedeutung hingewiesen werden, woraufhin einige Anregungen für eine unterrichtspraktische Verwirklichung vorgestellt werden.
1. Einleitung
Herkömmliche Unterrichtsmethoden scheinen den Schüler der heutigen Zeit nicht mehr so zu erreichen, wie es von den meisten Pädagogen gewünscht wird. Aus diesem Grund werden immer wieder neue Methoden entwickelt, von denen man sich erhofft, daß der Schüler aufgrund dieser ein besseres Lernverständnis erzielt. Diese vermeintlich neuen Methoden sind in ihren Ursprüngen teilweise schon sehr alt, können sich aber gerade in den letzten Jahrzehnten einer besonderen Beliebtheit erfreuen. Auch das Lernen mit allen Sinnen, mit dem wir uns in dieser Arbeit beschäftigen, beruht nicht nur auf neuesten Erkenntnissen, da schon Aristoteles Hinweise auf die Bedeutung sinnlicher Wahrnehmungen gab. Im 17. Jahrhundert setzte dann Comenius diese Tradition in seiner Didactica magna fort: „Man möge alles, was die Schüler auswendig lernen sollen, ihnen so klar darlegen und auseinandersetzen, daß sie es wie die eigenen fünf Finger vor sich haben, und damit alles sich leichter einpräge, möge man alle möglichen Sinnestätigkeiten heranziehen.“ (Potthoff, 1991, S. 11)
Ebenfalls im 17. Jahrhundert prägte Locke den Grundsatz: „Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war.“ (Zimmer, 1997, S.
Eine andere heute noch oft verwendete Forderung „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ stammt von Pestalozzi. Anhand dieser Forderungen wird deutlich, daß die Idee des Lernens mit allen Sinnen nicht als etwas revolutionär Neues einzuordnen ist.
Verständlicherweise wurden diese Grundsätze nicht nur übernommen, sondern auch weiterentwickelt, so daß man heutzutage - nicht wie zu Zeiten der Reformpädagogik - von einer Trennung sinnlicher Erfahrungen und geistiger Erkenntnis ausgeht. „Sinnlichkeit und Vernunft, Sinne und Verstand sind vielmehr als aufeinander angewiesene Bestandteile einer Einheit zu verstehen, die gleichermaßen in der Erziehung und Bildung von Kindern berücksichtigt werden sollten.“ ( Zimmer, 1997, S. 22-23) Anhand unserer Arbeit wollen wir aufzeigen, was man unter dem Begriff Lernen mit allen Sinnen versteht. Hierfür erscheint es uns notwendig, erst einmal die klassischen Sinne zu erläutern, bevor die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung für den Unterricht beschrieben werden kann. Da diese Arbeit im Rahmen eines Seminars für Erstlese- und Erstschreibunterricht verfaßt wird, soll im weiteren von der allgemeinen Bedeutung auf die spezielle Bedeutung hingewiesen werden, woraufhin einige Anregungen für eine unterrichtspraktische Verwirklichung vorgestellt werden.
Aus Gründen der Vereinfachung verwenden wir in unseren Ausführungen nur die maskuline Form.
2. Erläuterung der einzelnen Sinne
Zu den klassischen Sinnen, die jeweils auf einem eigenen Organ basieren, gehört das Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen. Diese 5 Sinne werden im folgenden kurz erläutert und ihre Bedeutung bezüglich der Wahrnehmung beschrieben.
Erwähnt sei hier allerdings, daß man diesen klassischen Sinnen noch weitere hinzufügen kann. So lassen sich bis zu 13 Sinnesgebiete ausmachen: der Gesichtssinn (Sehsinn), Gehörsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn, Berührungs- und Drucksinn, Temperatursinn, Schmerzsinn, Stellungssinn, Spannungs-/Kraftsinn, Lagesinn, Drehbewegungssinn und die Organempfindungen (Vgl. HERDER 57).
2.1. Der Sehsinn - die visuelle Wahrnehmung
Die meisten Sinneseindrücke von unserer Umwelt erhalten wir über das Auge. Das Sehen läßt sich aber nicht nur auf die Aufnahme optischer Eindrücke reduzieren, sondern hängt vom Standpunkt des Betrachters und dessen Gewohnheiten, Interessen und Stimmungen ab. So werden zum Beispiel gewöhnliche Pflastersteine von verschiedenen Betrachtern unterschiedlich gesehen: ein Künstler stellt Überlegungen an, wie man die Steine aneinanderfügen könnte, ein Kind fragt sich, welche Hüpfspiele es darauf ausführen kann. Das Sehen ist also beeinflußbar und abhängig von der Bedeutung, die der Betrachter den visuellen Reizen zukommen läßt. Durch elektronische Medien, Computerspiele und Fernsehen wird man heutzutage an eine schnelle Bildfolge gewöhnt, die kaum Zeit zum Verarbeiten der Eindrücke läßt. Diese Reizüberflutung führt zu einer Abnahme der Konzentrationsfähigkeit.
Die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit umfaßt somit die Bereiche der Aufnahme, Unterscheidung, Verarbeitung, Einordnung, Interpretation und Reaktion von optischen Reizen. Um sich beispielsweise in einem Raum orientieren zu können, müssen verschiedene Informationen visuell wahrgenommen werden: Wie ist die Strukturierung? Wie ist der Untergrund beschaffen? Gibt es bewegliche oder unbewegliche Hindernisse? Dieses Sehen ermöglicht uns die Steuerung unserer Fortbewegung, die Kontrolle unserer Haltung und die Lokalisation von Reizquellen.
Ein weiterer wichtiger Bereich des Sehens ist das visuelle Gedächtnis, welches uns die Fähigkeit gibt, innere Bilder zu produzieren. Es handelt sich also um die Erinnerung an Gesehenes; eine Voraussetzung für die kognitive Entwicklung.
2.2. Der Hörsinn - die auditive Wahrnehmung
Die Ohren nehmen verschiedene Töne, Klänge und Geräusche wahr, die ihren Ursprung - ähnlich wie beim Sehsinn - in der Umwelt haben. Allerdings kann man die Reize selten „überhören“, da sich die Ohren nicht einfach schließen lassen, wie es den Augen möglich ist. Unser Gehör ist eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung von Sprache. Durch die Unterscheidung akustischer Reize und das Sortieren dieser, wird ein Bedeutungszusammenhang erstellt, der uns ein Sprachverständnis ermöglicht.
Die auditive Wahrnehmung erfüllt noch weitere Funktionen: die akustische Richtungswahrnehmung, die Bewegung von Schallquellen wird erfaßt, Nebengeräusche können aus ihrem Hintergrund herausgehört werden und eine Merkfähigkeit/Speicherung von Gehörtem kann abgerufen werden. Dieses auditive Gedächtnis ist eine Grundlage des Lesenlernens, da die Fähigkeit, eine Reihenfolge von Buchstaben oder Wörtern zu behalten, gegeben ist.
Die Konzentrationsfähigkeit bezüglich des Hörens wird durch das Schließen der Augen intensiviert, da ablenkende visuelle Reise vermieden werden.
2.3. Der Tastsinn - die taktile Wahrnehmung
Der Tastsinn basiert auf dem größten sensorischen Organ: der Haut. Da sie quasi die Hülle unseres Körpers ist, können wir auch mit unserem gesamten Körper fühlen (tasten) und passive Reize (Berührungen) erleben. Die Hände und Fußsohlen sind für Reizempfindungen besonders zugänglich. Man kann insbesondere mit den Händen Formen, Maße, Proportionen und die Ober-flächenbeschaffenheit ertasten. Um die Konsistenz eines Gegenstandes zu erfahren, muß allerdings der sogenannte Drucksinn hinzugezogen werden.
Es lassen sich durch den Tastsinn also verschiedene Informationen über einen Gegenstand erfahren, doch benötigen wir für konkrete Details oftmals noch weitere Sinnesbereiche. So kann man schließlich die Farbe einer Sache nicht ertasten. Um Temperaturen oder Schmerzen zu fühlen, wird hingegen nur der Tastsinn angesprochen.
Wie auch beim Hörsinn erhöht sich die Konzentrationsfähigkeit für den Tastsinn, wenn die Augen geschlossen sind. Berührungen werden intensiver erlebt.
Der Tastsinn enthält zudem noch eine soziale Komponente, da ab der Geburt Berührungen für den Säugling sehr wichtig sind und mit Bedeutungen wie Zärtlichkeit, Wärme und Schutz verbunden sind. Es wird eine Kommunikationsebene aufgebaut, die allein auf Berührungen basiert: „Die taktile Kommunikation ist die erste Sprache des Kindes, auf der die verbale Sprache aufbaut.“ ( Zimmer, 1997, S. 110)
2.4. Der Geruchssinn - die olfaktorische Wahrnehmung
Durch unsere Nase nehmen wir ständig verschiedene Gerüche wahr, die sich schnell in unsere Gedächtnis einprägen und oftmals mit Emotionen verbunden sind. So erinnern wir uns beim Geruch von Sonnenmilch vielleicht an den letzten Urlaub, Schweißgeruch läßt uns an Sport denken oder wir werden über unsere Nase darüber informiert, daß es irgendwo brennen könnte.
Weiterhin können ätherische Düfte wohltuend, heilend oder auch anregend wirken, so daß sich die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Allerdings sollte die Nase nicht „überstrapaziert“ werden, denn zu starke Gerüche können als unangenehm empfunden werden.
2.5. Der Geschmackssinn - die gustatorische Wahr- nehmung
Bei der Nahrungsaufnahme können wir nur 4 Geschmacksrichtungen empfinden: süß, salzig, sauer und bitter. Von diesen Grundempfindungen werden dann wiederum Unterbereiche kombiniert. Da unser Geschmackssinn durch die Lebensmittelindustrie bezüglich chemischer Aromastoffe stark manipuliert wird, sollte man versuchen, die Geschmacksnerven mehr zu sensibilisieren. „Der Sinn der Sinne liegt darin, süß von süß, sauer von sauer, bitter von bitter zu unterscheiden, und darin, das Bittere in Süßem, das Saure in Salzigem zu erschmecken.“ (Zimmer, 1997, S. 151)
2.6. Das Zusammenwirken aller Sinne
Unsere sinnliche Wahrnehmung beschränkt sich nur in selten Fällen auf einen einzigen Sinnesbereich. Läuft man beispielsweise durch den Regen, wirken alle Sinne zusammen: man sieht den Regen, man fühlt ihn auf der Haut, man riecht den feuchten Rasen, man hört das Plätschern und man kann die Wassertropfen sogar schmecken.
Einfachste Wahrnehmungsprozesse entstehen also durch die Kooperation aller Sinne (sensorische Integration). „Durch die sensorische Integration wird erreicht, daß alle Abschnitte des Zentralnervensystems miteinander zusammenarbeiten und damit eine sinnvolle und angemessene Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt möglich ist.“ (Zimmer, 1997, S. 156)
Allerdings hat jede Person bevorzugte oder unterschiedlich oft eingesetzte Sinnesbereiche. Um größtmöglichen Erfolg zu haben, sollte ein Lehrer alle Sinne seiner Schüler aktivieren und nicht nur sein eigenes bevorzugtes Wahrnehmungssystem verwenden (Vgl.: Zwissig / Perren-Klingler, 1995, S. 27).
3. Die Bedeutung der Sinne im Unterricht allgemein
Wie in Kapitel 2 schon in den Darstellungen der einzelnen Sinnesbereiche erwähnt wurde, fördert die Aktivität aller Sinne die Konzentrationsbereitschaft und insbesondere das Erinnerungs-vermögen.
F. Zwissig und G. Perren-Klingler schreiben dazu: „Jede menschliche Erfahrung basiert auf den 5 Sinnen. Die Erinnerung an eine Erfahrung wird durch die innere sensorielle Repräsentation gespeichert Die 5 Sinne sind somit die Basiselemente unseres äußeren (gezeigte Emotionen und Aktionen) wie auch inneren Verhaltens (Gedanken, Emotionen, Phantasien, Verständnis) Ein Kind, das „klar sehen“ muß, um zu verstehen, bevorzugt das Visuelle. Ein Kind, dem vorgelesen werden muß, damit es versteht, bevorzugt das Auditive. Ein Kind, das machen, berühren oder spüren muß, um zu verstehen, bevorzugt das Kinästhetische.“ (1995, S. 27)
Durch die Einbeziehung der Sinne im Unterricht können Lerninhalte mit positiven Emotionen verbunden und innere Bilder geschaffen werden, die länger im Gedächtnis haften bleiben.
Sowohl der Geschmackssinn als auch der Geruchssinn spielen im Unterricht wohl eher eine untergeordnete Rolle, obwohl durch angenehme Gerüche eine entspannte und anregende Atmosphäre, die zur Wissensaufnahme beitragen kann, geschaffen wird.
Um die Schüler durch Lernen mit allen Sinnen für eine sensiblere Aufnahmefähigkeit zu öffnen, sollte der Lehrer ihnen hierfür ausreichend Zeit zur Verfügung stellen. „Wer zum schnellen Aufnehmen gedrängt wird, muß sich notgedrungen mit der Beachtung besonders auffälliger Signale zufriedengeben. Erst das gedrosselte Arbeitstempo, das sich nach der individuell benötigten Verweildauer richten muß, eröffnet die Chance zum differenzierten Aufnehmen, zum abwägenden Identifizieren und Vergleichen feinerer Nuancierungen.“ (Potthoff, 1991, S. 20) Weiterhin muß beachtet werden, daß zahlreiche Wiederholungen nötig sind, damit der Schüler seine Wahrnehmung durch die Sinne selbst entdecken kann und er so befähigt wird, eine eigenständige Sinnesschulung weiterzuführen (Vgl.: a. a. O., S. 20).
3.1. Lernen mit allen Sinnen im Erstlese- und Erstschreibunterricht
Von Geburt an erleben die Menschen alles Neue ganz intensiv über ihre Sinne. Gegenstände werden befühlt, hochgehoben, gedreht, berochen und geschmeckt. Auf diese Weise wird alles über die Sache in Erfahrung gebracht, wahrgenommen und gespeichert. Doch mit fortschreitendem Alter neigen unsere Sinne dazu abzustumpfen. Gründe hierfür liegen beispielsweise in der Reizüberflutung durch rasch wechselnde Bildfolgen im Fernsehen oder ganz einfach durch zuviel Koffeingenuß, der den Geschmackssinn beeinträchtigt.
Um neue Erfahrungen stets intensiv verarbeiten zu können, sollte eine Sinnesschulung stattfinden. Die Einschulung bietet hierfür einen geeigneten Zeitpunkt, da die Kinder noch nicht „abgestumpft“ sind und viele neue Eindrücke und Lerngegenstände auf sie zukommen. Im Erstlese- und Erstschreibunterricht ist ein Lernen mit allen Sinnen somit von großem Vorteil für die Kinder. Durch ein erlebnisreiches und emotionales Lernen können zum Beispiel Buchstaben besser in Erinnerung bleiben. Verbindet man sie mit einer Geschichte, werden positive Gefühle geweckt und eine leichtere Speicherung gewährleistet. Ähnlich verhält es sich mit bildhaften Materialien wie Wort-Bildkarten.
Eine entspannte Atmosphäre mit musikalischen Beiträgen, Tastspielen zum Erkennen von Buchstaben, Bewegungsspielen oder auch Buchstaben „aufessen“ führt zu höherer Aufnahmefähigkeit (Vgl.: Grimm, 1996, S. 8-9).
Unterrichtsgestaltungen dieser Art sind abwechslungsreich und können sich trotzdem um ein und denselben Buchstaben handeln, so daß es den Kindern ermöglicht wird, sich an die Buchstaben mittels vielfältiger Assoziationen zu erinnern. Von großer Wichtigkeit ist hierbei auch das Gefühl, Erfolge beim Lernen zu verzeichnen, was aufgrund der verschiedenen Aktionen sicherlich gewährleistet ist.
Einem monotonen, „grauen“ Schulalltag wird vorgebeugt und der Hörsinn durch anhaltende Lehrervorträge nicht überlastet. Die Kinder können somit ein positives Lerngefühl erfahren und die vielen neuen Eindrücke zu Beginn ihrer Schulzeit besser, intensiver und länger anhaltend verarbeiten.
4. Anregungen für eine unterrichtspraktische Verwirk- lichung am Beispiel des Buchstaben A
Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise mit der Methode Lernen mit allen Sinnen folgen nun einige Beispiele, wie die Kinder mit dem Buchstaben A arbeiten können und ihn hierdurch verinnerlichen. Die Beispiele entstammen dem Buch „ABC mit allen Sinnen“ von Helga Grimm oder wurden von uns selbst beim Verfassen dieser Hausarbeit entwickelt.
- Apfelbäume basteln
Aus braunem Karton werden Apfelbäume ausgeschnitten. In Zeitschriften und Werbeanzeigen findet man viele rotgedruckte „a“, „A“. Die Kinder schneiden sie aus und kleben sie in die Apfelbäume. (Grüne „B“ können als Blätter hinzugefügt werden.)
- Bewegungsspiel
Fünf Kinder legen sich auf den Boden und bilden so ein großes „A“ und dann ein kleines „a“. Das A versucht an eine andere Stelle zu rutschen, ohne seine Form zu verändern.
- Das A-Angelspiel
Es werden kleine Karten mit Wörtern (mit und ohne „a“) und entsprechenden Bildern versehen. An die Karten werden Büroklammern aus Metall geheftet und alle in ein Gefäß gelegt. Ein Magnet wird an einem Bleistift mit Bindfaden befestigt, so daß man damit die Wortkarten aus dem Gefäß herausangeln kann. Die Kinder müssen sagen, wieviel „a“ in dem Wort vorhanden sind.
- Tastspiele
Mit einem dicken Klebeband ein großes „A“ und ein kleines „a“ auf dem Fußboden befestigen und die Kinder mit verbundenen Augen und ohne Schuhe darüberbalancieren lassen.
Aus stabiler Pappe (evtl. Holz) Buchstaben anfertigen und in ein Säckchen legen. Die Kinder sollen mit verbundenen Augen einen Buchstaben ziehen und ihn anhand seiner Form erkennen. (Nur mit mehreren Buchstaben möglich!)
- Das „A“ schmecken
Die Kinder bringen Nahrungsmittel mit, die mit dem Buchstaben „A“ beginnen (Apfel, Ananas, Artischocken, Apfelsine) und riechen daran. Anschließend sollten sie probiert werden.
Bei den genannten Beispielen handelt es sich um eine willkürliche Auswahl von Anregungen. Jeder Lehrer sollte eigene Ideen ausprobieren und verwirklichen, um über eine Vielzahl von Angeboten zu verfügen und einen abwechslungsreichen Unterricht gestalten zu können.
5. Schlußbemerkung
In der heutigen Zeit werden die Sinne der Kinder nicht mehr ausreichend gefördert. Fernseher, Stereoanlagen sowie der Walkman belasten Auge und Ohr sehr stark. Industriell angefertigtes Essen, Tiefkühlkost und Fast Food ist geschmacklich genormt, so daß kaum geschmackliche Nuancen ausgemacht werden können und man fast nur noch Geschmacksverstärker auf der Zunge spürt. Zuneigung und Liebe verbunden mit Berührungen, wie Streicheln oder Kuscheln werden in einer Gesellschaft, in der beide Elternteile berufstätig sind, immer seltener. Autoabgase, andere Umweltverunreinigungen sowie das Großstadtleben lassen kaum Spielraum für einen ausgeprägten Geruchssinn. Die Sinne werden also kaum noch beansprucht, gefordert und somit so gut wie gar nicht mehr gefördert.
Das Zusammenspiel der einzelnen Sinne ist für das Verständnis der Umwelt von besonderer Wichtigkeit. In einer Welt, in der Entwicklung und Erziehung des Kindes so vernachlässigt werden, ist die Schule gefordert und sollte daher die Sinneswahrnehmung der Schüler ansprechen. Beim Lernen mit allen Sinnen geschieht einerseits diese Förderung, andererseits wird die Verständnisfähigkeit des Schülers bei einem bestimmten Sachverhalt angesprochen und ihm so ein Konzept gegeben, diesen Sachverhalt besser zu verinnerlichen. Lernen mit allen Sinnen erfüllt somit mehrere Aufgaben und sollte deshalb für den Unterricht genutzt werden, wobei es unserer Ansicht nach nicht nur und bei jedem Sachverhalt zur Anwendung kommen sollte, sondern zu einem gesunden Zusammenspiel mehrerer Unterrichtsmethoden.
Obwohl wir keinerlei praktische Erfahrung mit Lernen mit allen Sinnen aufweisen können, sprechen wir uns zumindest für einen Versuch aus, diese Methode im Erstlese- und Erstschreibunterricht zu verwenden. Hierbei steht für uns allerdings nicht nur die Förderung der Sinne im Vordergrund, sondern die Annahme, daß jeder Schüler ein Individuum ist und somit nicht jeder auf die gleiche Art und Weise lernt.
Schreiben und Lesen ist außer dem Rechnen wohl die wichtigste Grundlage unserer Bildung. Damit gewährleistet ist, daß jeder Schüler wirklich die Möglichkeit hat, dieses zu erlernen, ist eine Methodenvielfalt sicherlich vorteilhaft. Sinnliche Erfahrungen dürften vielen Kindern helfen, ein besseres Lernverständnis zu entwickeln.
Literaturverzeichnis
Feldhaus, C.: Lernen mit allen Sinnen - Offene Unterrichtssituationen am Beispiel des Sachunterrichts. Hamburg: Kovac, 1995.
Grimm, H.: ABC mit allen Sinnen. Lichtenau: AOL - Verlag, 6. Aufl., 1996
Potthoff, W.: Lernen und Üben mit allen Sinnen. Freiburg: Reformpädagogischer Verlag Jörg Potthoff, 1991
Zimmer, R.: Handbuch der Sinneswahrnehmung - Grundlagen einer ganzheitlichen Erziehung. Freiburg / Basel / Wien: Herder, 5. Aufl., 1995
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über das Lernen mit allen Sinnen?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Lernens mit allen Sinnen im Unterricht, insbesondere im Erstlese- und Erstschreibunterricht. Sie erläutert die klassischen Sinne, ihre Bedeutung für die Wahrnehmung und gibt Anregungen für die praktische Umsetzung im Unterricht.
Welche Sinne werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die klassischen fünf Sinne: Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken. Sie geht auch auf das Zusammenspiel dieser Sinne ein.
Was wird unter visueller Wahrnehmung verstanden?
Visuelle Wahrnehmung umfasst die Aufnahme, Unterscheidung, Verarbeitung, Einordnung, Interpretation und Reaktion auf optische Reize. Sie ist abhängig vom Betrachter und dessen Erfahrungen.
Welche Bedeutung hat die auditive Wahrnehmung?
Die auditive Wahrnehmung ist wesentlich für die Entwicklung von Sprache und Sprachverständnis. Sie ermöglicht die Unterscheidung akustischer Reize und die Erstellung von Bedeutungszusammenhängen.
Welche Rolle spielt der Tastsinn?
Der Tastsinn, basierend auf der Haut, ermöglicht das Fühlen von Formen, Maßen, Oberflächenbeschaffenheit und Temperaturen. Er hat auch eine soziale Komponente, da Berührungen wichtige Bedeutungen wie Zärtlichkeit und Schutz vermitteln.
Welche Bedeutung haben Geruchs- und Geschmackssinn im Unterricht?
Obwohl sie im Unterricht eher eine untergeordnete Rolle spielen, können angenehme Gerüche eine entspannte und anregende Atmosphäre schaffen. Der Geschmackssinn wird oft durch chemische Aromastoffe manipuliert.
Was bedeutet sensorische Integration?
Sensorische Integration bezeichnet das Zusammenwirken aller Sinne, um eine sinnvolle und angemessene Auseinandersetzung mit der Umwelt zu ermöglichen.
Warum ist das Lernen mit allen Sinnen im Unterricht wichtig?
Das Lernen mit allen Sinnen fördert die Konzentrationsbereitschaft, das Erinnerungsvermögen und kann Lerninhalte mit positiven Emotionen verbinden. Es berücksichtigt unterschiedliche Wahrnehmungssysteme der Schüler.
Welche Vorteile bietet das Lernen mit allen Sinnen im Erstlese- und Erstschreibunterricht?
Es ermöglicht ein erlebnisreiches und emotionales Lernen, wodurch Buchstaben besser in Erinnerung bleiben. Es beugt einem monotonen Schulalltag vor und überlastet den Hörsinn nicht.
Welche praktischen Anregungen gibt die Arbeit für den Unterricht?
Die Arbeit gibt konkrete Beispiele für die Arbeit mit dem Buchstaben A, wie Apfelbäume basteln, Bewegungsspiele, Tastspiele, das A-Angelspiel und das Schmecken von Lebensmitteln, die mit dem Buchstaben A beginnen.
Welche Kritik wird an der heutigen Förderung der Sinne geübt?
Die Sinne der Kinder werden heutzutage oft nicht ausreichend gefördert, da sie durch Fernsehen, Stereoanlagen und industriell gefertigte Lebensmittel stark belastet werden. Auch Zuneigung und Liebe verbunden mit Berührungen kommen zu kurz.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schule ist gefordert, die Sinneswahrnehmung der Schüler anzusprechen. Das Lernen mit allen Sinnen fördert einerseits die Sinne und spricht andererseits die Verständnisfähigkeit des Schülers an und sollte ein Element eines gesunden Zusammenspiels mehrerer Unterrichtsmethoden sein.
- Quote paper
- Thekla Lindemann (Author), 1998, Lernen mit allen Sinnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96521