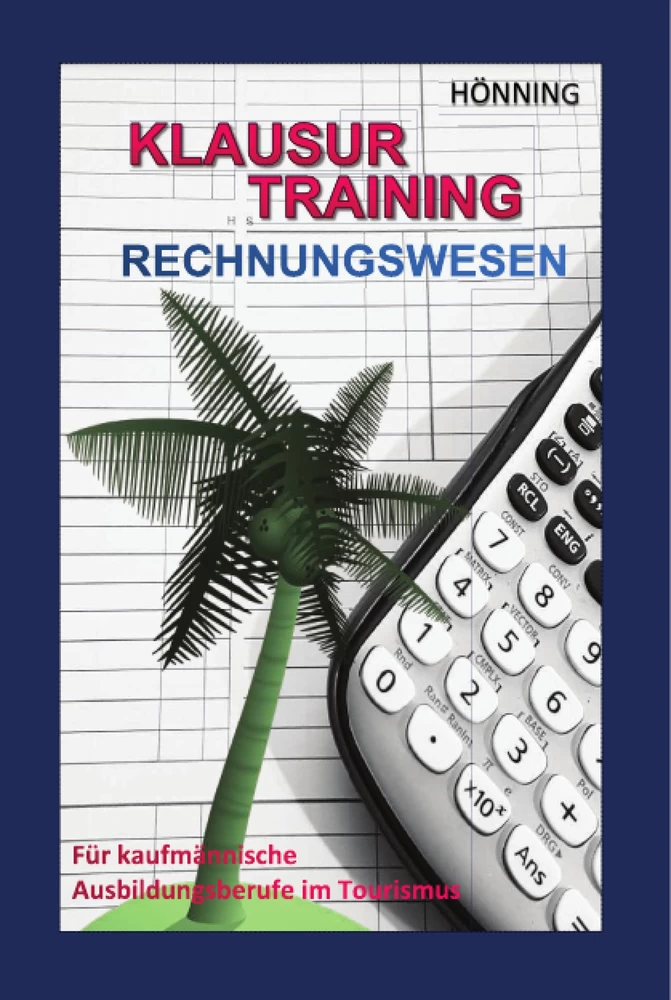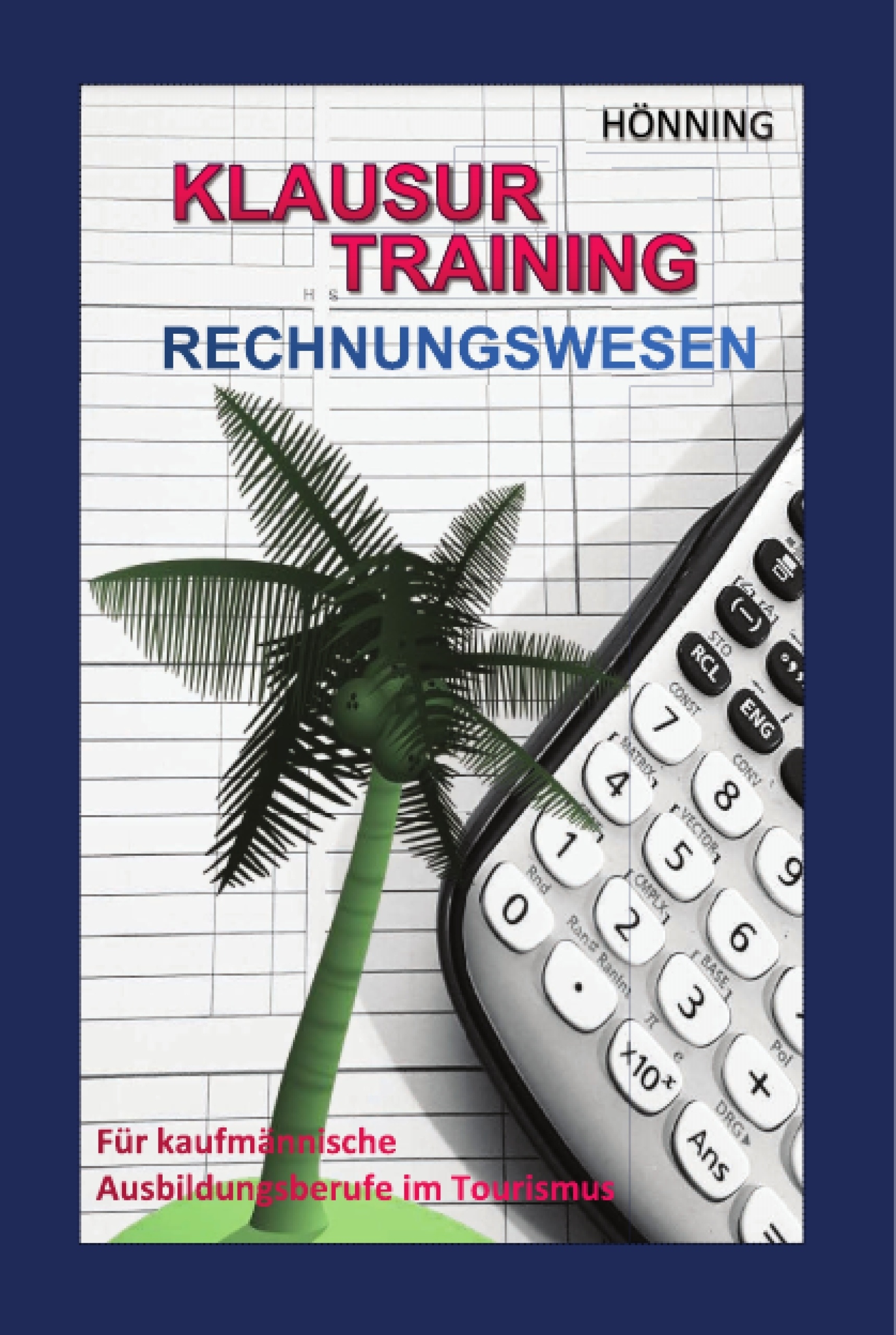Dieses Arbeitsbuch soll jedem Auszubildenden im Tourismusbereich die Möglichkeit geben, das Fach Rechnungswesen zu verstehen und anwenden zu können. Es soll außerdem Auszubildende im Bereich Tourismus und Freizeit auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Dabei decken die einzelnen Kapitel des Rechnungswesens den größten Teil des Rahmenlehrplans für Kaufleute für Tourismus und Freizeit ab.
Einer der großen Vorteile ist der starke Praxisbezug in den verschiedenen Aufgaben und Erläuterungen. Alle Theorie- und Rechenaufgaben sind nicht nur praxisorientiert, sondern werden durch verschiedene, teils sehr komplexe Erläuterungen verständlich vermittelt. Dieses Buch kann auch für Studierende in Grundlagenbereichen der Buchhaltung sehr hilfreich sein.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. GRUNDLAGEN DES RECHNUNGSWESENS
1.1 AUFGABEN UND BEGRIFFE DER BUCHHALTUNG
1.2 GRUNDZÜGE ORDNUNGSGEMÄSSER BUCHHALTUNG (GoB)
2. INVENTUR | INVENTAR
2.1 INVENTUR
2.2 INVENTAR
3. BILANZ
3.1 GRUNDLAGEN DER BILANZ
3.2 WERTBEWEGUNGEN IN DER BILANZ
4. BESTANDSKONTEN
4.1 GRUNDLAGEN DER BESTANDSKONTEN
4.2 AUFLÖSEN DER BILANZ IN BESTANDSKONTEN
4.3 BUCHEN AUF BESTANSKONTEN
4.4 BUCHEN VON GESCHÄFTSFÄLLEN
4.5 VON DER ERÖFFNUNGSBILANZ ZUR SCHLUSSBILANZ
5. ERFOLGSKONTEN UND GUV
5.1 GRUNDLAGEN DER ERFOLGSKONTEN
5.2 BUCHEN VON ERFOLGSKONTEN
5.3 BUCHEN AUF DAS GuV - KONTO
5.4 ABSCHLUSS DER ERFOLGSKONTEN ÜBER DAS GuV - KONTO
6. DIE UMSATZSTEUER
6.1 MEHRWERTSTEUER IN DEUTSCHLAND
6.2 VORSTEUER & UMSATZSTEUER
6.3 VORSTEUERÜBERHANG
6.4 ZAHLLAST
7. PRIVATENTNAHMEN | PRIVATEINLAGEN
7.1 DAS PRIVATKONTO
7.2 UMSATZSTEUER BEI PRIVATENTNAHMEN
7.3 NUTZUNG EINES GESCHÄFTSWAGENS
8. GESCHÄFTSFÄLLE IM WARENVERKEHR
8.1 WARENKONTEN
8.2 BUCHEN VON PREISNACHLÄSSEN
8.3 BUCHEN VON RÜCKSENDUNGEN
8.4 BUCHUNG BEIM WARENVERKAUF
9. SACHANLAGENBEREICH
9.1 GRUNDZÜGE DER ABSCHREIBUNG
9.2 LINEARE ABSCHREIBUNG
9.3 DEGRESSIVE ABSCHREIBUNG
9.4 LEISTUNGSBEZOGENE ABSCHREIBUNG
9.5 AFA - METHODENWECHSEL
9.6 AUSSERPLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG
10. GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER
10.1 GRUNDLAGEN DER GWG
10.2 BUCHEN UND ABSCHREIBUNG VON GWG
11. LÖSUNGEN
11.1 LÖSUNGEN ZUM ERSTEN KAPITEL
11.2 LÖSUNGEN ZUM ZWEITEN KAPITEL
11.3 LÖSUNGEN ZUM DRITTEN KAPITEL
11.4 LÖSUNGEN ZUM VIERTEN KAPITEL
11.5 LÖSUNGEN ZUM FÜNFTEN KAPITEL
11.6 LÖSUNGEN ZUM SECHSTEN KAPITEL
11.7 LÖSUNGEN ZUM SIEBTEN KAPITEL
11.8 LÖSUNGEN ZUM ACHTEN KAPITEL
11.9 LÖSUNGEN ZUM NEUNTEN KAPITEL
11.10 LÖSUNGEN ZUM ZEHNTEN KAPITEL
12. KONTENLISTE
12.1 BESTANDSKONTEN
12.2 ERFOLGSKONTEN
13. NOTIZEN
Vorwort
Dieses Arbeitsbuch soll jedem Auszubildenden im Tourismusbereich die Möglichkeit geben, das Fach Rechnungswesen verstehen und anwenden zu können.
Einer der großen Vorteile ist der starke Praxisbezug in den verschiedenen Aufgaben und Erläuterungen. Alle Theorie- und Rechenaufgaben sind nicht nur praxisorientiert, sondern werden durch verschiedene, teils sehr komplexe Erläuterungen verständlich vermittelt. Die einzelnen Kapitel des Rechnungswesens decken den größten Teil des Rahmenlehrplans für Kaufleute für Tourismus und Freizeit ab.
München, 06. November 2020 Alina Fränzi Hönning
1. GRUNDLAGEN DES RECHNUNGSWESENS
1.1 AUFGABEN UND BEGRIFFE DER BUCHHALTUNG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.1.1 Definieren Sie den Begriff Das Rechnungswesen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.1.2 Wofür sind alle Kaufleute gemäß §238 Abs. 1 HGB verpflichtet?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.1.3 Ordnen Sie folgende Aufgaben des Rechnungswesens ihren Definitionen zu: Kontrolle | Dokumentation | Planungs - und Dispositionsfunktion.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.1.4 Vervollständigen Sie die Abbildung Bereiche des Rechnungswesens:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.1.5 Nennen Sie fünf wichtige Aufgaben der Buchführung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.1.6 Was ist der Unterschied zwischen Fremd - und Eigenbelege
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2 GRUNDZÜGE ORDNUNGSGEMÄSSER BUCHHALTUNG (GoB)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.2.1 Was sind die Grundzüge der ordnungsgemäßen Buchführung?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. INVENTUR | INVENTAR
2.1 INVENTUR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1.1. Erläutern Sie die Inventur. Wozu sind alle Kaufleute laut §242 HGB zusätzlich verpflichtet?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1.2 Setzen Sie die fehlenden Begriffe so ein, dass die richtigen Aussagen entstehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1.3 Unterscheiden Sie die Inventurverfahren nach der zeitlichen Umsetzung. Was sind eventuelle Probleme?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2.2 Vervollständigen Sie die Grafik.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.3 Übungsaufgabe 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.4 Übungsaufgabe 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. BILANZ
3.1 GRUNDLAGEN DER BILANZ
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.1.1 Definieren Sie den Begriff Bilanz.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.1.2 Erläutern Sie den Grundsatz der Bilanzgleichung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.1.3 Was verstehen Kaufleute unter dem Begriff Bilanzsumme?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.1.4 Unterscheiden Sie Aktiva und Passiva
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.1.5 Ordnen Sie die Aktivaposten zu den Bereichen Anlagevermögen und Umlaufvermögen: Gebäude | Forderungen | Kassenbestand | BGA | Bankguthaben | Grundstücke | Fuhrpark
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.1.6 Ordnen Sie das Fremdkapital nach ihrer Laufzeit: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | Darlehen | Hypotheken | Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2 WERTBEWEGUNGEN IN DER BILANZ
3.2.1 Erläutern Sie die vier möglichen Bilanzveränderungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. BESTANDSKONTEN
4.1 GRUNDLAGEN DER BESTANDSKONTEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.1.1 Erläutern Sie den Begriff Bestandskonten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2 AUFLÖSEN DER BILANZ IN BESTANDSKONTEN
Merke: Für jeden Bilanzposten wird ein Konto eingerichtet, um eine detaillierte Übersicht hinsichtlich Art, Ursache und Höhe der Bilanzposten zu erhalten. Das Konto wird in der Theorie in T - Form zur genauen Aufzeichnung von Geschäftsvo r fällen dargestellt. Nach dem Einrichten eines Bestandkontos für jede Position der Bilanz, können nun laufende Geschäftsvo r fälle eingetragen werden. Zum Ende des Geschäftsjahres wird der Schlussbestand des Bestandkontos ermittelt. Jeder Schlussbestand eines Bestandkontos wird dann über das Schlussbestandkonto abgeschlossen.
4.2.2 Erklären Sie, wie das Saldo sowie der Schlussbestand in einem Bestandskonto berechnet wird
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.3 BUCHEN AUF BESTANSKONTEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.3.1 Unterscheiden Sie die Buchung von Bestandskonten auf Aktiva - und Passivaseite. Skizzieren Sie zusätzlich Ihre Erläuterung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.3.2 Ihnen liegen einige Geschäftsfälle vor, bilden Sie hierzu die Buchungssätze.
- Barhebung vom Bankkonto in Höhe von 1.000 EUR.
- Banküberweisung an unseren Lieferanten, 10.000 EUR.
- Tilgung einer Darlehensschuld durch Banküberweisung, 850 EUR.
- Kunde bezahlt eine Rechnung von 120 EUR durch Banküberweisung.
- Kauf einer Lagerhalle für 50.000 EUR gegen Banküberweisung.
- Barkauf eines Computers für private Zwecke, 500 EUR.
- Wir begleichen eine Verbindlichkeit in Höhe von 9.000 EUR durch eine Überweisung von 6.500 EUR und durch eine Bartilgung von 3.500 EUR.
- Verkauf eines gebrauchten Computers durch Barzahlung in Höhe von 400 EUR.
- Wir kaufen Rohstoffe für 2.900 EUR auf Ziel ein.
- Wir kaufen einen Reisebus auf Ziel ein, 75.000 EUR.
- Wir verkaufen einen gebrauchten Reisebus gegen einen Bankscheck, 19.000 EUR.
- Kauf eines Büroregals für 500 EUR, bar.
- Kauf von Betriebsstoffen (21.000 EUR) gegen Überweisung (4.900 EUR); Barzahlung (3.100 EUR) und auf Ziel (13.000 EUR).
- Aufnahme es Bankdarlehens in Höhe von 2.000 EUR.
- Eine Reisegruppe begleicht ihre Schulden (7.500 EUR) durch Barzahlung (2.500 EUR) und durch einen Bankscheck (5.000 EUR).
- Ein Kunde überweist den restlichen Rechnungsbetrag in Höhe von 260 EUR.
4.3.3 Ihnen liegen einige Buchungssätze vor. Wie könnten die einzelnen Geschäftsvorfälle aussehen?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.3.4 Buchen Sie die vier Beispiele richtig ein.
A) Ein Kunde begleicht eine Rechnung von 2.400 EUR per Banküberweisung. Anfangsbestände: Bank 5.000 EUR | Forderungen 10.000 EUR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
B) Zielkauf eines Reisebusses für 100.000 EUR. Anfangsbestände: Fuhrpark 250.000 EUR | Verbindlichkeiten 20.000 EUR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
C) Umwandlung einer Verbindlichkeit in ein Darlehen, 5.000 EUR. Anfangsbestände: Darlehen 20.000 EUR | Verbindlichkeiten 15.000 EUR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
D) Eine Lieferrechnung wird über das Girokonto beglichen, 4.000 EUR. Verbindlichkeit (AB: 9.000 EUR) | Bank (AB: 20.000 EUR)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.4 BUCHEN VON GESCHÄFTSFÄLLEN
4.4.1 Wie lautet die Regel eines Buchungssatzes?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.4.2 Wozu dient ein Buchungssatz?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.4.3 Unterscheiden Sie das Buchen bei Kauf und Verkauf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.5 VON DER ERÖFFNUNGSBILANZ ZUR SCHLUSSBILANZ
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.5.1 Unterscheiden Sie das Eröffnungsbilanzkonto vom Schlussbilanzkonto.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.6 ÜBUNGSAUFGABEN 8
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.7 ÜBUNGSAUFGABEN 9
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.8 ÜBUNGSAUFGABEN 10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.9 ÜBUNGSAUFGABEN 11
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.10 ÜBUNGSAUFGABEN 12
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.11 ÜBUNGSAUFGABEN 13
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.12 ÜBUNGSAUFGABEN 14
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.13 ÜBUNGSAUFGABEN 15
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.14 ÜBUNGSAUFGABEN 16
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5. ERFOLGSKONTEN UND GUV
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1 GRUNDLAGEN DER ERFOLGSKONTEN
5.1.1 Definieren Sie den Begriff Erfolgskonten anhand eines Beispiels.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1.2 Unterscheiden Sie Aufwendungen und Erträge, nennen Sie jeweils drei Beispiele.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.1.3 Stellen Sie die unterschiedlichen Abläufe von Bestands – und Erfolgskonten dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2 BUCHEN VON ERFOLGSKONTEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2.1 Unterscheiden Sie die Buchung von Eigenkapital in T – Konten. Skizzieren Sie zusätzlich Ihre Erklärung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2.2 Erklären Sie die Auswahl der Konten für folgenden Buchungssatz
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2.3 Nennen Sie fünf Beispiele für Erträge.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2.4 Nennen Sie vier Kontennamen für Aufwendungen und geben Sie jeweils zwei Beispiele an
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.2.5 Es liegen Ihnen einige Geschäftsfälle vor, bilden Sie die nötigen Buchungssätze.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
5.4 ABSCHLUSS DER ERFOLGSKONTEN ÜBER DAS GuV - KONTO
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6. DIE UMSATZSTEUER
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.1 MEHRWERTSTEUER IN DEUTSCHLAND
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.2 VORSTEUER & UMSATZSTEUER
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.3 VORSTEUERÜBERHANG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6.4 ZAHLLAST
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7. PRIVATENTNAHMEN | PRIVATEINLAGEN
7.1 DAS PRIVATKONTO
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7.2 UMSATZSTEUER BEI PRIVATENTNAHMEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7.3 NUTZUNG EINES GESCHÄFTSWAGENS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8. GESCHÄFTSFÄLLE IM WARENVERKEHR
8.1 WARENKONTEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.2 BUCHEN VON PREISNACHLÄSSEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.3 BUCHEN VON RÜCKSENDUNGEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.4 BUCHUNG BEIM WARENVERKAUF
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9. SACHANLAGENBEREICH
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9.1 GRUNDZÜGE DER ABSCHREIBUNG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9.2 LINEARE ABSCHREIBUNG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9.3 DEGRESSIVE ABSCHREIBUNG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9.4 LEISTUNGSBEZOGENE ABSCHREIBUNG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9.5 AFA - METHODENWECHSEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
9.6 AUSSERPLANMÄSSIGE ABSCHREIBUNG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10. GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER
10.1 GRUNDLAGEN DER GWG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.2 BUCHEN UND ABSCHREIBUNG VON GWG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11. LÖSUNGEN
11.1 LÖSUNGEN ZUM ERSTEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.2 LÖSUNGEN ZUM ZWEITEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.3 LÖSUNGEN ZUM DRITTEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.4 LÖSUNGEN ZUM VIERTEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.5 LÖSUNGEN ZUM FÜNFTEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.6 LÖSUNGEN ZUM SECHSTEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.7 LÖSUNGEN ZUM SIEBTEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.8 LÖSUNGEN ZUM ACHTEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.9 LÖSUNGEN ZUM NEUNTEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.10 LÖSUNGEN ZUM ZEHNTEN KAPITEL
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12. KONTENLISTE
12.1 BESTANDSKONTEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12.2 ERFOLGSKONTEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
13. NOTIZEN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ANFANGSBESTÄNDE EUR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1) Kauf einer neuen EDV - Anlage und eines neuen Druckers gegen Bankchecks 4.376,00
2) Wir nehmen eine Darlehensschild auf und schreiben den Betrag auf dem Bankkonto gut 36.029,00
3) Warenverkauf auf Rechnung
4) Wir kaufen ein Firmenfahrzeug ein
5) Barkauf von Waren
6) Zielverkauf einer alten Ladeneinrichtung
7) Wir heben Bargeld ab
8) Baranzahlung einer Märchenreise durch einen Kunden
9) Rechnungskauf eines neuen Faxgerätes mit Telefunktion
10) Ein Kunde begleicht eine Rechnung durch Banküberweisung: 3.112,00
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein Arbeitsbuch für Auszubildende im Tourismusbereich, das das Fach Rechnungswesen behandelt. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, ein Vorwort, Kapitel zu Grundlagen des Rechnungswesens, Inventur, Inventar, Bilanz, Bestandskonten, Erfolgskonten, Umsatzsteuer, Privatentnahmen und Privateinlagen, Warenverkehr, Sachanlagenbereich, geringwertige Wirtschaftsgüter und Lösungen zu Übungsaufgaben. Außerdem sind eine Kontenliste und ein Abschnitt für Notizen enthalten.
Welche Themen werden im Kapitel "Grundlagen des Rechnungswesens" behandelt?
Das Kapitel behandelt Aufgaben und Begriffe der Buchhaltung sowie Grundzüge ordnungsgemäßer Buchhaltung (GoB).
Was wird im Kapitel "Inventur | Inventar" erklärt?
Dieses Kapitel erläutert die Inventur und das Inventar, einschließlich der Inventurverfahren und der Erstellung eines Inventars.
Was sind die Grundlagen der Bilanz, die in diesem Dokument behandelt werden?
Das Dokument behandelt die Definition der Bilanz, den Grundsatz der Bilanzgleichung, die Bedeutung der Bilanzsumme sowie die Unterscheidung zwischen Aktiva und Passiva.
Was sind Bestandskonten und wie werden sie in diesem Arbeitsbuch behandelt?
Bestandskonten werden als Konten definiert, die für jeden Bilanzposten eingerichtet werden, um einen detaillierten Überblick über die Art, Ursache und Höhe der Bilanzposten zu erhalten. Das Arbeitsbuch erklärt, wie Bestandskonten eröffnet, bebucht und abgeschlossen werden.
Was wird unter Erfolgskonten verstanden und welche Beispiele werden genannt?
Erfolgskonten werden definiert als Konten, die Aufwendungen und Erträge erfassen. Beispiele für Aufwendungen sind Mietaufwendungen, Lohnaufwendungen und Materialaufwendungen. Beispiele für Erträge sind Umsatzerlöse, Zinserträge und Mieterträge.
Was ist die Umsatzsteuer und wie wird sie behandelt?
Das Dokument behandelt die Mehrwertsteuer in Deutschland sowie die Begriffe Vorsteuer und Umsatzsteuer. Es werden auch Vorsteuerüberhänge und Zahllasten erklärt.
Was sind Privatentnahmen und Privateinlagen und wie werden sie gebucht?
Das Dokument erklärt das Privatkonto und die Buchung von Privatentnahmen und Privateinlagen, einschließlich der Umsatzsteuer bei Privatentnahmen und der Nutzung eines Geschäftswagens.
Welche Themen werden im Kapitel "Geschäftsfälle im Warenverkehr" behandelt?
Das Kapitel behandelt Warenkonten, die Buchung von Preisnachlässen, die Buchung von Rücksendungen und die Buchung beim Warenverkauf.
Was wird unter dem "Sachanlagenbereich" verstanden und wie werden Abschreibungen behandelt?
Das Kapitel behandelt die Grundzüge der Abschreibung, einschließlich linearer, degressiver und leistungsbezogener Abschreibung. Es werden auch Methodenwechsel und außerplanmäßige Abschreibungen erklärt.
Was sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und wie werden sie behandelt?
Das Kapitel erklärt die Grundlagen der GWG und die Buchung und Abschreibung von GWG.
Was beinhaltet die Kontenliste?
Die Kontenliste enthält eine Übersicht über die Bestandskonten und Erfolgskonten.
- Arbeit zitieren
- Alina Hönning (Autor:in), 2020, Klausurtraining Rechnungswesen. Für kaufmännische Ausbildungsberufe im Tourismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/965156