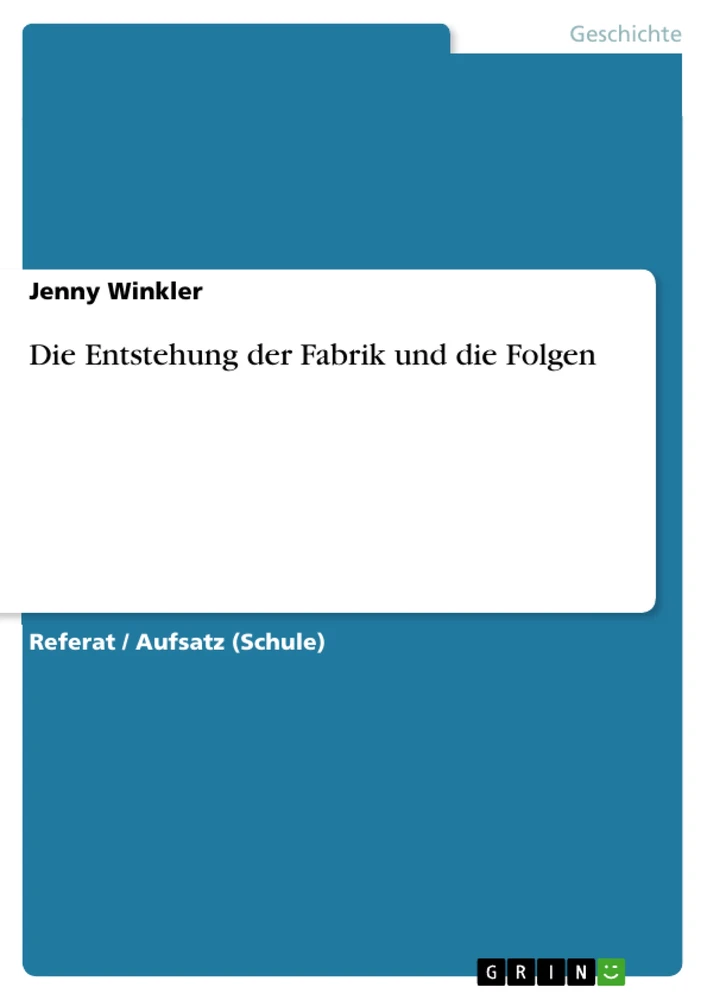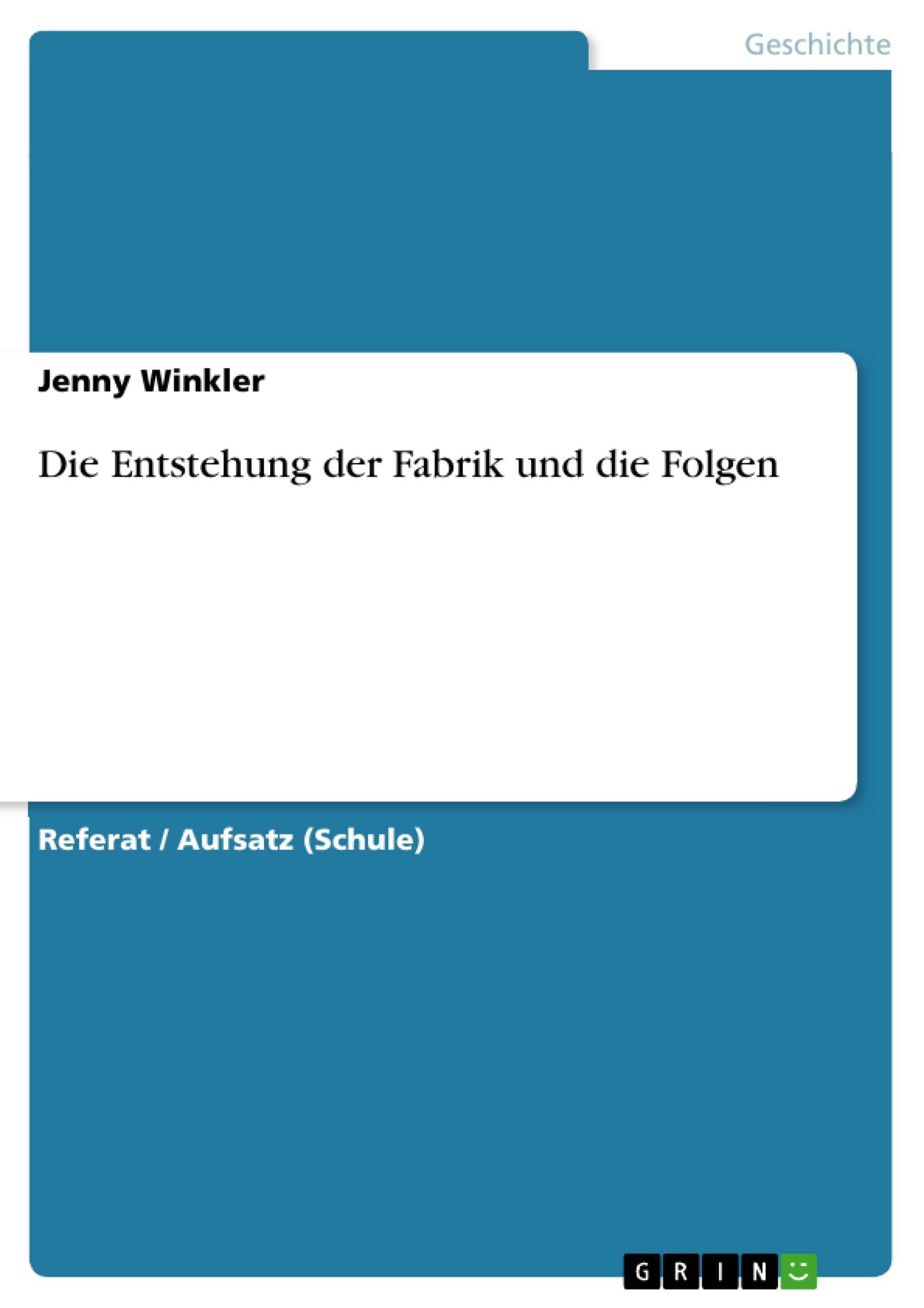Definition: kommt von lat.“FABRICA“=Werkstatt. Vor der industriellen Revolution anderes Wort für MANUFAKTUR oder VERLAG. Nach der Industrialisierung Bezeichnung für den zunftfreien zentralisierten Gewerbebetrieb auf maschineller Grundlage
Manufaktur: zentralisierte Produktionsstätte, in der Waren arbeitsteilig und in größerer Menge hergestellt, aber ohne Einsatz von Maschinen hergestellt werden.
Verlag: zunftfreier, großer, aber dezentralisierter Gewerbebetrieb (vor allem im Textilbereich), der von Verleger-Kaufleuten geleitet wurde und in dem Heimarbeiter die unmittelbare Produktion erledigten.
Definition:
kommt von lat.“FABRICA“=Werkstatt
- vor der industriellen Revolution anderes Wort für MANUFAKTUR oder VERLAG
- nach der Industrialisierung Bezeichnung für den zunftfreien zentralisierten Gewerbebetrieb auf maschineller Grundlage
Manufaktur: zentralisierte Produktionsstätte,in der Waren arbeitsteilig und in größerer Menge hergestellt,aber ohne Einsatz von Maschinen hergestellt werden
Verlag: zunftfreier,großer,aber deuzentralisierter Gewerbebetrieb(vorallem im Textilbereich),der von Verleger- Kaufleuten geleitet wurde und in dem Heimarbeiter die unmittelbare Produktion erledigten
Aufbau der frühen Fabrik:
Die aneinandergereihten Arbeitsmaschinen werden von einer einzigen Antriebsmaschine(Dampfmaschine oder mit Wasserkraft betriebene Turbine) angetrieben.Die Kraft wird dabei mit Hilfe von ungeschützten Treibriemen und Zahnrädern übertragen.
Die Gebäude sind anfangs meist mehrstöckig (ein Arbeitsgang pro Etage,Antriebsmaschine im Untergeschoss), viele Fabriken sind jedoch auch in großen Hallen untergebracht.
Beispiel:Textilfabrik:
Untergeschoss:Antriebsmaschine Erdgeschoss: Krempeln
1.Stock: Spinnen
2.Stock: Weben
Lage der Fabriken:
- in alten großen Gebäuden(Klöster,Burgen)
- in Neubauten(ab ca. 1850 auch Stahlhallen
- nahe bei Rohstoffen(z.B.Ruhrgebiet)
- in Anknüpfung an vorindustrielles Gewerbe(z.B. Augsburger Textilindustrie) →1. Große bayrische Fabrik: Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg (1837)
- meist in Städten
- bei ehemaligen landwirtschaftlichen Regionen führt die Industrialisierung zur planlosen Ballung von Fabriken,Wohnvierteln,öffentlichen Einrichtungen und Kohlegruben ( → Ruhrgebiet)
Grundlagen für Entstehung und Betrieb der Fabriken:
- Aufhebung der Zünfte (in Preußen 1810/11,in Bayern erst nach 1850) → Fabrikgründung wird erleichtert
- Bergwerke → Kohle,Koks als Heizmaterial
- Hüttenwerke → Eisen,Stahl zur Weiterverarbeitung
- Verbesserung der Infrastruktur (staatliche Reform) → Transport von Rohstoffen und Endprodukten
Ziel der Fabrik: rationale Herstellung von Massengütern
Problem: Maschineneinsatz bringt hohen Kostenaufwand mit sich → Maschine muss rund um die Uhr laufen
→ vielfältig spezialisierte Gesamtherstellung erforderlich
Folgen :
- Urbanisierung
→ Wanderung vom Land in die Stadt zu den Fabriken und Arbeitsplätzen → enormes Wachstum der Bevölkerung in den Städten
→ Wohnungsnot,vorallem in der Unterschicht
- überfüllte Wohnungen in den Arbeitervierteln(Berlin 1900 :30000 übervölkerte Wohnungen) Def.: Wohnung ist übervölkert,wenn mehr als 5 Personen in einem Zimmer oder mehr als 10 Personen in zwei Zimmern leben
- Entstehung von Elendsvierteln → lange Arbeitswege
- Ständegesellschaft wird zur Klassengesellschaft
Klassen in der Fabrik:
1.Unterschicht: Arbeiter
- „Erziehung zur Maschine“:
- Maschine bestimmt Tempo und Rhythmus der Arbeit
- keinerlei Selbstbestimmung in Bezug auf Arbeitszeit und Pausen
- strenge Fabrikordnungen (bei kleinsten Übertretungen droht die Entlassung
⇒ Der Fabrikarbeiter kann im Gegensatz zu früher über seinen Tagesablauf nicht mehr selbst bestimmen
- Bezahlung:
- sehr niedrige Löhne → Frauen- und Kinderarbeit wird notwendig,um das Überleben zu sichern
- Akkordbezahlung → konzentrierte Arbeit → wenig Kontakt zu Mitarbeitern
- Arbeitsbedingungen:
- Lärm,schlechte Luft
- 7-Tage-Woche,14-Stunden-Tag
- große Unfallfgefahr wegen ungesachützter Maschinen ·keine Sozialversicherung
- kein sicherer Arbeitsplatz
- Stellung in der Gesellschaft:
- werden von höheren Klassen gemieden
- kein politisches Mitspracherecht
- aus finanziellen Gründen keine Ausbildung möglich
⇒ Alkoholismus
⇒ Anstieg von Kriminalität und Prostitution
⇒ Kampf gegen die Verelendung: Arbeitervereine und Gewerkschaften
⇒ Staat und Kirche werden auf die Missstände aufmerksam
Langsam verbessert sich die Lage der Arbeiter
Beispiele für Gesetze zum Schutz der Arbeiter:
1840 Arbeitsverbot für Kinder unter 9 Jahren
1867 Arbeitszeitbeschränkung auf 12 Stunden pro Tag
2.Mittelschicht:Angestellte
- in der Verwaltung beschäftigt
- besser ausgebildet und bezahlt,meist sicherer Arbeitsplatz,günstigere Arbeitszeiten,Anspruch auf Urlaub
- grenzen sich auch in der Gesellschaft von den Arbeitern ab
3.Oberschicht:Fabrikherren,Industrielle
- meist aus dem Bürgertum
zur Fabrikgründung nötige Vorraussetzungen:
- gleichzeitig Techniker und Kaufmann
- Spürsinn für die Vorlieben der Käufer n Organisationstalent
- Kapital
- erst nach 1850 beteiligen sich Großbanken an Fabriken
- Aktien werden verkauft
Beispiel für einen Unternehmer:Joseph von Maffei(1790-1870)
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Fabrik laut diesem Text?
Der Begriff "Fabrik" kommt von lateinisch "FABRICA" = Werkstatt. Vor der industriellen Revolution war es ein anderes Wort für Manufaktur oder Verlag. Nach der Industrialisierung bezeichnet es den zunftfreien, zentralisierten Gewerbebetrieb auf maschineller Grundlage.
Wie unterschied sich eine Fabrik von einer Manufaktur und einem Verlag vor der Industrialisierung?
Eine Manufaktur war eine zentralisierte Produktionsstätte, in der Waren arbeitsteilig und in größerer Menge hergestellt wurden, aber ohne den Einsatz von Maschinen. Ein Verlag war ein zunftfreier, großer, aber dezentralisierter Gewerbebetrieb (vor allem im Textilbereich), der von Verleger-Kaufleuten geleitet wurde und in dem Heimarbeiter die unmittelbare Produktion erledigten.
Wie war eine frühe Fabrik aufgebaut?
Die Arbeitsmaschinen waren aneinandergereiht und wurden von einer einzigen Antriebsmaschine (Dampfmaschine oder Wasserturbine) angetrieben. Die Kraft wurde mit ungeschützten Treibriemen und Zahnrädern übertragen. Gebäude waren meist mehrstöckig oder in großen Hallen untergebracht.
Wo befanden sich Fabriken typischerweise?
In alten großen Gebäuden (Klöster, Burgen), in Neubauten (ab ca. 1850 auch Stahlhallen), nahe bei Rohstoffen (z.B. Ruhrgebiet), in Anknüpfung an vorindustrielles Gewerbe (z.B. Augsburger Textilindustrie), meist in Städten, und in ehemaligen landwirtschaftlichen Regionen.
Welche Grundlagen waren für die Entstehung und den Betrieb von Fabriken notwendig?
Die Aufhebung der Zünfte, Bergwerke für Kohle und Koks, Hüttenwerke für Eisen und Stahl, und die Verbesserung der Infrastruktur (staatliche Reform) für den Transport von Rohstoffen und Endprodukten.
Was war das Ziel einer Fabrik?
Die rationale Herstellung von Massengütern.
Welche Folgen hatte die Entstehung von Fabriken?
Urbanisierung (Wanderung vom Land in die Stadt), Wohnungsnot, Entstehung von Elendsvierteln, und der Übergang von der Ständegesellschaft zur Klassengesellschaft.
Welche Klassen gab es in der Fabrik und wie waren ihre Arbeitsbedingungen?
Unterschicht (Arbeiter): Niedrige Löhne, Frauen- und Kinderarbeit, Akkordbezahlung, Lärm, schlechte Luft, lange Arbeitszeiten, große Unfallgefahr, keine Sozialversicherung, kein sicherer Arbeitsplatz, geringe gesellschaftliche Anerkennung. Mittelschicht (Angestellte): Besser ausgebildet und bezahlt, sicherer Arbeitsplatz, günstigere Arbeitszeiten. Oberschicht (Fabrikherren, Industrielle): Unternehmer mit Kapital, Organisationstalent und Spürsinn für Käufervorlieben.
Wie veränderte sich die Lage der Arbeiter im Laufe der Zeit?
Langsam verbesserten sich die Arbeitsbedingungen durch Arbeitervereine, Gewerkschaften, staatliche Gesetze und das Eingreifen der Kirche. Beispiele für Gesetze sind das Arbeitsverbot für Kinder unter 9 Jahren (1840) und die Arbeitszeitbeschränkung auf 12 Stunden pro Tag (1867).
Welche Vorraussetzungen brauchte man um Fabrikherr zu werden?
Man musste gleichzeitig Techniker und Kaufmann sein, Spürsinn für die Vorlieben der Käufer haben, Organisationstalent und Kapital.
- Quote paper
- Jenny Winkler (Author), 1999, Die Entstehung der Fabrik und die Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96499