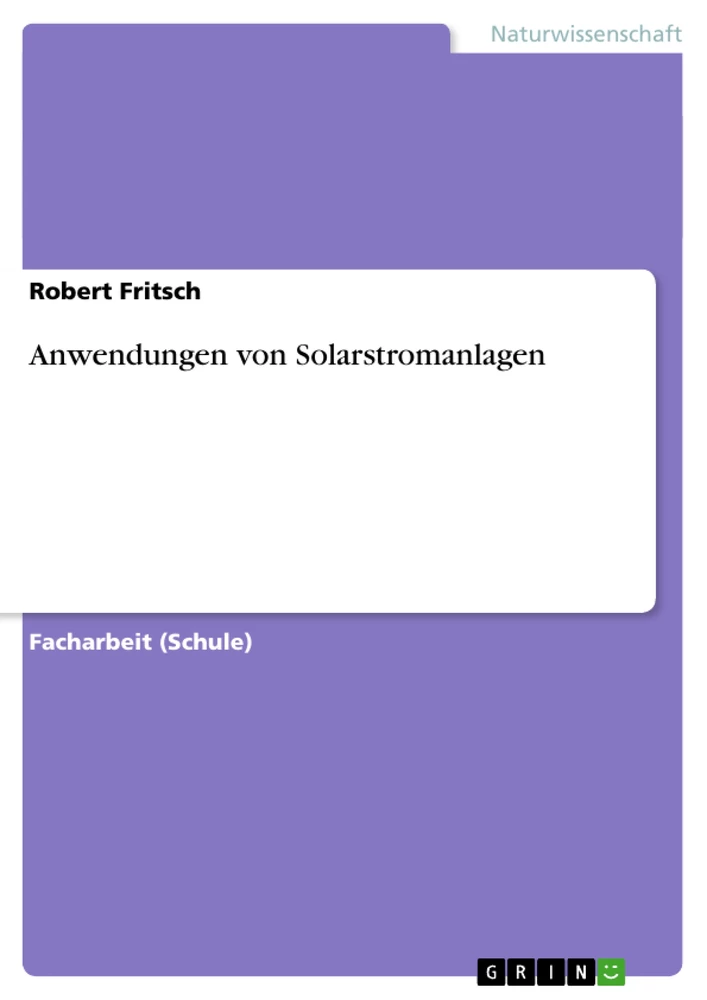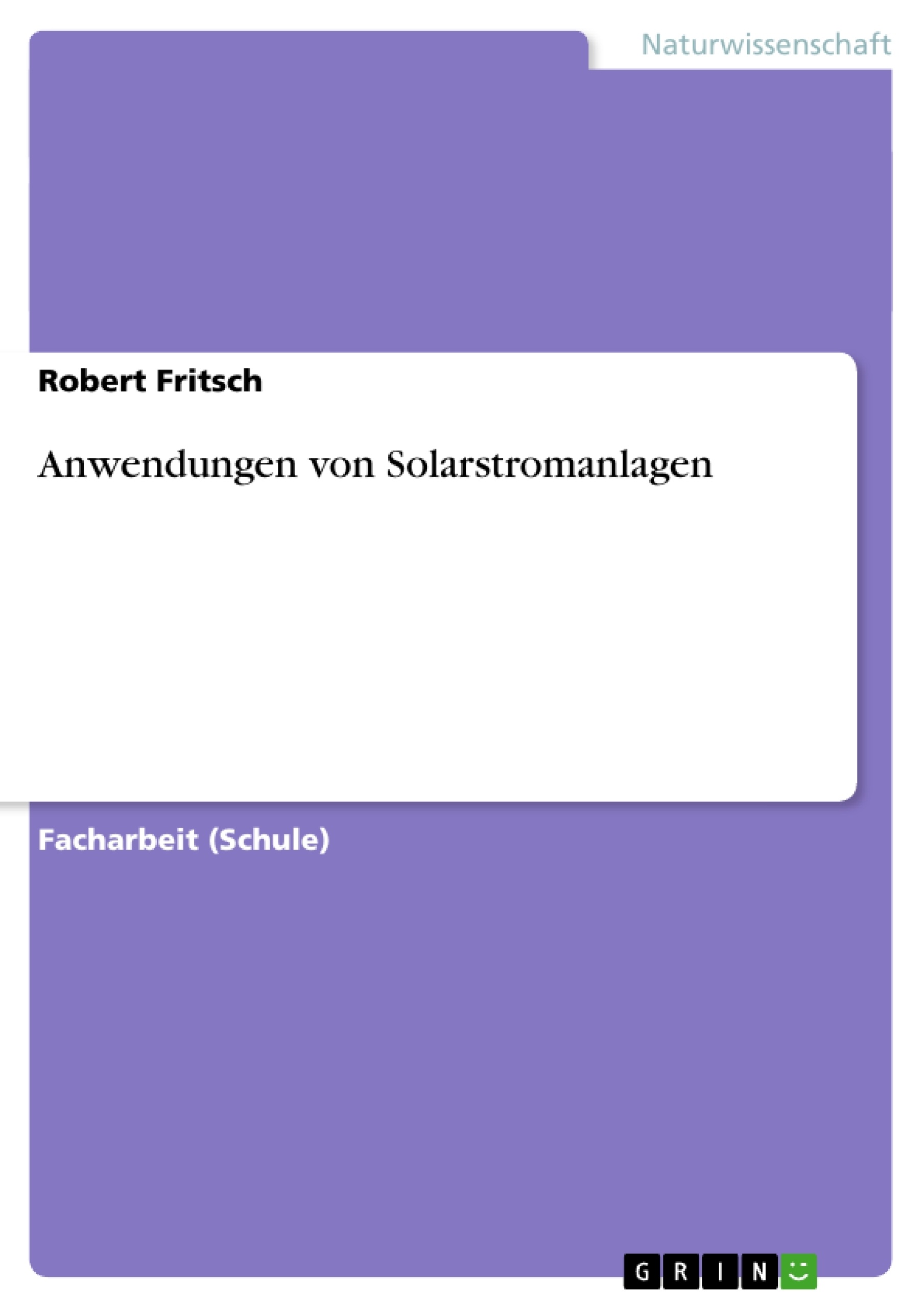Inhaltsverzeichnis
1 Funktionsweise und Arten von Solarzellen
2 Anwendungen von Solarstromanlagen
2.1 netzunabhängige Solarstromanlagen
2.1.1autonome Anlagen
2.1.1.1 mobile Anlagen
2.1.1.2 stationäre Anlagen
2.1.2 Hybridanlagen
2.1.2.1 Solarstromanlage-Dieselgenerator
2.1.2.2 Solarstromanlage-Windgenerator
2.1.2.3 Solarstromanlage-Sonnenkollektor
2.2 netzgekoppelte Solarstromanlagen
2.2.1 häusliche Photovoltaikanlagen
2.2.2 Kraftwerke
2.2.2.1 Photovoltaikkraftwerke
2.2.2.2 thermische Solarkraftwerke
2.2.2.2.1 Farmkraftwerk
2.2.2.2.2 Turmkraftwerk
2.2.2.2.3 Aufwindkraftwerk
3 Wirtschaftlichkeit und Zukunftsvisionen
Anhang
Quellennachweis
Literaturverzeichnis
Erklärung
1 Funktionsweise und Arten von Solarzellen
Obwohl viele die Solarenergie als Energie der Zukunft bezeichnen, ist im März 1996 die letzte Serienproduktion von Solarzellen eingestellt worden.1 Die Gründe hierfür liegen wohl an dem mangelndem Interesse und Wissen für diese Art von Stromerzeugung. Viele wissen überhaupt nicht, für welch vielfältige Einsatzbereiche Solarzellen zu nutzen sind. Aber bevor man sich mit den Anwendungen von Solarzellen beschäftigt, sollte man sich erst einmal mit der grundsätzlichen Funktion und den Arten von Solarzellen vertraut machen.
Solarzellen sind aktive Halbleiterelemente, die Sonnenenergie (die Strahlung) direkt in elektrische Energie umwandeln. Man nennt diese auch photovoltaische oder photoelektrische Zellen. Die Funktionsweise einer Solarzelle ist relativ einfach. Das Sonnenlicht besteht aus Photonen. Die Solarzelle dient dazu diese einzufangen. Wird nun ein Siliziumatom von einem Photon getroffen, so reißt dies Elektronen aus ihrer Bahn. Dadurch wird in der Photovoltaikzelle elektrische Spannung hervorgerufen. Eine Solarzelle mit 10 cm Durchmesser liefert bei einer Einstrahlung von 1000W/m² einen Strom von ca. 2 Ampere bei einer Spannung von 0,5 Volt.2 Da diese Spannung, beziehungsweise dieser Strom meist nicht ausreicht, werden mehrere Solarzellen zu größeren Einheiten, sogenannten Modulen, zusammengefaßt. Mehrere Module ergeben wiederum ein Paneel. Dabei werden die Zellen, je nach dem ob man höhere Ströme beziehungsweise höhere Spannungen haben möchte, parallel beziehungsweise in Reihe geschaltet.
Heute gibt es drei Arten von Solarzellen, die für eine Serienproduktion reif sind.
Die erste ist die mono-kristalline Siliziumzelle, die aus einen Silizium-Einkristall gesägt wird. Der Wirkungsgrad liegt in der Serienproduktion bei 13 %, im Labor bei 18%.
Die Multi-c-Siliziumzelle, deren Wirkungsgrad in der Serienproduktion bei 12%, in der Laborfertigung bei 16% liegt, wird aus einem Silizium-Gußblock gesägt.3
Die Hauptprobleme dieser beiden Solarzellenarten sind die hohen Fertigungskosten. Der Basispreis für kristallines Silizium ist bei einer derzeit zu geringen Stückzahl zu teuer. Bei einer Verdoppelung der Produktion würde der Preis aber jeweils um 15 Prozent sinken.
Die dritte Solarzellenart ist die amorphe Siliziumzelle. Hierbei wird eine Schicht aus amorphem Silizium auf einen Träger, meist Glas, aufgetragen. Das Hauptproblem bei dieser Art von Solarzellen ist der sinkende Wirkungsgrad durch einen chemischen Abbauprozeß. In der Serienproduktion liegt der Wirkungsgrad bei fabrikneuen Zellen bei 10%,aber schon nach einem Jahr ist dieser auf nur noch 6-7% zurückgegangen.4
Für was man nun aber Solarzellen nutzen kann, wird im folgenden beschrieben.
2 Anwendungen von Solarstromanlagen
2.1 netzunabhängige Solarstromanlagen
2.1.1 autonome Anlagen
Als erstes betrachten wir autonome Anlagen. Diese Anlagen, die ausschließlich durch Solarstrom versorgt werden, nennt man auch Inselanlagen. Autonome Anlagen bringen für den Verbraucher heute die meisten Vorteile, da sie relativ billigen, netzunabhängigen Strom liefern. Hierbei unterscheiden wir zwischen zwei verschiedene Arten, den mobilen Anlagen und den stationären Anlagen. (Siehe Anhang 2)
2.1.1.1 mobile Anlagen
Mobile autonome Solarstromanlagen sind Anlagen, die netzunabhängig an verschiedenen Orten benützt werden können. Einzige Voraussetzung ist natürlich eine Sonneneinstrahlung.
Anlagen im Milliwattbereich findet man heute in vielen Gebrauchsgegenständen.
In den meisten der heute käuflichen Taschenrechnern sind Solarzellen eingebaut. In diesen ist es besonders sinnvoll und praktisch, da der Taschenrechner nur bei Licht benutzt wird, das heißt er ist immer funktionsfähig wenn er gebraucht wird. Diese kleinen Solaranlagen kann man auch in Uhren finden. Hier ist allerdings ein zusätzlicher Kondensator notwendig, der überschüssige Energie speichert und um mit dieser die Uhr bei Dunkelheit zu versorgen. Ein großer Vorteil, bei beiden Geräten, ist das Entfallen des lästigen Batteriewechselns. Dies kommt der Umwelt zu gute, und außerdem ist für den Benutzer sehr praktisch und billig. Eine Kilowattstunde Photovoltaikinselanlage kostet zirka 5 DM. Eine Kilowattstunde mit einer Batterie für Taschenrechner bzw. Uhren hingegen kostet zirka 9000 DM bzw. 36000 DM.5
Deshalb sollte man bei kleinen Verbrauchern, die mobil sein müssen, wo immer es möglich ist, eine kleine Solaranlage, der Batterieversorgung vorziehen. Bei Bedarf kann man diese auch mit Kondensatoren oder bei größeren Geräten, wie Radio oder Kassettenrecorder, mit Akkumulatoren ausstatten.
Durch solche Anlagen können aber auch verschiedene elektronische Geräte in Campingfahrzeugen, Booten und Segelflugzeugen versorgt werden.
Diese Geräte und Systeme verwenden einen Akku als Stromspeicher, damit sie unabhängig von der Sonneneinstrahlung betrieben werden können.
Aber nicht nur kleine Verbraucher, sonder auch ganze Autos können mit Solaranlagen betrieben werden. Ein Solargenerator lädt im Fahrzeug, das man Solarmobil nennt, mitgeführte Akkumulatoren, die den Strom für einen oder mehrere Elektromotoren liefern.
Allerdings können sich diese Fahrzeuge wegen des hohen Gewichts der Akkumulatoren und der beschränkten Leistung und Reichweite nicht durchsetzen.
Eine weitere wichtige Anwendung für mobile Photovoltaikanlagen sind die Satelliten.
In der Weltraumtechnik werden die Solarzellen seit 1958 (Vanguard I) erfolgreich verwendet.
Hier gelten natürlich ganz andere Kriterien als auf der Erde. Die Kostenfrage kann man hier vernachlässigen, viel wichtiger ist eine leichte autonome Stromquelle, mit einem hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. All diese Kriterien erfüllt eine Solarzelle und ist somit ideal für dieses Einsatzgebiet.
2.1.1.2 stationäre Anlagen
Auch stationäre Verbraucher lassen sich sehr gut mit Solarstromanlagen versorgen. Hierzu gehören zum Beispiel Radio- und Fernsehfüllsender, Wetter- und Umweltmeßstationen, Beleuchtungsanlagen, Not-Telefone, Verkehrssteuerungssysteme und Parkscheinautomaten. Diese benötigen einen leistungsfähigen Stromspeicher für den Einsatz bei Dunkelheit oder geringer Sonneneinstrahlung. Die Anschaffung solcher Anlagen ist aber durch den Wegfall der laufenden Stromkosten und durch die verminderten Wartungskosten meist lohnend. Besonders bei abgelegenen Verbrauchern ist die Anschaffung einer Solaranlage oft billiger als der Anschluß ans Netz oder als eine Batterieversorgung. In Ländern mit weniger dichtem Versorgungsnetz, in Bergregionen und in Entwicklungsländern sind diese Anlagen daher besonders sinnvoll.
In den Entwicklungsländern ist der Einsatz von Solaranlagen besonders bedeutsam. Hier wo die Sonneneinstrahlung sehr stark ist kann man mit Solarstrom lebenswichtiges Wasser fördern. Sogar ein Akkumulator ist hier nicht zwingend notwendig, da bei mangelnder Sonneneinstrahlung auch der Wasserbedarf zurück geht und da man bei genügend Sonneneinstrahlung das Wasser in Wassertürmen speichern kann. Einmal von Fachpersonal installiert, bedarf die Anlage auch fast keiner Wartung mehr. Dies ist in abgelegenen Gebieten, in den Entwicklungsländern, von großem Vorteil.
2.1.2 Hybridanlagen
Als weitere Art von Solarstromanlagen sind die Hybridanlagen zu nennen. Dies sind Anlagen, die neben der Photovoltaikanlage noch eine weitere Anlage zur Energiegewinnung haben. Die drei wichtigsten sind Photovoltaikanlage- Dieselgenerator, Photovoltaikanlage- Windgenerator, Photovoltaikanlage- Sonnenkollektor. (siehe Anhang 3)
1.2.1 Solarstromanlage- Dieselgenerator
Bei Solarstromanlagen hat man häufig das Problem, daß man zu sehr vom Wetter und der Tageszeit abhängig ist. Bei kleineren Verbrauchern kann man hierbei durch Kondensatoren oder Akkumulatoren Abhilfe schaffen. Wenn man aber mehrere oder größere Verbraucher, wie man sie zum Beispiel in Berghütten oder in abgelegenen Häusern hat, kann man durch einen Dieselgenerator die Schwachzeiten ausgleichen.
Ein Beispiel dafür ist ein Krankenhaus in Karatu, einem Ort in Tansania, der 160 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt ist. Hier wird ein neues Energiekonzept, einer Firma aus Deutschland für Entwicklungsländer, der Suntainer erprobt. Dies ist ein Container, in dem ein Dieselgenerator und Akkumulatoren installiert sind und dessen Dach aus Solarzellen besteht. Dieser versorgt ein Krankenhaus mit Strom, das für 200 000 Menschen zuständig ist.
Zuvor wurde das Hospital nur mit einem Diesel-generator versorgt, der meist nur ein Jahr funktionierte und sehr hohe Unterhaltungskosten hatte.
Während Solarzellen in den Industrieländern, wo fast überall ein Anschluß ans Stromnetz möglich ist, meist nicht wirtschaftlich sind, rechnet es sich in Karatu bei Produktionskosten von 6 DM pro Kilowattstunde durchaus.6
Aber auch in Deutschland kann sich so ein System durchaus lohnen. Das kleines Feriendorf Flanitzhütte im bayerischen Wald wird zum Beispiel ausschließlich mit Solarstrom und, anstatt eines Dieselgenerators, mit einem Flüssiggas-generator versorgt. Außerdem gibt auch noch ein Akkumulator-System, das bis zu drei Schlechtwettertage überbrücken kann. Das ganze System ist billiger als ein Netzanschluß dieses abgelegenen Dorfes.7
2.1.1.2 Solarstromanlage-Windgenerator
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2
Da die Sonneneinstrahlung das ganze Jahr über nicht gleich ist, bietet es sich an, ein System zu benützen, das die Schwankungen ausgleicht. Das hierbei beste System sind Windgeneratoren. Zu Zeiten bei denen die Sonneneinstrahlung am geringsten ist, ist das Windaufkommen am größten. Umgekehrt gilt das gleiche (Siehe Diagramm). Dadurch ergänzen sich Sonnenenergie und Windkraft hervorragend.
Diese Kombination wird zum Beispiel auf der koreanischen Insel Cheju genutzt. Der Strom der Solarzellen wird dabei zuerst in einer Batterie zwischengespeichert und dann mit einem Wechselrichter in einen Einphasen-Wechselstrom umgeformt und den Verbrauchern zugeführt. Der Windgenerator versorgt die Verbraucher direkt. Überschüsse werden in Gleichstrom umgewandelt und in die Batterie eingespeist. Dadurch kann die Insel, die an keinem Stromnetz hängt, das ganze Jahr über gleichmäßig mit Energie versorgt werden.
In Korea ist geplant, 400 kleine Inseln mit dieser Technik zu versorgen.
Genauso kann man das ganze auch in einem Ferienhaus oder auf einer Berghütte durchführen. Ein Windgenerator ist in der Anschaffung sogar billiger als ein Solarmodul.
2.1.1.3 Solarstromanlage-Sonnenkollektor
Eine weitere Möglichkeit der Verwendung von Solarzellen ist die gleichzeitige Gewinnung von thermischer und elektrischer Energie. Durch kombinieren von Solarzellen und einem Sonnenkollektor wird ein Hybrid-Kollektor gebildet. Ein Sonnenkollektor nutzt direkt die Wärme der Sonne aus, um damit zum Wasser zu erwärmen.
Bei dieser Kombination wird die Fläche der Solarzellen gleichzeitig als Absorbersschicht des Sonnenkollektors genutzt. Durch die Entnahme von thermischer Energie dient dieses System gleichzeitig der Kühlung der Solarzellen, was wiederum den Wirkungsgrad dieser erhöht.
Dadurch kann man einen Teil verlorengegangenen 87% der Sonnenenergie (Wirkungsgrad einer Solarzelle ca. 13%) in nutzbare Wärme umwandeln. Das Warmwasser kann man für die Warmwasserbereitung oder für die Heizung verwenden. Das Verhältnis von thermischer Energie und elektrischer Energie entspricht ungefähr dem Energiebedarf eines Wohnhauses.
Durch eine Wärmepumpe kann das Wasser auf eine entsprechende Temperatur gebracht werden. Diese kann, genauso wie die Umwälzpumpe des Kollektorsystems, fast vollständig mit dem Strom der Solarzellen versorgt werden.
2.2 netzgekoppelte Solarstromanlagen
2.2.1 häusliche Photovoltaikanlagen
Solarzellen kann man heutzutage auch leicht auf das eigene Hausdach installieren. Da man aber nicht immer wenn die Sonne scheint auch Strom benötigt, stellt sich die Frage nach einer Speichermöglichkeit. Natürlich kann man auch hier wie bei kleineren Anlagen einen Akkumulator verwenden, dieser hat aber entscheidende Nachteile. Aus ökologischer Sicht ist vom Gebrauch von Akkumulatoren abzuraten, da die Lebensdauer kaum mehr als sieben Jahre beträgt, und die Entsorgung dieser Akkumulatoren , die zum Sondermüll zählen, zum Problem wird.
Aus energetischer Sicht haben diese Batterien einen ganz anderen Nachteil. Durch das Zwischenspeichern des Stromes im Akkumulator ergibt sich ein Verlust von 15%.8 Außerdem ist die Anschaffung von Akkumulatoren mit so großer Speicherkapazität auch sehr teuer.
Eine gute Alternative ist es, den überschüssigen Strom einfach dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen zu verkaufen, und den Strom ins Netz einzuspeisen. Der Vergütung je Kilowattstunde dafür muß laut dem „Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz“ mindestens 90% des Durchschnittserlöses des vom EVU an die Endverbraucher abgegebenen Stromes betragen.9 Dadurch kann man den Strom ganz einfach und kostengünstig zwischenlagern. Wenn man selbst mehr Strom braucht kann man ihn wieder „zurückkaufen“. Für dieses System ist allerdings ein Wechselrichter nötig, der den Gleichstrom der Solarzellen in Wechselstrom, wie er im Stromnetz vorkommt, umwandelt.
Dies ist sehr sinnvoll, da man dadurch auch die normalen Wechselstromgeräte im Haushalt benutzen kann. Außerdem ist ein zweiter Stromzähler notwendig, der den abgegebenen Strom ans Netz registriert.
Der Aufwand für die Netzanbindung ist durch den technischen Aufwand relativ groß, so daß sich die Einspeisung nur bei größeren Solarstromanlagen ab 1 Kilowatt Leistung lohnt. Bei größeren Solarstromanlagen lohnt sich der Aufwand allein schon wegen des eingespartem Kohlendioxids, das bei der Stromproduktionsarten anfällt. Von 1990 bis 1993 wurde die Installation von Solarzellen allerdings durch das 1000-Dächer-Programm gefördert.10
Wer selbst keine Möglichkeit hat Solarzellen aufzustellen, kann sich sogar in der Schweiz in kleine netzgespeiste Solaranlagen einmieten oder Anteilscheine von solchen Anlagen kaufen.
(siehe auch Anhang 4 und 5)
2.2.2 Kraftwerke
2.2.2.1 Photovoltaikkraftwerke
Neben den kleinen Solarstromanlagen, die meist nur einige Kilowatt produzieren, gibt es natürlich auch Anlagen im hundert bis tausend Kilowattbereich. Diese Anlagen, die Photovoltaikkraftwerke genannt werden, produzieren aber den Strom meist ausschließlich zur Einspeisung in das öffentliche Netz. Heute können sogar Solarmodule gefertigt werden, die bis zu 70 Megawatt Strom liefern. Allerdings gibt es Photovoltaikkraftwerke mit solch großer Leistung nur in den Vereinigten Staaten. In Europa wurden bis jetzt nur Anlagen mit mehreren hundert Kilowatt Leistung erbaut. Eines solcher Kraftwerke, das zu den größten Europas gehört, steht seit 1991 in der Region Köln. Es hat eine Spitzenleistung von zirka 360Kilowatt und produzierte im Jahre 1992 270 Megawattstunden. Der Wirkungsgrad dieser Anlage ist allerdings nicht allzu gut, da es sich dabei eher um eine Forschungsanlage handelt, bei der auch relativ unwirtschaftliche Solarzellen getestet wurden.
Aufgrund dieser Forschungsergebnisse wurde eine weitere Großanlage in Neurath gebaut. Auch diese hat eine Spitzenleistung von 360 Kilowatt ,allerdings wurden nur ökonomisch sinnvolle Module mit einem Wirkungsgrad von bis zu 12% verwendet. Auch wurden hier erstmals in Europa anstatt der konventionellen 0,5 m² Solarmodule, Großmodule, die mehr als 2 m² groß sind, verwendet. Bei dieser Anlage wurde auch auf eine gute Integration in ökologische Landschaft geachtet. Beide Anlagen wurden im Rahmen des 1MW-Photovoltaikprojekts errichtet.
2.2.2.2 thermische Solarkraftwerke
Eine weitere Möglichkeit, die man nicht vergessen sollte, um die Energie der Sonne zu nutzen, sind thermische Solarkraftwerke. Hierbei wird die Sonnenenergie zuerst in Wärmeenergie umgewandelt und danach erst in elektrische Energie. Auch hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wobei ich hier die drei wichtigsten aufzählen möchte.
2.2.2.2.1 Farmkraftwerk
Bei Farmkraftwerken werden Parabolspiegel so eingestellt, das dessen Brennpunkt auf ein mit durchsichtiges Rohr gerichtet ist. Deshalb werden diese auch Parabolrinnen-Kraftwerke genannt. Dadurch wird Öl erhitzt, daß durch das Rohr fließt. Öl wird wegen seiner guten Wärmeleitfähigkeit und seiner absorbtionsbegünstigenden Farbe genommen.
Das erhitzte Öl fließt durch einen Verdampfer und bringt dadurch Wasser zum verdampfen. Dieses treibt so eine Turbine an. Dieser treibt wiederum einen Generator an, der Strom erzeugt.
Dieser Anlagentyp ist laut der Meinung von Dr. Eisenbein, dem Programmdirektor Energietechnik der DLR in Köln-Pforz, der im Moment am marktnächsten. Dazu sagte er in einem Interview „Die Parabolrinnen-Kraftwerke sind durch das Vorpreschen der Amerikaner mit 350 Megawatt wohl die marktnächsten, die anwendungsreifsten“.11
2.2.2.2.2 Turmkraftwerk
Wohl auch ein chancenreiches Kraftwerk für die Zukunft ist das Turmkraftwerk. Auch hierbei wird Öl erhitzt. Allerdings nach einem anderen Prinzip. Eine Vielzahl von Spiegeln auf die Spitze eines Turmes gerichtet, der durch die Sonnenenergie sehr stark erhitzt wird. Das innere des Turms wird mit verschiedenen Flüssigkeiten durchflossen, die erhitzt werden. Dann arbeitet das System genau so wie mit dem Öl beim Farmkraftwerk weiter.
2.2.2.2.3 Aufwindkraftwerk
Nach einem ganz anderen System funktioniert das von Prof. Dr. Schlaich erfundene Aufwindkraftwerk. Hierbei wird unter großen Glasfläche Luft erwärmt. Diese warme Luft steigt ein Loch in einen zentralen Turm. In diesem wird beim Aufsteigen der warmen Luft eine Turbine mit einem Generator angetrieben. Dieser produziert dann elektrische Energie. Dieses Kraftwerk hat den Vorteil, das es keiner direkten Sonneneinstrahlung bedarf.
Auch die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage ist sehr groß. Laut Prof. Dr. Schlaich würde bei einem 100 Megawatt-Kraftwerk mit 80 Jahren Nutzungsdauer die Kilowattstunde nur 6 Pfennig kosten.12
Das Farm- und das Aufwindkraftwerk sind in ihrer jetzigen Form anwendungsreif . Trotzdem fehlen hier wie bei den beiden andern Kraftwerken die Investoren für den Bau solcher Anlagen.
Dr. Eisenbeiß sagt dazu: “Nur wo es noch Fortschrittsbedarf gibt, passiert etwas.13
3 Wirtschaftlichkeit und Zukunftsvisionen
Zum Abschluß sollte man noch die ökonomischen und ökologischen Aspekte von Solaranlagen betrachten. Um die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage zu berechnen, bietet sich die Methode von Ravel an. Hierbei werden die Investitionkosten der Zinssatz und die Lebensdauer der Anlage mit einberechnet. Hieraus läßt sich ersehen (siehe Anhang 1.2), das derzeit selbst bei günstigen Bedingungen, der Preis für 1Kilowattstunde Solarstrom nicht unter 1 DM sinken kann.
Im Vergleich dazu ist der Preis für Netzstrom mit derzeit ca. 0,25 DM pro Kilowattstunde um einiges billiger.
Dennoch sollte man hier die ökologischen Aspekte nicht vernachlässigen. Aber auch hier darf man nicht nur an den Betrieb der Anlage denken, sondern muß auch den Energieaufwand für die Produktion von Solarzellen mit berechnen. Hierzu dient der kumultierte Energieverbrauch (eine Summe der gesamten für die Herstellung benötigten Energie), die energetische Amortisationszeit (der Zeitraum, bis die Anlage so viel Energie produziert hat, wie zu ihrer Herstellung nötig war), und der Erntefaktor ( das Verhältnis des kumultierten Energieverbrauchs zur gesamtem produzierten Energie). Durch diese Größen (siehe Anhang 1.1 und 1.2), kann man sehen, daß zwar ca. 20 bis 30% der Umweltfreundlichen Energie praktisch verloren gehen, aber der restliche Anteil sollte zum Denken anregen, ob es nicht sinnvoll ist und ob es uns unsere Umwelt nicht wert ist, das finanzielle Opfer von ca. 75 Pfennig pro Kilowattstunde für sie aufzubringen.
Wenn wir alle dieses kleine Opfer in Kauf nehmen und der Staat gleichzeitig die Solaranlagen mit Projekten wie dem von Solarbefürwortern geforderten 100.000-Dächer-Programm fördert, (und nicht beispielsweise die Mittel von 1993 bis 1995 um ca. 30 Millionen kürzt), dann sehe ich für den umweltfreundlichen Solarstrom in Deutschland eine große Zukunft. Denn die Sonnenenergie wird dem Menschen, im Gegensatz zu den fossilen Energien, wohl nie ausgehen.
Anhang 1.1
Kosten des Stroms aus netzgekoppelten PV-Anlagen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anhang 1.2
Energieverbrauch, Erntefaktor und Amorisationszeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungen
Abb. 1) Siemens Solar: Prospekt Photovoltaikprojekte weltweit, o.O. o.J.
Abb. 2) Muntwyler, Urs: Praxis mir Solarzellen, München 1992, S.80
Abb. 3) vgl. Bayernwerk (Hg.):Sonne in der Schule, o.O. 1995 S. 5.7
Abb.4) vgl. Bayernwerk (Hg.), a.a.O., S. 5.8
Abb.5) vgl. Bayernwerk (Hg.), a.a.O., S. 5.9
Abb.6) vgl. Bayernwerk (Hg.), a.a.O., S. 5.10
Tabellen
Tabelle 1) vgl. Ladner, Heinz: Solare Stromversorgung. Grundlagen, Planung, Anwendung, Staufen 1995, S 224
Tabelle 2) vgl. Ladner, Heinz: Solare Stromversorgung. Grundlagen, Planung, Anwendung, Staufen 1995, S 227
Literaturverzeichnis
Bücher
Ladner, Heinz: Solare Stromversorgung. Grundlagen, Planung, Anwendung, Staufen 1995
Muntwyler, Urs: Praxis mir Solarzellen, München 1992
Wahl, Friedrich, Kremers, Werner u.a.: Neue Wege der Energieversorgung,
Braunschweig 1992
Zeitschriften
Bild der Wissenschaft, 3, 1996
Broschüren
Bayernwerke (Hg.):Sonne in der Schule, o.O. 1995
Siemens Solar (Hg.):Prospekt Pilotprojekt Solar-Insel: Photovoltaik-Anlage Flanitzhütte, o.O. o.J.
Bayerisches Staatsministerium für Landesfragen und Umweltentwicklung (Hg.): Die umweltbewußte Gemeinde, München 1996
Erklärung
Ich erkläre, daß ich diese Facharbeit selbständig und nur
mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt habe.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellennachweis
[...]
1 ) vgl. Ewe, Thorwald: Der Exodus, in: Bild der Wissenschaft, 3, 1996, S.83
2 ) vgl. Bayerisches Staatsministerium für Landesfragen und Umweltent- wicklung (Hg.): Die umweltbewußte Gemeinde, München 1996 Bd.1, S.V-43
3 ) vgl. Ewe, a.a.O, S.84
4 ) vgl. Ewe, a.a.O, S.84
5 ) vgl. Bayernwerk (Hg.):Sonne in der Schule, o.O. 1995, S.4.3
6 ) vgl. Korbmann, Reiner: Unter der Sonne von Karatu, in: Bild der Wissenschaft, 3, 1996, S. 90
7 ) vgl. Siemens Solar (Hg.):Prospekt Pilotprojekt Solar-Insel: Photovoltaik- Anlage Flanitzhütte, o.O. o.J.
8 ) vgl. Ladner, Heinz: Solare Stromversorgung. Grundlagen, Planung, Anwendung, Staufen 1995, S 185
9 ) vgl. Ladner, a.a.O., S.186
10 ) vgl. Ladner, a.a.O., S.223
11 ) Eisenbeiß, Gerd, Schlaich, Jörg, u.a.: Welches Solarkraftwerk ist das beste?, in: Bild der Wissenschaft, 3, 1996, S.91
12 ) vgl. Eisenbeiß, Gerd, Schlaich, Jörg, u.a.: Welches Solarkraftwerk ist das beste?, in: Bild der Wissenschaft, 3, 1996, S.91
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen der Facharbeit über Solarstromanlagen?
Die Facharbeit behandelt die Funktionsweise und Arten von Solarzellen, die Anwendungen von Solarstromanlagen (netzunabhängig und netzgekoppelt), sowie die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsvisionen von Solarstrom.
Welche Arten von Solarstromanlagen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen netzunabhängigen (autonomen und Hybridanlagen) und netzgekoppelten Solarstromanlagen (häusliche Photovoltaikanlagen und Kraftwerke).
Was sind autonome Solarstromanlagen?
Autonome Solarstromanlagen (Inselanlagen) sind Anlagen, die ausschließlich durch Solarstrom versorgt werden und keinen Anschluss an ein Stromnetz haben. Sie werden in mobile (z.B. Taschenrechner, Uhren, Solarmobile) und stationäre Anlagen (z.B. Radio- und Fernsehfüllsender, Wetterstationen) unterteilt.
Was sind Hybridanlagen im Bereich der Solarstromversorgung?
Hybridanlagen kombinieren die Photovoltaikanlage mit einer weiteren Anlage zur Energiegewinnung, z.B. Dieselgenerator, Windgenerator oder Sonnenkollektor.
Was sind netzgekoppelte Solarstromanlagen?
Netzgekoppelte Solarstromanlagen speisen überschüssigen Strom in das öffentliche Stromnetz ein und beziehen bei Bedarf Strom aus dem Netz. Beispiele sind häusliche Photovoltaikanlagen und Photovoltaikkraftwerke.
Welche Arten von thermischen Solarkraftwerken werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt Farmkraftwerke (Parabolrinnen-Kraftwerke), Turmkraftwerke und Aufwindkraftwerke.
Welche wirtschaftlichen Aspekte werden bei Solarstromanlagen berücksichtigt?
Die Wirtschaftlichkeit wird anhand von Investitionskosten, Zinssatz und Lebensdauer der Anlage berechnet. Die Arbeit vergleicht die Kosten pro Kilowattstunde Solarstrom mit den Kosten für Netzstrom und berücksichtigt ökologische Aspekte wie Energieaufwand für die Produktion von Solarzellen.
Welche ökologischen Aspekte von Solarstromanlagen werden beleuchtet?
Die Arbeit berücksichtigt den kumulierten Energieverbrauch, die energetische Amortisationszeit und den Erntefaktor bei der Bewertung der Umweltfreundlichkeit von Solarstromanlagen.
Was ist das 1000-Dächer-Programm?
Das 1000-Dächer-Programm war ein Förderprogramm zur Installation von Solarzellen, das von 1990 bis 1993 lief.
Was sind die Vorteile von Solarzellen in Entwicklungsländern?
In Entwicklungsländern kann Solarstrom zur Förderung von Wasser eingesetzt werden, was in abgelegenen Gebieten, in denen kein zuverlässiges Stromnetz vorhanden ist, lebenswichtig sein kann. Die Anlagen sind wartungsarm und erfordern keine ständige Betreuung durch Fachpersonal.
- Quote paper
- Robert Fritsch (Author), 1996, Anwendungen von Solarstromanlagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96350