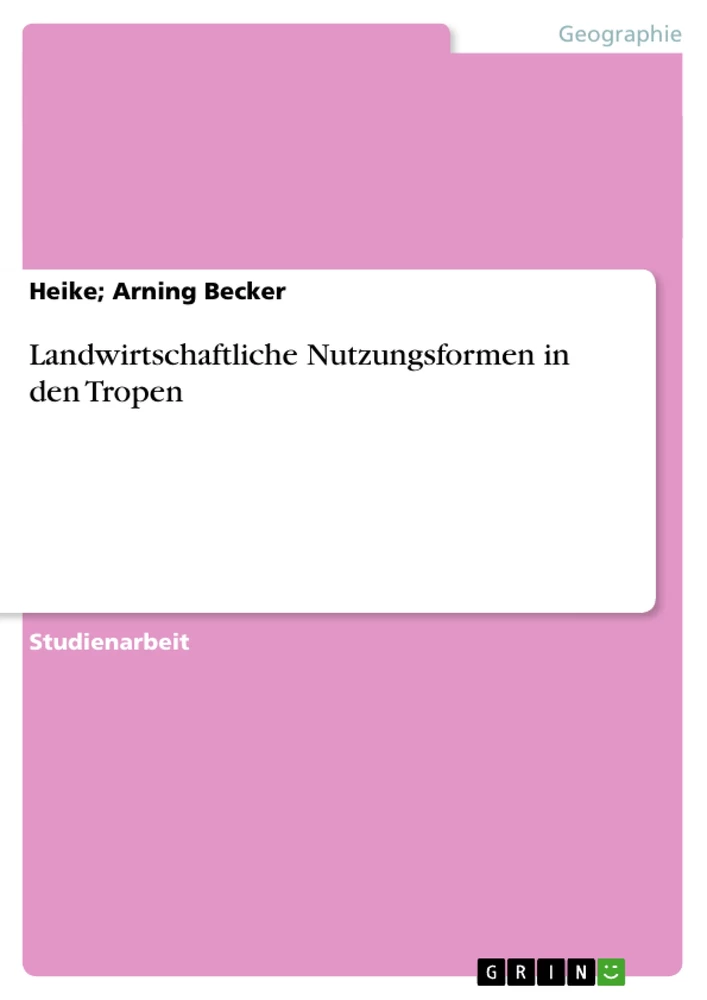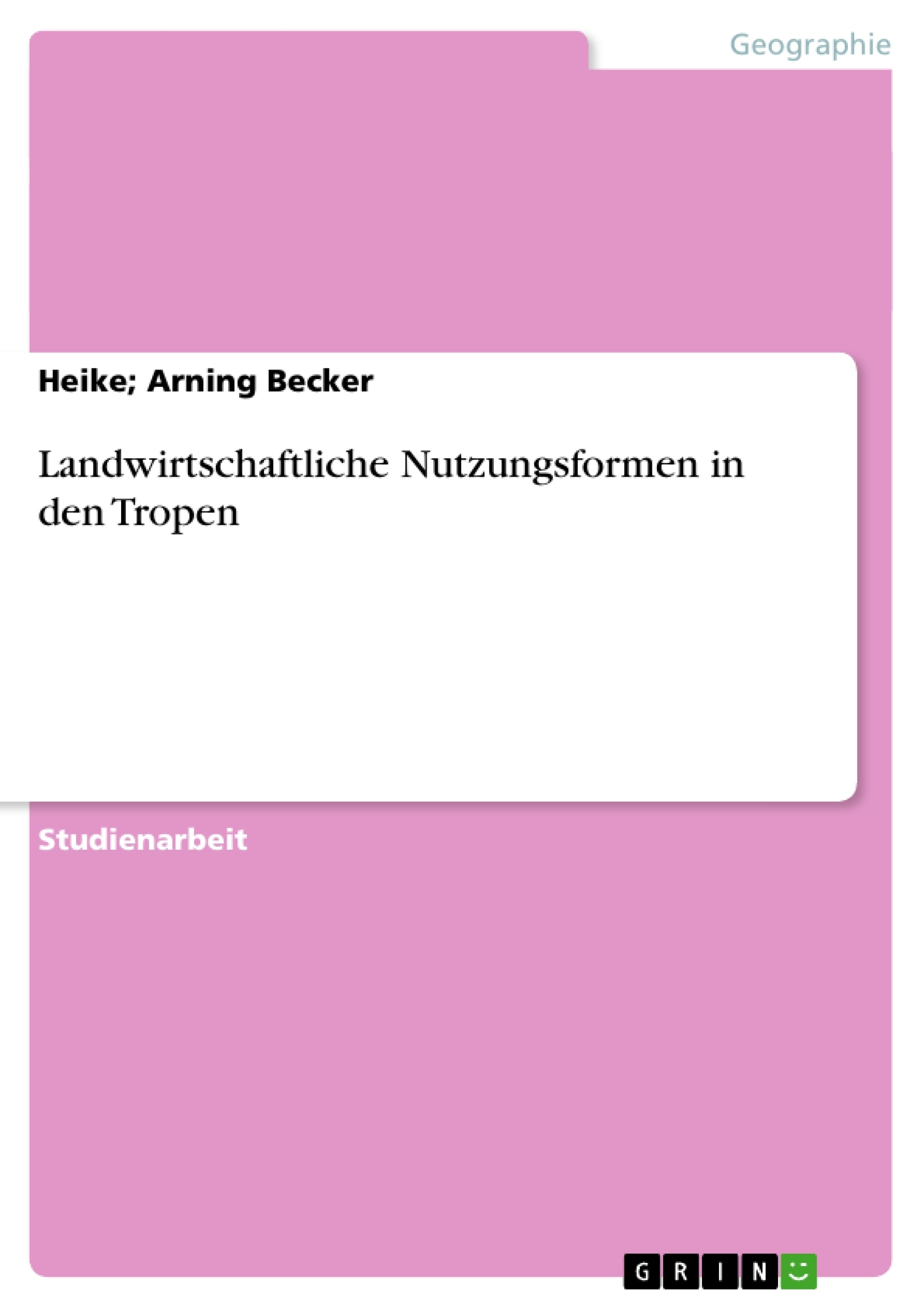Stellen Sie sich eine Welt vor, in der uralte Anbaumethoden auf moderne ökologische Herausforderungen treffen, in der die Balance zwischen Mensch und Natur ständig neu verhandelt wird. Dieser umfassende Band entführt Sie in die vielfältigen Agrarlandschaften der Tropen, von den nährstoffarmen Böden der Regenwälder bis zu den fruchtbaren Oasen der Trockengebiete. Erleben Sie die Dynamik des Regenfeldbaus, von den traditionellen Wanderfeldbau-Systemen (shifting cultivation), die einst im Einklang mit der Natur standen, bis hin zu den komplexen Herausforderungen der Agrokolonisation und den zukunftsweisenden Ansätzen des ökologischen Landbaus (eco-farming) und der Agroforstwirtschaft. Tauchen Sie ein in die Welt des Bewässerungsfeldbaus, wo ausgeklügelte Techniken zur Wassergewinnung und -verteilung das Leben in den Oasen ermöglichen und der Nassreisanbau in Südostasien eine Lebensgrundlage für Millionen darstellt. Erkunden Sie die Vor- und Nachteile von Dauerkulturen, von den kleinbäuerlichen Betrieben, die auf Selbstversorgung ausgerichtet sind, bis zu den global agierenden Plantagen mit ihren Monokulturen und den damit verbundenen ökologischen Risiken. Nicht zuletzt beleuchtet das Buch die Weidewirtschaft, insbesondere das Hirtennomadentum in den Trocken- und Dornsavannen, und die zunehmenden Konflikte zwischen traditionellen Lebensweisen und den Anforderungen einer modernen Welt. Mit einem fundierten Blick auf Bodenproblematik, Nachhaltigkeit und sozioökonomische Aspekte bietet dieses Werk eine unverzichtbare Analyse der Landwirtschaft in den Tropen, die sowohl Studierende und Forschende als auch Praktiker und interessierte Leser gleichermaßen anspricht. Es zeigt, wie wichtig es ist, lokale Ressourcen optimal zu nutzen, ökologische Gleichgewichte zu bewahren und die Bedürfnisse der Kleinbauern in den Mittelpunkt zu stellen, um eine zukunftsfähige Landwirtschaft in dieser einzigartigen und sensiblen Region zu gewährleisten. Die detaillierte Auseinandersetzung mit verschiedenen Anbausystemen, von der Wald-Feld-Wechselwirtschaft bis zur Integration von Nutztieren und Mulchen im ökologischen Landbau, eröffnet neue Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung und den Schutz der tropischen Ökosysteme.
Gliederung
1. Regenfeldbau
1.0. Bodenproblematik in den dauerfeuchten Tropen
1.1. shifting cultivation / Wanderfeldbau
1.2. Feldgraswirtschaft
1.3. PermanenterRegenfeldbau (eco-farming/Agroforstwirtschaft)
2. Bewässerungsfeldbau
2.1. Oasen
2.2. Naßreis
3. Dauerkulturen
3.1. Bauernkulturen
3.2. Plantagen
4. Weidewirtschaft
4.1. Hirtennomadentum & stationäre extensive Weidewirtschaft
5. Literatur
1. Regenfeldbau
1.0. Bodenproblematik (dauerfeuchte Tropen)
Ferrallitische Böden selbst sehr wenig fruchtbar:
- Geringe Kationenaustauschkapazität durch Mangel an Dreischichttonmineralien und Huminsäuren.
- Überwiegend Zweischichttonminerale (z.B. Kaolinite)
- Rasche Auswaschung durch hohe Niederschläge (auch bei Düngung) Bodenübersäuerung
- Durch rasch chemische und physikalische Verwitterung tiefliegende C- Horizonte mit Primärtonmineralien (5-8 m tief; max. 30 m tief)
+ Tropischer Regenwald lebt nicht aus sondern auf dem Boden (Nährstoffkreislauf)
Bei Nutzung: Nährstoffkreislauf wird unterbrochen + rasches Absinken der Bodenfruchtbarkeit
+ zunehmender Unkrautwuchs, Bodenstrukturzerfall, Erosion
- Regeneration der Bodenfruchtbarkeit langwierig und unvollständig.
- Notwendigkeit der Brache mit regional unterschiedlicher Dauer.
1.1. shifting cultivation / Wanderfeldbau
Es gibt viele Beschreibungen und Begriffsbildungen zu shifting cultivation. Shifting cultivation wird oft mit ,,Landwirtschaft in den Tropen" verwechselt. Im weiteren Sinne ist shifting cultivation gleich ,,Wanderfeldbau", im engeren Sinne umfaßt shifting cultivation aber den traditionellen Wanderfeldbau mit Wohnsitzverlagerung. Der Wanderfeldbau ohne Wohnsitzverlagerung heißt Landwechselwirtschaft.
Abb.: Vereinfachte modellhafte Darstellung des Systems der Wald-Feld- Wechselwirtschaft (aus: Fundamente, S. 40)
Das System shifting cultivation
a) Rodung / Brandrodung
- Feuer = ,,brutale Mobilmachung der in Pflanzen gespeicherten potentiellen Bodenfruchtbarkeit"
- Aschedüngung ist Nährstofflieferung und hebt den pH-Wertes der normalerweise sehr sauren Böden an
- Feuer = Vernichtung von Unkraut und Schädlingen
- ansonsten Einsatz von Buschmesser und Hackwerkzeugen
b) Feldnutzung
Nach der Brandrodung:
- 1 Jahr Feldnutzung in den dauerfeuchten Tropen
- 2-4 Jahre Feldnutzung bei Ackerbau in den wechself. Tropen
Ab 2. Jahr geringere Erträge:
- Unkraut wuchert in die frei gewordene Fläche
- Erosion der dünnen Asche- und Humusdecke durch Starkregen (Blätterdach fehlt) Gleichzeitig: Erhöhung des Arbeitsaufwandes (Unkrautbekämpfung mit der Hacke)
+ Verhältnis Arbeit : Ertrag wird größer
+ Ab dem 4. Jahr lohnt sich Bewirtschaftung nicht mehr
- Aussaat zu Beginn der Regenzeit mit Pflanzstock
- Wichtigste Kulturen sind Trockenreis (Asien), Maniok und Mais (Afrika und Lateinamerika)
c) Waldbrache
- für 10-20 Jahre
- Regeneration der Böden
- Aufbau neuer Biomasse
- Traditionelles Shifting cultivation ist sehr flächenaufwendig; kann nur in dünn besiedelten Regionen mit großen Waldreserven funktionieren / Tragfähigkeit: etwa 30 E/km²
- sehr verschwenderische Anbauweise: Produktion von 1t Getreide erfordert 300t Biomasse
- Aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Produktionsform, bei der man mit minimalem Aufwand an Kapital und Investitionen sich in möglichst kurzer Zeit selbstversorgen kann.
- Erträge rel. bescheiden (1t Getreide/ ha / Saison) aber sicher
- Ökologisch ist shifting cultivation weniger schädlich als angenommen.
- Pflanzstock läßt Oberboden fast unversehrt
- Baumstümpfe reduzieren die Erosionsgefahr und gewährleisten durch Stockausschlag einen Wiederaufwuchs von Sekundärwald#
+ shifting cultivation führt nicht zur Waldzerstörung sondern zur Walddegradation
- Aber shifting cultivation wird oft mit Agrokolonisation verwechselt, da beide Systeme Brandrodung anwenden, aber sonst nichts gemeinsam haben. (siehe 1.3.)
- In letzten Jahrzehnten an Bedeutung verloren.
- Tragfähigkeit überschritten, in feuchten Tropen 55 E/km²
+ ,,Auslaufmodell"
Abb.: Modell der Entwicklung der shifting cultivation in Abhängigkeit vom Anbauintervall (aus: Fundamente, S.42)
1.2. Feldgraswirtschaft
Definition: Wechsel zwischen mehrjährigem Feldbau und mehrjähriger Grasbrache, teilweise mit Weidenutzung.
Vorkommen: Beschränkter Umfang, vorwiegend in Feuchtsavannen und Höhenlagen, bei hohem Bevölkerungsdruck teilweise auch in den feuchten Tropen.
Bodenprobleme vergleichbar mit denen der dauerfeuchten Tropen (etwas geringere Auswaschung)
1.3. Permanenter Regenfeldbau
a) Agrokolonisation
- anfängliche Brandrodung (einzige Gemeinsamkeit mit s.c.)
- permanente Pflanzenproduktion bzw. Tierhaltung (statt Wechsel von Anbau- und Bracheperiode)
+ stationäre Siedlung & Landnutzung
- Marktorientierung (statt Subsistenzwirtschaft)
- Akteure sind , ,,Glücksritter" (statt Stammesgruppen)
- individuelle Landeigentumstitel werden angestrebt (statt temporäre Nutzrechte von Clanland)
- Entwaldung ist endgültig (keine Chance für Wiederaufwuchs)
b) ökologischer Landbau
- auch ,,ecofarming", ,,angepaßte" oder ,,standortgerechte Landwirtschaft" genannt
- ist ökologische Intensivierung von autochthonen, d.h. bodenständigen, traditionellen Landnutzungssystemen
- Erste Hinweise auf solche Systeme bereits bei Mayas
- Systeme mit Baumgärten heißen ,,Agroforstwirtschaft"
- im modernen ökologischen Landbau wird neben Feld- und Baumproduktion auch Tierproduktion betrieben (Agro-silvo-pastorale- System)
Ökologische Ziele:
- Sicherung der ökol. Grundfunktionen bzgl. Boden, Wasser, Nährstoffen, Humus
- Sicherung vielfältiger Biotope als Voraussetzung für Artenreichtum
- Sicherung eines artenreichen Systems als Grundlage für ein Gleichgewicht
- Erhaltung einer attraktiven Gesamtlandschaft als Lebensraum
Sozioökonomische Ziele:
- Bedürfnisse von Kleinbauern bevorzugt beachten
- Strategien mit geringem externen Input werden zur Stabilisierung des Systems
- maximale, aber langfristige Nutzung der lokalen Ressourcen
- Subsistenzwirtschaft mit geringer Marktproduktion
- Problem: System kann nur bei relativ gleichbleibender Bevölkerungszahl funktionieren
- Erosionsschutz durch Baumintegration, hecken, Anbau von Mischkulturen, Integration von Nutztieren und Mulchen
- Bsp.: Bergland v. Ruanda & Serer; Sudan (Trockensavanne)
2. Bewässerungsfeldbau
2.1. Oasen
Böden:
Die fersiallitischen Böden der Trocken- und Dornsavannen sind nährstoffreicher und weniger tiefgründig als die ferralltischen Böden der dauerfeuchten Tropen.
Oasen-Typen:
- Flußoasen (Bewässerung aus Fremdlingsflüssen)
- Grundwasseroasen (Hochliegender Grundwasserspiegel) (z.B. Foggara- Oasen)
- Artesische Brunnen (artesisches Becken)
- Quelloasen (Am Fuß niederschlagsreicher Gebirge; Quellhorizont)
Problem der Versalzung:
Aufwärtsgerichteter Bodenwasserstrom bis 2m Tiefe (Verdunstung, kapillarer Sog) verursacht Versalzung. Versalzte Böden sind bei Trockenheit hart und wenn sie feucht sind zäh und wasserstauend.
Lösung:
Be- und Entwässerung nötig (Drainagen). Tiefbrunnen liefern unversalztes Wasser, erhöhen aber das Problem des extensiven Wasserverbrauchs.
2.2. Naßreisanbau
Verbreitung: insbesondere in SO-Asien (21,8% der Ackerflächen).
Besonders verbreitet auf jungvulkanischen Böden und Flußauenböden, aber auch auf anderen Böden.
Funktion:
Die stehende Wasserschicht erhält die Bodenfruchtbarkeit; die organische Schicht wird langsamer abgebaut. Tropische Weißwasserflüsse aus Gebirgen liefern zusätzliche Nährstoffe.
Höhere Erträge pro ha; dauerhafte Bodennutzung; mehrere Ernten pro Jahr.
Aber:
- Kapital- und arbeitsintensive Landnutzungsform, bei der ein gewisser Kenntnisstand erforderlich ist.
- Erhöhte Schädlingsanfälligkeit.
Grüne Revolution:
- Ausweitung und technologische und pflanzenzuchtbedingte Verbesserung des Naßreisanbaus in SO-Asien seit den 60er Jahren auf Grund des erhöhten Bevölkerungsdrucks und der Kommerzialisierung der Landwirtschaft. Führte zu einem Anstieg der Erträge, aber häufig auch zu einer Verstärkung der Disparitäten zwischen arm und reich.
- Fallbeispiel: Sumatra
3. Dauerkulturen
- Anbau mehrjähriger Kulturen:
- Feldkulturen: Zuckerrohr, Sisal, Ananas etc.
- Strauchkulturen: Kaffee, Tee etc.
- Baumkulturen: Bananen, Kautschuk, Öl- & Kokospalme, etc.
- Vorwiegend in den Tropen und Randtropen
- Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit relativ gut
- Systeme: Bauernkultur & Plantagen
3.1. Bauernkulturen
Begriffserläuterung:
- kleine bis mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe
- dienen meist der Selbstversorgung (Subsistenzwirtschaft) und der Versorgung regionaler Märkte
- teilweise teilkommerziell (z.B. Tropisch-Afrika)
- Zusammenspiel zwischen ökonomischen Bindungen und ethnischen Traditionen
- Dauerkulturen entwickeln sich vor allem aus den Betriebsystemen der Brachewirtschaften und des permanenten Regenfeldanbaus
Eigenschaften:
~ ohne systematische Bewirtschaftung und Parzellenanlage
~ mehrere Produktionsformen (Mischkulturen)
~ geringe Flächenproduktivität
~ geringe Produktqualität
~ keine hohen Erträge
- geringer Arbeitsaufwand
- jahreszeitlicher Arbeitskraftausgleich
- Wettbewerbsfähigkeit liegt in der Vielseitigkeit
- stabile Nutzungsform aufgrund ihrer guten Angepaßtheit an die Ökologie der Regenwaldklimate
3.2. Plantagen
Begriffserläuterung:
- kapital- und arbeitsintensiver landwirtschaftlicher Großbetrieb
- Einsatz von Fremdkapital
- weltmarktorientiert (Cash crops)
Lage:
Die Plantagen der Gegenwart befinden sich meist in den jetzt unabhängigen Kolonien der feuchten Tropen; oft in Küstennähe
Eigenschaften:
~ hohe Produktivität & gute Produktqualität (durch Düngung, Saatkontrolle & Schädlingsbekämpfung)
~ lange Nutzungsdauer
~ Ausbildung einheimischer Arbeitskräfte
- Einsatz von Düngern und Schädlingsbekämpfungsmitteln
- Einrichtungen zur Aufbereitung bzw. Verarbeitung der Agrarprodukte
- Abhängigkeit von Verkehrsanbindungen
+ langfristige Investitionen, da während der Aufbauphase (1- 11 Jahre) kein Gewinn erzielt wird
+ hohe Inflexibilität
+ erhebliche Preis- und Gewinnschwankungen durch Abhängigkeit vom Markt
+ Vernachlässigung der Nahrungsmittelproduktion
+ meist Monokulturen - erst seit den letzten 20-30 a kommt es zum Aufbau von Mischkulturen
Anbaurisiken
- Verarmung der Böden (erhöhter Oberflächenabfluß, Abnahme der Bodenstabilität, Bodenauslaugung)
- Monokulturen sind extrem empfindlich für Schädlingsbefall
- Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln:
- Hohe toxische Belastung
- fehlende Kenntnisse über das Verhalten unter den Umweltbedingungen der Tropen
- rasche Generationsfolge vieler Schadorganismen
- Überdüngung:
- beeinträchtigt die Produktionsfunktion des Bodens
- erhöht die Anfälligkeit der Kulturpflanzen gegenüber Krankheitserregern und Schädlingen
- belastet Qualität des Wassers, Bodens & der Atmosphäre
- hohe Auswaschungsrate der wasserlöslichen Industriedünger aufgrund der geringen Austauschkapazität
Mischkulturen
Begriffserläuterung:
Feldbestände, in denen verschiedenen Nutzpflanzenarten zusammen heranwachsen, so daß sie sich gegenseitig beeinflussen können
Eigenschaften:
- In geeigneter Kombination hemmen sie die Ausbreitung von Schädlingen (Reduktion von 30-60 %)
- kompensatorische Effekte
- Ertragsvorteile durch vollständigere Nutzung der Wachstumsfaktoren, da die interspezifische Konkurrenz geringer ist als die intraspezifische
Konkurrenz
- z.T. geringere Erträge
- geringeres Marktrisiko
- bei unterschiedlichen Erntezeiten können Arbeitsplätze gleichmäßig eingesetzt werden (z.B. Ölpalmen und Kakao)
- Beispiel: Kakao verlangt einen Schattenanteil von 30-60 %, so kann man sie zwischen Nutzpflanzen setzen (z.B. Kokospalmen) oder Zwischenpflanze unter Ölpalmen
4. Weidewirtschaft
4.1. Hirtennomadentum & stationäre extensive Weidewirtschaft
Verbreitung:
wechselfeuchte Tropen, Trocken- und Dornsavanne
Vollnomadismus:
- keine längeren Niederlassungen & kein Feldbau
- kommt eher selten vor
Halbnomadismus:
- nur einige Mitglieder der Sozialgruppe sind an den Wanderungen beteiligt während vor allem Frauen, Kinder und ältere Personen an einem festen Siedlungsplatz bleiben
- Ackerbau am Siedlungsort
- es gibt viele Formen (z.B. trans humans, Almwirtschaft)
- Weltweit gibt es ca. 10 Mio. Nomaden, die aber riesige Flächen bewirtschaften
- Grundlage für die Weidewirtschaft sind stets Naturweiden. Diese weisen in der Regel eine geringe Biomassenproduktion auf, so daß die Weidefläche entsprechend groß sein muß.
- Die Wanderungsentfernungen sind entsprechend groß
- Verlust der Bedeutung als Händler und Transporteure =>
Zusammensetzung der Herden hat sich geändert (Schafe, Ziegen & Rinder statt Kamele & Pferde)
- Nomaden sind entscheidend sind auf den Handel mit Ackerbauern angewiesen, um die Ernährung zu sichern
- Es werden mehr tierische Produkte erzeugt, als zum Eigenbedarf benötigt.
- Es gibt staatliche Bemühungen (in Mali und Niger) Nomaden (deren Herden durch Dürrekatastrophen massiv dezimiert oder vernichtet wurden) seßhaft zu machen.
- Traditionen werden aber nicht aufgegeben, es wird weiter Tierhaltung betrieben
- Überweidung & stärkere Belastung der gefährdeten Gebiete in Siedlungsnähe / Folge: Desertifikation
5. Literatur
BRAUNS,T. & SCHOLZ,U.: ,,Shifting Cultivation - Krebsschaden aller Tropenländer?" in: Geographische Rundschau, Jahrgang 49; Heft 1/1997; Seite 4-11
BÜTTNER,W. & RUPPERT,H. u.a. (Hrsg.): ,, Geographie - Entwicklungsräume in den Tropen"; Cornelsen-Verlag 1994
BÜTOW, M., GRABOWSKI, H., MEYER, G.-U., SCHNEIDER, W.,
WEHRS, K. & WINTER, W. (1998): Seydlitz Geographie, Bd. 1. - 176 S.; Hannover (Schroedel).
DOPPLER, W. (1991): ,,Landwirtschaftliche Betriebsysteme in den Tropen und Subtropen" - 216 S., 66 Abb., 72 Tab; (Eugen Ulmer). HERKENDELL,J. & KOCH,E. : ,,Bodenzerstörung in den Tropen"; C.H.Beck-Verlag, München 1991
HESKE,H.: ,,Ökologischer Landbau in den humiden Tropen" in: Praxis Geographie; Heft 7-8/1991; Seite 40-43
KÜMMERLE, U. & von der RUHREN, N.: ,,Fundamente - Kursthemen / Dritte Welt. Entwicklungsräume in den Tropen"; Klett-Perthes Verlag Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Gotha 1990
MANSHARD, W. & MÄCKEL, R. (1995): ,,Umwelt und Entwicklung in den Tropen - Naturpotential und Landnutzung." - 182 S., 8 Abb., 19 Tab.; Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft).
MÜLLER-SÄMANN, K. M. (1986): ,,Bodenfruchtbarkeit und standortgerechte Landwirtschaft - Eine Studie über Maßnahmen und Methoden im Tropischen Pflanzenbau"
SCHOLZ,U.: ,,Ökonomie und Ökologie im Einklang: Kleinbäuerliche Produktionssysteme auf Sumatra" in: Geographische Rundschau, Jahrgang 41; Heft 7-8/1989; Seite 424-430
SCHOLZ, U. (1989): ,,Kleinbäuerliche Produktionssysteme auf Sumatra" Geographische Rundschau, 41(7/8): 424-430, 4 Abb., 2 Tab. WEISCHET, W. (1978): ,,Die Grüne Revolution - Erfolge, Möglichkeiten und Grenzen in ökologischer Sicht. - Fragenkreise": 33 S.; München (Blutenburg).
Häufig gestellte Fragen
Was ist Regenfeldbau?
Regenfeldbau ist eine Form der Landwirtschaft, bei der die Pflanzen ausschließlich durch Niederschlag bewässert werden. Der Text unterscheidet zwischen verschiedenen Formen des Regenfeldbaus in den Tropen, darunter Wanderfeldbau, Feldgraswirtschaft und permanenter Regenfeldbau.
Was ist das Problem mit Böden in den dauerfeuchten Tropen?
Ferrallitische Böden, die in den dauerfeuchten Tropen vorkommen, sind oft wenig fruchtbar. Sie haben eine geringe Kationenaustauschkapazität, werden durch hohe Niederschläge schnell ausgelaugt und versauern. Der Nährstoffkreislauf wird bei Nutzung unterbrochen, was zu einem raschen Absinken der Bodenfruchtbarkeit führt.
Was ist shifting cultivation oder Wanderfeldbau?
Shifting cultivation, auch Wanderfeldbau genannt, ist ein landwirtschaftliches System, bei dem ein Stück Land gerodet und für eine kurze Zeit bebaut wird. Danach wird es brach gelassen, damit sich der Boden erholen kann. Der Text unterscheidet zwischen Wanderfeldbau mit und ohne Wohnsitzverlagerung.
Was sind die Vor- und Nachteile von Wanderfeldbau?
Vorteile sind minimaler Aufwand an Kapital und Investitionen, Selbstversorgung in kurzer Zeit und relativ sichere Erträge. Ökologisch ist es weniger schädlich als angenommen, solange es nicht zur Waldzerstörung führt. Nachteile sind die Flächenaufwendigkeit, die Gefahr der Walddegradation und die geringen Erträge.
Was ist Feldgraswirtschaft?
Feldgraswirtschaft ist ein Wechsel zwischen mehrjährigem Feldbau und mehrjähriger Grasbrache, teilweise mit Weidenutzung. Sie kommt vorwiegend in Feuchtsavannen und Höhenlagen vor.
Was ist permanenter Regenfeldbau und welche Formen gibt es?
Permanenter Regenfeldbau umfasst Systeme wie Agrokolonisation und ökologischen Landbau. Agrokolonisation beinhaltet Brandrodung und permanente Pflanzenproduktion, während ökologischer Landbau auf die Sicherung ökologischer Grundfunktionen und die Bedürfnisse von Kleinbauern abzielt.
Was ist Agrokolonisation?
Agrokolonisation ist eine Form des permanenten Regenfeldbaus, die durch anfängliche Brandrodung, permanente Pflanzenproduktion oder Tierhaltung, stationäre Siedlung und Landnutzung sowie Marktorientierung gekennzeichnet ist. Im Gegensatz zum traditionellen Wanderfeldbau führt sie zur endgültigen Entwaldung.
Was ist ökologischer Landbau (ecofarming/Agroforstwirtschaft)?
Ökologischer Landbau ist eine ökologische Intensivierung traditioneller Landnutzungssysteme. Er zielt auf die Sicherung ökologischer Grundfunktionen, den Erhalt vielfältiger Biotope und die langfristige Nutzung lokaler Ressourcen ab.
Was sind Bewässerungsfeldbau und Oasen?
Bewässerungsfeldbau ist eine Form der Landwirtschaft, bei der die Pflanzen künstlich bewässert werden. Oasen sind Gebiete in Trockenregionen, in denen Bewässerung möglich ist. Der Text unterscheidet zwischen Flußoasen, Grundwasseroasen, Artesischen Brunnen und Quelloasen.
Was ist das Problem der Versalzung in Oasen?
Aufwärtsgerichteter Bodenwasserstrom verursacht Versalzung. Dies kann durch Be- und Entwässerung, insbesondere durch Drainagen, gelöst werden.
Was ist Naßreisanbau?
Naßreisanbau ist eine arbeits- und kapitalintensive Landnutzungsform, die besonders in SO-Asien verbreitet ist. Die stehende Wasserschicht erhält die Bodenfruchtbarkeit und ermöglicht mehrere Ernten pro Jahr. Die Grüne Revolution hat den Naßreisanbau technologisch verbessert, aber auch zu Disparitäten geführt.
Was sind Dauerkulturen und welche Arten gibt es?
Dauerkulturen sind mehrjährige Kulturen wie Zuckerrohr, Kaffee, Bananen, Kautschuk und Ölpalmen. Sie werden in Bauernkulturen und Plantagen angebaut.
Was sind Bauernkulturen und ihre Eigenschaften?
Bauernkulturen sind kleine bis mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe, die meist der Selbstversorgung und der Versorgung regionaler Märkte dienen. Sie zeichnen sich durch Mischkulturen, geringe Flächenproduktivität und einen geringen Arbeitsaufwand aus.
Was sind Plantagen und ihre Eigenschaften?
Plantagen sind kapital- und arbeitsintensive landwirtschaftliche Großbetriebe, die weltmarktorientiert sind und Cash Crops anbauen. Sie zeichnen sich durch hohe Produktivität, lange Nutzungsdauer und den Einsatz von Düngern und Schädlingsbekämpfungsmitteln aus.
Welche Anbaurisiken bestehen bei Plantagen?
Anbaurisiken bei Plantagen sind die Verarmung der Böden, Schädlingsbefall in Monokulturen, toxische Belastung durch Schädlingsbekämpfungsmittel und Überdüngung.
Was sind Mischkulturen und ihre Vorteile?
Mischkulturen sind Feldbestände, in denen verschiedene Nutzpflanzenarten zusammen heranwachsen. Sie hemmen die Ausbreitung von Schädlingen, bieten kompensatorische Effekte und nutzen Wachstumsfaktoren vollständig aus.
Was ist Weidewirtschaft und welche Formen gibt es?
Weidewirtschaft ist die Nutzung von Weideflächen zur Tierhaltung. Der Text unterscheidet zwischen Hirtennomadentum (Voll- und Halbnomadismus) und stationärer extensiver Weidewirtschaft.
Was ist Hirtennomadentum und welche Arten gibt es?
Hirtennomadentum ist eine Form der Weidewirtschaft, bei der Hirten mit ihren Herden wandern. Vollnomadismus beinhaltet keine längeren Niederlassungen, während Halbnomadismus Ackerbau am Siedlungsort beinhaltet.
Was sind die Probleme der Weidewirtschaft?
Probleme der Weidewirtschaft sind die Überweidung und die stärkere Belastung der gefährdeten Gebiete in Siedlungsnähe, was zur Desertifikation führen kann.
- Quote paper
- Heike; Arning Becker (Author), 1999, Landwirtschaftliche Nutzungsformen in den Tropen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96249