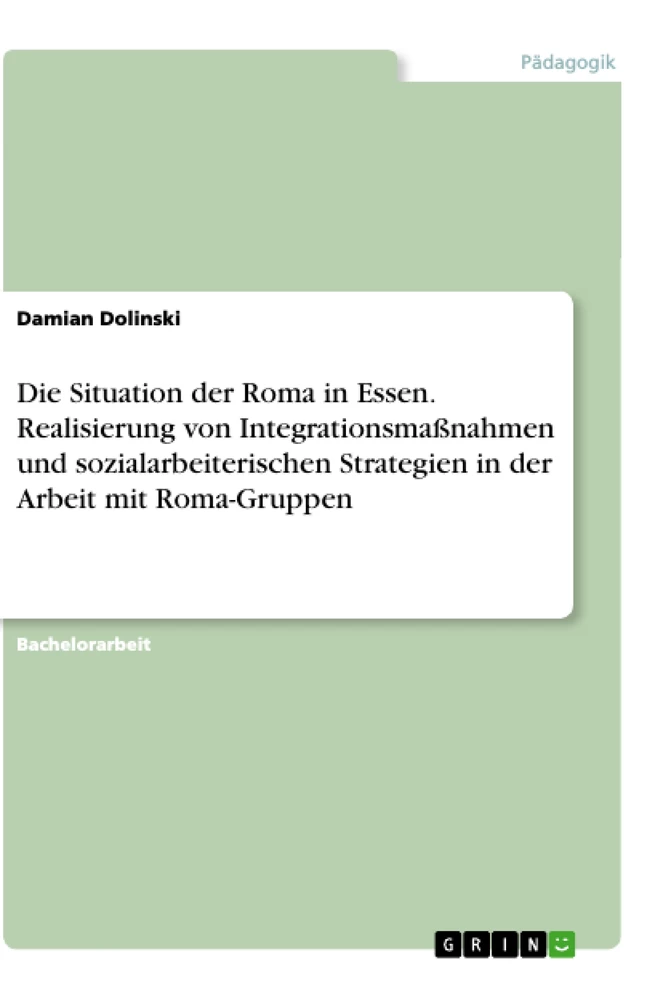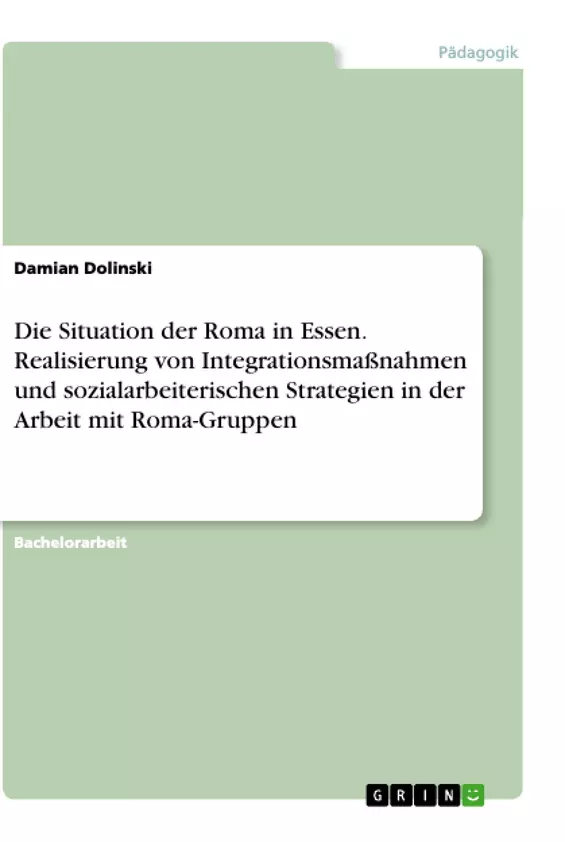Nach aktuellen Schätzungen leben 10–12 Millionen Roma in Europa, in den Staaten Ost- und Südeuropas sind sie am stärksten vertreten, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union halten sich 6 Millionen auf. Die vorliegende Bachelorarbeit versucht an in der Stadt Essen lebenden Roma zu ergründen, wie bestimmte Integrationsmaßnahmen dazu beitragen können, diese soziokulturelle und in ihrer Glaubensausrichtung gespaltene Minderheit nicht mehr zu verachten, sondern einzubeziehen. Zu den Maßnahmen zählen Sprachkompetenz, Schul- und Berufsausbildung und sozialarbeiterische Maßnahmen. Integration ist dann geglückt, wenn aus einem Nebeneinander ein Miteinander geworden ist.
Im ersten Kapitel werden definitorische Grundlagen geklärt. Begrifflichkeiten wie Zigeuner als historisch-diskriminierende Fremdbezeichnung, Roma als Eigenbezeichnung und Antiziganismus werden beschrieben. Auf das Wort Gadjo als ausgrenzende Bezeichnung für alle, die keine Roma sind, wird eingegangen. Das zweite Kapitel schildert den langen, mehrere Jahrhunderte dauernden Weg dieser ethnischen Minderheit vom Aufbruch aus Indien nach Deutschland mit den unterschiedlichsten Ausprägungen ihrer Diskriminierung von der Verachtung, Verfolgung, Ausgrenzung bis zur Vernichtung im Nationalsozialismus.
In Kapitel drei wird über die individuell empfundene Zugehörigkeit zu dieser Volksgruppe berichtet, zum Verständnis ihrer Lebensweise sollen Betrachtungen über gemeinsame Merkmale wie Sprache, Traditionen, Geschlechterrollen und Lebensalltag beitragen. Im vierten Kapitel werden Integrationsstrategien vorgestellt, mit denen diese Minderheit in die Mehrheitsgesellschaft inkludiert werden kann, um ihr einen Start ins Bildungs-, Arbeits- und Schulwesen zu ermöglichen. Auf sozialarbeiterische Maßnahmen, die zu einer erfolgreichen Eingliederung beitragen, wird erst im Fazit ausführlicher eingegangen. Das Kapitel fünf beinhaltet das methodische Vorgehen der empirischen Forschungsarbeit, die Auswahlkriterien für die Interviewpartner und den Aufbau des Interviewleitfadens. Danach werden die durchgeführten Interviews durch die Transkription verschriftlicht, ausgewertet und dargestellt. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit inhaltlich analysiert, zusammengefügt bzw. gegenübergestellt und es werden Schlussfolgerungen gezogen. Handlungsperspektiven für die Soziale Arbeit werden im Fazit empfohlen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsbestimmungen
- 1.1 Fremdbezeichnung – Zigeuner
- 1.2 Eigenbezeichnung - Roma
- 1.3 Gadjo (Nicht-Roma)
- 1.4 Antiziganismus
- 2. Die Geschichte der Roma
- 2.1 Der lange Weg aus Indien nach Europa
- 2.2 Frühe Neuzeit bis zur Weimarer Republik
- 2.3 Nationalsozialistische Verfolgung
- 2.4 Die Wiedergutmachungspolitik
- 2.5 Roma-Flüchtlinge nach 1990
- 3. Eigenheiten der Roma-Kultur
- 3.1 Ethnizität
- 3.2 Sprache der Roma (Romi Chib)
- 3.3 Traditionen
- 3.3.1 Romani Buti (Arbeit)
- 3.3.2 Rituelle Reinheit und Unreinheit
- 3.3.3 Geschlechterrollen
- 3.3.4 Das Roma-Gericht (Kris)
- 4. Integrationsmaßnahmen in der Arbeit mit Roma
- 4.1 Ziel der Integration
- 4.2 Erlernen der deutschen Sprache
- 4.3 Bildungssituation der Roma in Deutschland
- 4.4 Berufliche Integration
- 4.5 Soziale Integration der Roma
- 5. Vorstellung des empirischen Konzepts
- 5.1 Vorbereitung und Durchführung des Forschungsvorhabens
- 5.1.1 Erhebungsinstrument: Leitfadeninterview
- 5.1.2 Auswahl der Probanden
- 5.1.3 Aufbau und Dimensionen des Interviewleitfadens
- 5.1.4 Vorbereitung und Durchführung der Interviews
- 5.2 Auswertungsverfahren der qualitativen Datenanalyse
- 5.2.1 Transkription
- 5.2.2 Auswertungs- und Analyseverfahren des Leitfadeninterviews
- 6. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
- 6.1 Inhaltliche Analyse der Interviews
- 6.1.1 Auswertung Proband A
- 6.1.2 Auswertung Proband B
- 6.1.3 Auswertung Proband C
- 6.2 Interpretativer Vergleich der Interviews
- 6.2.1 Personenporträts der Probanden
- 6.2.2 Dimension der Sprachkompetenz
- 6.2.3 Dimension der Bildungssituation
- 6.2.4 Dimension der beruflichen Integration
- 6.2.5 Dimension der sozialen Integration
- 6.2.6 Dimension der Roma-Eigenarten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit der Situation der Roma in Essen und untersucht, wie Integrationsmaßnahmen und sozialarbeiterische Strategien zur Verbesserung ihrer Lebenslage beitragen können. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen der Integration von Roma in Deutschland zu entwickeln und die Wirksamkeit von Integrationsmaßnahmen zu analysieren.
- Diskriminierung und Ausgrenzung von Roma in Deutschland
- Historische Entwicklung der Roma und ihre Kultur
- Integrationsmaßnahmen und deren Wirksamkeit
- Soziale Arbeit und ihre Rolle bei der Integration von Roma
- Empirische Untersuchung der Integrationserfahrungen von Roma in Essen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problemstellung der Diskriminierung von Roma in Deutschland und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit. Kapitel 1 definiert grundlegende Begriffe wie Zigeuner, Roma, Gadjo und Antiziganismus. Kapitel 2 schildert die Geschichte der Roma, ihren Weg nach Europa und die verschiedenen Formen der Diskriminierung, denen sie im Laufe der Zeit ausgesetzt waren. Kapitel 3 befasst sich mit den Eigenheiten der Roma-Kultur, ihren Traditionen und Wertvorstellungen. Kapitel 4 untersucht die Ziele und Strategien von Integrationsmaßnahmen im Hinblick auf Roma und analysiert deren Effektivität. Kapitel 5 beschreibt das empirische Konzept der Arbeit, die Forschungsmethodik und die Datenerhebung.
Schlüsselwörter
Roma, Integration, Diskriminierung, Ausgrenzung, Soziale Arbeit, Empirische Forschung, Lebenslage, Kultur, Geschichte, Traditionen, Integrationsmaßnahmen, Sprachkompetenz, Bildungssituation, Berufliche Integration, Soziale Integration.
- Arbeit zitieren
- Damian Dolinski (Autor:in), 2016, Die Situation der Roma in Essen. Realisierung von Integrationsmaßnahmen und sozialarbeiterischen Strategien in der Arbeit mit Roma-Gruppen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962460