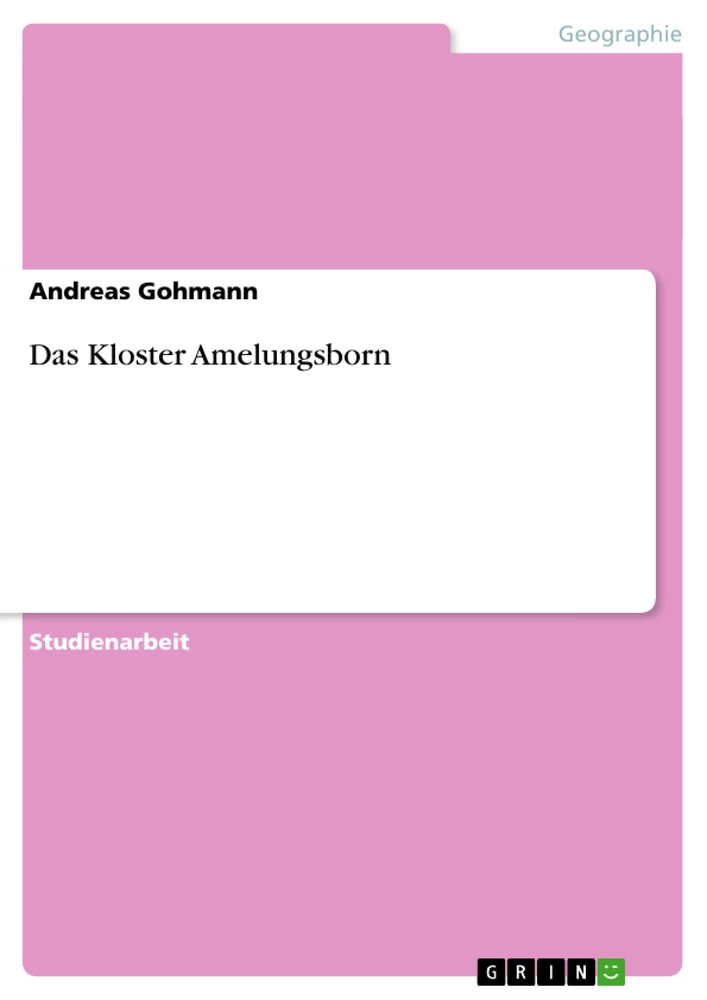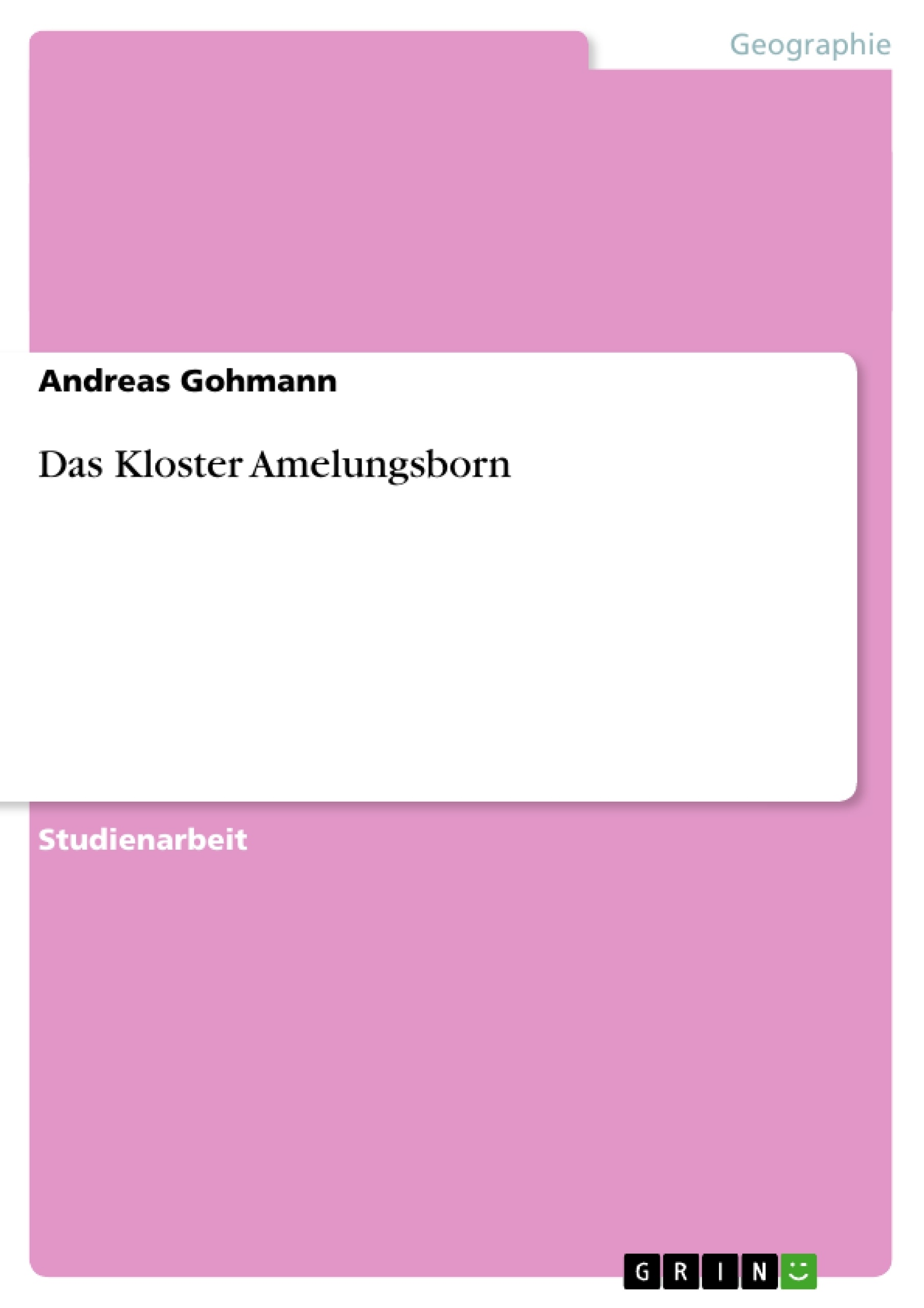Inhalt
I. Die Geschichte des Klosters Amelungsborn
I.1. Die Gründung
I.2. Die Beziehungen zur weltlichen Macht
I.3. Die Beziehungen zum Papst
I.4. Die Beziehungen zu den Bischöfen
I.5. Der Besitz des Klosters Amelungsborn
I.6. Wirtschaft und Verwaltung
I.7. Die Ausbreitung des Ordens in den Osten
II. Der Urkundenbestand des Klosters Amelungsborn
II.1. Allgemeiner Überblick über den Urkundenbestand
II.2. Die Privilegierung des Klosters im 12. Jh.
III. Die Verzeichnisse des Grundbesitzes
IV. Zeitgenössische literarische Quellen
V. Anhang
V.1. Hilfsmittel
V.2. Quellen
V.3. Literatur
I. Die Geschichte des Klosters Amelungsborn
I.1. Die Gründung
Die Gründung des Klosters Amelungsborn ist einzuordnen in eine Reihe von Klosterstiftungen durch die großen Geschlechter Sachsens. Bereits im Jahre 780 stifteten die Ludolfinger Kloster Brunshausen. Damit begann eine Folge von Stiftungen der Billunger, Katlenburger, Northeimer und anderer adliger Familien, die bis nach Amelungsborn reicht.1
Der Name des Klosters ist von dem Platz, auf dem es errichtet wurde, übernommen worden. „Amelung“ ist ein in Sachsen weit verbreiteter Personenname. „Born“ (Brunnen) deutet auf einen Quellbrunnen hin.2
Dieses „predium in loco qui Amelungsbrunnen dicitur“ schenkte Herzog Otto von Northeim im Jahre 1082 dem Blasiuskloster in Northeim.3 Die Tatsache aber, daß dessen Sohn Siegfried III. von Northeim das Land zurückerwarb, legt nahe, daß er es mit der Absicht, ein Kloster zu gründen, getan hat. Die Gründung des Klosters Amelungsborn verwirklichte dann dessen Sohn Siegfried IV. von Boyneburg und Homburg. Eine Stiftungsurkunde liegt jedoch nicht vor. Den Zisterziensern wurde die Stiftung erst 1144 durch die Vicelinusurkunde sichergestellt.4
Als Motiv für die Gründung nennt Göhmann5 die Absicht Siegfrieds, den nördlichen Teil seiner Grafschaft besser kontrollieren zu können, indem Amelungsborn Teil seiner Eigenkirchenherrschaft wird. Als Jahr der Stiftung des Klosters wird 1129 genannt. Dieses lasse sich errechnen, da am 20. November 1135, wie in verschiedenen Verzeichnissen der Zisterzienser nachzulesen sei, Abt und Konvent in das Kloster einzogen und zwischen Stiftung und Einzug des Konvents üblicherweise sechs Jahre vergingen. 1129 wurde in Amelungsborn eine Gründungsgruppe aus dem Kloster Altenkamp tätig. Altenkamp selber geht über Morimond (1122 gegr.) auf Citeaux (1098) zurück.
Die These, Siegfried habe Amelungsborn zur Konsolidierung seiner Macht gegründet, wird dadurch gestützt, daß Siegfried die Vogteirechte für sich in Anspruch nahm, die von den Zisterziensern grundsätzlich eingefordert wurden. Er betrachtete Amelungsborn als Allod und nahm es in sein Allodienverzeichnis auf. Seine Beziehung zum Kloster kennzeichnet besonders die Tatsache, daß er auf die Mönche großen Druck ausgeübt hat, seinen Halbbruder Heinrich zum Abt zu wählen. Wie Heutger6 ausführt, wurde dieser am 21.3.1146 von Kardinal Thomas, dem Legaten des Zisterzienserpapstes Eugen III., wegen Untauglichkeit, eingestandener Simonie und Ungehorsams abgesetzt und seines Priesteramtes enthoben.7
Auf die Frage, weshalb Siegfried gerade die Zisterzienser berief, nennt Heutger8 ihren „asketisch bedingten Drang zur inneren Kolonisation“ im Gegensatz zum Machtausbau bei den Benediktinern. Zweitens seien die Zisterzienser „ganz und gar auf Neugründungen eingestellt.“
I.2. Die Beziehungen zur weltlichen Macht
Von entscheidender Bedeutung war das Verhältnis des Klosters zu den Edelherren von Homburg und den Grafen von Everstein, denn deren territoriale Interessensphären verliefen mitten durch den Klosterbezirk. Zwischen beiden Häusern bestanden Rivalitäten, die sich auf Reichsebene widerspiegelten: Die Homburger waren den Sachsen zugeneigt, die Eversteiner den Staufern. Als Siegfried 1144 kinderlos gestorben war, machte Heinrich der Löwe seine Erbschaftsansprüche gegen seine Northeimer Verwandten geltend, so daß die Burg und 200 Hufen an die Welfen fielen. Diese verlehnten alles an die Edelherren von Homburg, die schon unter Siegfried die Homburg verwaltet hatten. Die Homburger vermehrten den Besitz des Klosters deutlich: Obwohl durch die Schenkungen Siegfrieds die Gründung ermöglicht wurde, brachte Berthold, der Ahnherr des Geschlechts der Edelherren von Homburg, die Mittel für den Bau der Kirche und der sonstigen Gebäude auf.9 Neben anderen Wohltätigkeiten übergaben zwischen 1178 und 1180 Bodo von Homburg und sein Bruder Berthold den Langenhagen (Landstück bei der Homburg) dem Kloster.
Ebenfalls positive Beziehungen pflegte das Kloster zu den Eversteinern. In der Klosterkirche befindet sich das Grabmal eines Ehepaares des Eversteinischen Hauses. Heutger10 kommt zu dem Schluß, das Kloster habe seine Grenzlage zwischen Homburgern und Eversteinern zur Bewahrung seiner Selbständigkeit genutzt.
Nach einer Urkunde vom 25.Juli 1156 kaufte Heinrich der Löwe für 75 Mark Silber das Gut Hittfeld und überließ dem Kloster für 35 Mark sieben Hufen in Erzhausen11. 1166 schenkte Heinrich der Löwe einen Hof in Arholzen dem Kloster12. Auch sein Sohn, Kaiser Otto IV., war dem Kloster wohlgesonnen, wie eine Eintragung im Anniversar bezeugt.13
Beziehungen zum Königshofe Lothars III. lassen sich über die Person des Stifters Siegfried herstellen. Dieser hatte zum Königshofe ausgiebige Beziehungen. Er gehörte zum engen Kreis des sächsischen Kaisers, da er mit ihm blutsverwandt war. Anhand seiner Zeugenunterschriften kann man erkennen, daß Siegfried in den Jahren 1126, 1129, 1130, 1131, 1134, 1136 und 1137 am Kaiserhof war.14 Unter Konrad III. verschlechterten sich seine Beziehungen zum Herrscher, die sich erst ab 1142 verbesserten.15
I.3. Die Beziehungen zum Papst
Das Kloster Amelungsborn hatte enge Beziehungen zum Hl. Stuhl. Diese Tatsache ist zu erklären durch die Mitgliedschaft im Zisterzienserorden, der beim Papst einen ständigen Beauftragten hatte. Dieser besorgte auch die päpstlichen Gratialbriefe. Die Beziehungen zu Rom standen im 12. Jh. im Zeichen der päpstlichen Privilegierung.16
I.4. Die Beziehungen zu den Bischöfen
Die Beziehungen des Klosters zu den Bischöfen wurden dadurch begründet, daß Bischof Bernhard I. von Hildesheim das Kloster im Jahre 1135 weihte. Fast alle Hildesheimer Bischöfe beschenkten das Kloster im 1. Jh. Seiner Gründung. Wie Heutger ausführt17, nahm Bischof Bernhard I. von Hildesheim am 12. Mai 1141 das Kloster in seinen Schutz und überwies ihm den Zehnten in Amelungsborn. Bischof Bruno von Hildesheim übereignete ihm 1158 den Zehnten in Lutthelensolthusen und nahm am 9.4.1158 das Ordenshaus in seinen Schutz im Zusammenhang mit einer Landschenkung in Erzhausen. 1169 übereignete Bischof Hermann dem Kloster den Zehnten an den Salzwerken bei Hemmdorf. Bischof Adelog schenkte 1184 dem Kloster den Zehnten und sechs Hufen Land in Holthusen. 1198 nahm auch Bischof Konrad das Kloster in seinen Schutz. Auch zu anderen Bischöfen hatte das Kloster Beziehungen: So schenkte Bischof Hartbert von Minden dem Kloster 1206 zwei Hufen in Wallenstedt.
I.5. Der Besitz des Klosters Amelungsborn
Bei den Ländereien auf dem Odfeld, dem „predium“ Amelungsborn, handelt es sich allenfalls um ein sehr kleines Dorf. Ein so geringfügiger Grundbesitz ermöglichte nicht die Aufrechterhaltung der klösterlichen Agrarwirtschaft. Deshalb stattete Siegfried seine Stiftung zusätzlich mit der Übertragung der nahe bei Amelungsborn gelegenen Erbgüter Helichnisse, Quathagen, Cogrove und Buttesdorpe, der curtis Brochove und Hittfeld (bei Harburg) aus. Bei Helichnisse handelt es sich um die im Allodienverzeichnis Siegfrieds aufgeführte curtis Halgenesse, die jedoch ebenso wie Quathagen, ein von niederländischen Einwanderern angelegter Einzelhof oder kleiner Ort, nicht lange existiert haben. Nicht viel länger haben Cogrove und Buttesdorpe bestanden. Diese lagen wohl zu weit entfernt, um vom Kloster nutzbringend bewirtschaftet werden zu können. Nach Norden wurde durch diese Ländereien die Klosterfeldmark ausgeweitet, im Süden stand das Hooptal als natürliches Hindernis entgegen, es blieben im Osten die Feldmark des Dorfes Brochove, im Westen die villa Bune bei Homburg. Schon bald nach der Gründung des Klosters kam es mit dem Stifter zu einem Grundstücksaustausch: Das Kloster Amelungsborn tauschte die curtis Brochove gegen die villa bune ein.18
Die wirtschaftlichen Aktivitäten waren zunächst auf die nähere Umgebung des Standorts beschränkt. Das Kloster konnte etwa 1000 Schafe, 100 Stück Rindvieh und 200 Schweine halten. Zur Eigenwirtschaft der Mönche gehörte auch eine Wassermühle in unmittelbarer Nähe des Klosters. Die Mittel zum Erwerb waren oft Versprechungen zum Seelenheil, die Bauernhöfe wurden aufgekauft, vertauscht, geschenkt oder verpfändet. Der Rest der freien Bauern begab sich gewöhnlich in den Schutz des Klosters; so wuchs der Klosterbesitz von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Etwa 20 Jahre nach Gründung des Klosters begann Amelungsborn, seinen Besitz nach ökonomischen Gesichtspunkten zu gliedern. Durch Tausch und Verkauf wurden Streubesitz und abgelegene Güter wie Hittfeld abgestoßen. Interessante Standorte wie Greene/Erzhausen und Allersheim wurden zu Grangien ausgebaut. Ganze Dörfer in Klosternähe wurden in Besitz gebracht. Die wichtigsten Klosterdörfer sind Holenberg, Lobach und Negenborn.19
I.6. Wirtschaft und Verwaltung
Die Zisterzienser führten eine Art Domänenwirtschaft ein. Sie produzierten selbst und für die Eigenversorgung, so daß sie wirtschaftlich autark waren. Überschüsse wurden zum Erwerb neuer Produktionsmittel genutzt. Die Einnahmen liefen in einer zentralen Verwaltung zusammen. Außenstellen der klösterlichen Wirtschaft waren die Wirtschaftshöfe (Grangien). Von den Grangien aus wurde das umliegende Klosterland bewirtschafte. Auf den Grangien waren Konversen beschäftigt. Diese „Halbmönche“ trugen eine besondere Tracht und waren zu Gehorsam und Ehelosigkeit verpflichtet, aber ohne geistliches Gelübde. Um die Grangien herum wurde möglichst viel Land erworben. Die Grangien unterstanden einem Rector oder Hofmeister, der die Laienbrüder anleitete. Die Zehntfreiheit förderte die wirtschaftliche Tätigkeit der Mönche.
I.7. Die Ausbreitung des Orden in den Osten
Die Verschiebung der Reichsgrenze unter Heinrich dem Löwen und die positive wirtschaftliche Entwicklung des Klosters ermöglichten die Teilnahme an der Ausbreitung des Ordens in den Osten. Bereits 1138 stellte Amelungsborn den Gründungsabt für Kloster Mariental bei Helmstedt. 1145 entsandte Amelungsborn einen vollständigen Konvent zur Gründung des Klosters Riddagshausen bei Braunschweig. Um 1170 zog der Amelungsborner Mönch Berno, der Bischof von Schwerin und Apostel der Wenden war, zusammen mit Amelungsborner Mönchen aus und gründete das Kloster Doberan in Mecklenburg. Das Kloster Amelungsborn unterhielt gute Beziehungen zu den Mecklenburger Fürsten. So schenkte Fürst Borwin I. um 1219 dem Kloster den Hof Sartow20. Am 10. März 1233 schenkte Fürst Nicolaus von Werle dem Kloster den Hof Drause, der einen See und 60 Hufen Land umfaßte.21
II. Der Urkundenbestand des Klosters Amelungsborn
II.1. Allgemeiner Überblick über den Urkundenbestand
Der Urkundenbestand für das Kloster Amelungsborn ist während des Dreißigjährigen Krieges stark dezimiert worden, so daß heute nur noch 91 Originalurkunden vorhanden sind. Diese befinden sich im Staatsarchiv Wolfenbüttel. Drei Originalurkunden stammen aus dem 12. Jh., 12 aus dem 13. Jh., 20 aus dem 14. Jh., 15 aus dem 15. Jh. und 25 Originalurkunden aus dem 16. Jh.. Die Originalurkunden sind meist wirtschaftlicher Natur.22
Neben den Originalurkunden gibt es noch etwa 700 Urkunden, die in kopialer Überlieferung zugänglich sind. Diese Urkunden sind in Kopialbüchern erhalten, die in Amelungsborn angelegt wurden und sich heute ebenfalls im Staatsarchiv zu Wolfenbüttel befinden. Diese Bücher wurden angelegt, um die Originale zu schonen und um einen Ersatz vorweisen zu können, falls die Originalurkunden abhanden kommen sollten. Es sind insgesamt vier Kopialbücher vorhanden. Das älteste Kopialbuch stammt aus dem 13. und 14. Jh., besteht aus 41 Pergamentblättern und wurde von zwei verschiedenen Personen geschrieben. Das zweite Kopialbuch umfaßt 584 Urkundenabschriften und wurde auf Veranlassung des Abtes Sander von Horn (1438-1463) von mehreren Mönchen geschrieben. Zuerst werden die Urkunden, die Amelungsborn selbst betreffen, aufgeführt, dann folgt eine Liste der Orte, in denen das Kloster Ländereien besaß. Das dritte Kopialbuch wurde zwischen dem 16. Und 18. Jh. geschrieben. Das vierte Kopialbuch aus dem 19. Jh. ist eine Abschrift aus Teilen des dritten Kopialbuches.23
II.2. Die Privilegierung des Klosters im 12.Jh.
Königliche Privilegien sind nicht vorhanden. Aus dem Zeitraum von der Gründung bis um das Jahr 1200 sind folgende drei päpstliche Privilegien vorzufinden:
1. Privileg des Papstes Honorius II. (Pium desiderium), datiert auf den 5.Dezember 1129 Lateran, (Echtheit umstritten)24:
Papst Honorius II. nimmt das nach der Regel des Hl. Benedikt und nach der reformatio von Cîteaux gegründete Kloster Amelungsborn in den Schutz des Hl. Petrus und seiner selbst. Die gegenwärtigen und zukünftigen Besitzungen des Klosters werden im Ganzen bestätigt. Die Rechte des Diözesanbischofs sollen unangetastet bleiben. Die freie Abtswahl wird geschützt. Der Abt empfängt das Recht, Mitra, Dalmatica, Sandalen und den Ring zu tragen.
2. Privileg des Papstes Coelestin II, verliehen am 27. Dezember 114325: Papst Coelestin II. verleiht dem Kloster Amelungsborn den Schutz des Hl. Petrus und seiner selbst.
3. Privileg des Papstes Coelestin III. (Religiosam vitam eligentibus) vom 27. Juli 1197, Lateran26:
Papst Coelestin III. nimmt Abt Hoiko und die Brüder des Klosters Amelungsborn in den Schutz des Hl. Petrus, bestätigt ihnen die Zisterzienserregel und ihre Besitzungen. Er erlaubt die freie Aufnahme im Kloster, verbietet unerlaubtes Verlassen des Ordenshauses, sowie Geldgeschäfte einzelner Konventualen und die Übernahme von Bürgschaften durch Mönche. Das Privileg gestattet aber den Eid der Brüder im Interesse des Klosters.
III. Die Verzeichnisse des Grundbesitzes
Die Bedeutung der wirtschaftlichen Seite des27 Klosterlebens hatte speziell bei den Zisterziensern ein Anwachsen des Urkundenbestandes zur Folge. Es war eine Vielzahl an Urkunden notwendig, um alle Erwerbungen, Befreiungen und Verfügungsrechte für die einzelnen Besitztümer rechtlich abzusichern.
Die Kopialbücher sind damit auch Verzeichnisse des Grundbesitzes: Sie führen in vielen Fällen die Orte auf, in denen das Kloster Ländereien besaß. Als Verzeichnisse des Grundbesitzes kann man auch die päpstlichen Privilegien betrachten, da sie eine Auflistung derjenigen Ländereien beinhalten, deren Besitz dem Kloster Amelungsborn bestätigt wird.
IV. Zeitgenössische literarische Quellen
Die Bereitschaft zu literarischer Tätigkeit war bei den Zisterziensern weniger ausgeprägt als bei anderen Orden. Bücher abzuschreiben, war den Zisterziensern nur gegen besondere Erlaubnis gestattet. „Der Cisterciensermönch war eine Zusammensetzung aus Bauer, Ökonom und Geistlichem.“28 Dennoch entstand im Kloster Amelungsborn Literatur. So wurde im Amelungsborner Scriptorium um 1290 ein Anniversarienbuch29 angelegt. Dies enthielt die Namen der Mönche und Wohltäter des Klosters mit Angabe des Todestages (Monat, Tag). Es folgt im Anniversar ein Memoirenregister mit den Namen der Personen, für die Seelenmessen gelesen werden sollten. Angefügt sind ein Verzeichnis der 1409 neugeweihten Altäre mit ihren Reliquien und ein Verzeichnis der Klosterbibliothek aus dem Jahre 1412.
Von besonderem künstlerischen Wert ist die fünfbändige Amelungsborner Bibel30, die um 1280/90 entstanden ist. Dieses zweispaltig geschriebene Werk war vor allem zur Tischlesung bestimmt und ist bezeichnend für das strenge Kunstverständnis des Ordens.
Im Anniversar wurden anfangs nur Monats- und Tageszahlen eingetragen. Im späten Mittelalter wurden auch Jahreszahlen hinzugefügt. Daran läßt sich ein Interesse der Mönche an der Geschichte des Klosters erkennen.
Nach Leuckfeld31 soll ein gewisser Abt Engelhard (etwa 1354-1371) sich mit der klösterlichen Geschichte befaßt haben. Von seinem Werk ist jedoch nichts erhalten. Es ist aber möglich, daß die Abtsliste, die dem zweiten Kopialbuch vorangestellt ist, ein Ergebnis seiner Forschungstätigkeit ist.
Nach Leuckfeld32 soll der Benediktinermönch Ulrich Mantwin um 1404 eine Chronik des Klosters Amelungsborn verfaßt haben, die jedoch nicht erhalten ist.
Neben der Amelungsborner Bibel ist eine wahrscheinlich aus Amelungsborn stammende Weltchronik in der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel erhalten. Sie wurde in niederdeutscher Sprache von Dietrich Engelhus abgefaßt, der 1362 in Einbeck geboren wurde.33 Die Chronik ist im allgemeinen streng annalistisch aufgebaut. Als Kriterium für die Zeiteinteilungen dienen die Pontifikate der Päpste, manchmal auch die Regierungszeit der einzelnen deutschen Könige/Kaiser. Das Werk reicht bis 1433, wobei die Zeitgeschichte nur knapp behandelt wird.34
Dietrich Engelhus kam aus wohlhabender Familie, studierte seit 1381 in Prag und wechselte 1393 nach Erfurt. Dort examinierte er 1397. Wahrscheinlich war er seit 1406/07 als Rektor einer Göttinger Lateinschule tätig. Ab 1422 war er als Schulleiter auch in anderen Städten tätig. Er starb am 5. Mai 1434.35
Verschollen sind die Aufzeichnungen des Abtes Anton I. Georgii (1598-1625) über die Gründung des Klosters.36
V. Anhang
V.1. Hilfsmittel
Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte. Bibliographie der Quellen und der Literatur zur deutschen Geschichte. Bd. 1ff., Stuttgart 1965ff.
Germania Benedictina, hg. v. d. Benedictiner-Akademie München, Bd.1ff., St. Ottilien 1975ff.
Haberkern, E. u. Wallach, F. J., Hilfswörterbuch für Historiker. Mittelalter und Neuzeit, UTB 119/120, 2 Bde., München 1995.
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG), hg. v. Erler, A. u. Kaufmann, E., 5 Bde., Berlin 1971-98.
Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur, hg. v. Zeller, O. u. W., Bd. 1ff., Osnabrück 1965ff.
Jaffé, Ph., Regesta Pontificium Romanorum, 2 Bde., Leipzig 1885.
Jahresberichte für deutsche Geschichte, NF Bd. 1ff., Berlin(Ost) 1952ff., ND. Nendeln/Liecht. 1976ff.
Potthast, A., Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichte des
Europäischen Mittelalters, 2 Bde., 2. verbesserte Aufl., Berlin 1986 ND Graz 1954. Revue d`histoire ecclésiastique. Bibliographie, Bd.1ff., Löwen 1901ff. Schuler, P.-J., Grundbibliographie Mittelalterliche Geschichte (Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen, Bd.1), Stuttgart 1990. Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13.
Jahrhunderts, 1 Bd. (7. v. Dümmler, E., umgearb. Aufl.), Stuttgart/Berlin 1904, 2 Bde., (6. umgearb. Aufl.), Berlin 1894.
V.2. Quellen
Dürre, H., Anniversaria fratrum et benefactorum ecclesiae Amelungsbornensis, in: Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, Jahrg. 1877, S.1-106.
MGH DD H. d. L.
MGH DD L III.
Papsturkunde von 1197, Kopie aus dem Staatsarchiv Wolfenbüttel.
Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe, 1 bearb. v. K. Janicke, Leipzig 1896; 2-6 bearb. v. H. Hoogeweg, Hannover 1901-1911.
V.3. Literatur
Asch, Amelungsborn, in: U. Faust ( Bearb.): Die Männer- und Frauenklöster der Zisterzienser in Niedersachsen, München 1994, S.29-62 (= Germania Benedictina, Bd.XII).
Aufgebauer, P., Zeitgeschichtliche Beobachtungen bei Dietrich Engelhus, in: Engelhus. Beiträge zu Leben und Werk, hg. v. Volker Honemann (Mitteldeutsche Forschungen, Bd.104), Köln; Weimar; Wien: Böhlau 1991, S. 109-126.
Caspers, H., Amelungsborn: Die baugeschichtl. Entwicklung d. zisterziens. Klosterkirche unter bes. Berücks d. rom. Chores, Diss. (masch.), Hannover 1985.
Drömann, H.-C., Amelungsborn - Ein evangelisches Kloster in der Gegenwart, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte 88 (1990), S. 95-100.
Eggeling, F., Chronik von Stadtoldendorf, der Homburg und Kloster Amelungsborn, Stadtoldendorf 1921.
Göhmann, H. W., Die Negenborner Kapelle oder eine Wallfahrt beim Kloster Amelungsborn, in: Heimat- und Geschichtsverein Holzminden 1992.
Göhmann, H. W., Kloster Amelungsborn 1135-1985. 850 Jahre St. Marien auf dem Odfeld, Holzminden 1982.
Göhmann, H. W., Kloster Amelungsborn: Spurensuche in Texten und Abbildungen des 17- 19.Jahrhunderts, in: Heimat- und Geschichtsverein Holzminden 1991.
Heutger, N. C., Das Kloster Amelungsborn im Spiegel der zisterziensischen Ordensgeschichte, Hildesheim 1968.
Leuckfeld, J. L., Antiquitates Michaelsteinenses et Amelunxsbornenses, Wolfenbüttel 1710.
Lisch, G. C. F., Geschichte der Besitzungen auswärtiger Klöster in Mecklenburg ...Amelungsborn, in: Jahrbuch des Vereins für mecklenburgische Geschichte 13 (1848), S.116-142.
Mahrenholz, C., Das Kloster Amelungsborn im Spiegel der niedersächsischen Klostergeschichte, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte 62 (1964), S. 5-28.
Mahrenholz, C., Die Amelungsborner Bibel von 1280/1290, Berlin 1963.
Mahrenholz, C., Studien zur Amelungsborner Abtsliste I, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte, 61 (1963), S.13-31.
Röckener, K., Kloster Amelungsborn, 5. Aufl., (Große Baudenkmäler; 338), München 1998.
Rustenbach, R., Geschichte des Klosters Amelungsborn, Sonderabdruck aus dem Braunschweigischen Jahrbuch 1909.
Steenweg, H., Zur Biographie des Dietrich Engelhus, in: Dietrich Engelhus. Beiträge zu
Leben und Werk, hg. v. Volker Honemann (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 104), Köln; Weimar; Wien: Böhlau 1991, S. 11-29.
[...]
1 C. Mahrenholz, Das Kloster Amelungsborn im Spiegel der niedersächsischen Kirchengeschichte, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte 62 (1964), S. 5f.
2 Heutger, N.C., Das Kloster Amelungsborn im Spiegel der zisterziensischen Ordensgeschichte, Hildesheim 1968, S.13.
3 nach Heutger (wie Anm. 2, S. 12) zeugt davon eine Urkunde des Abtes Vicelinus von Northeim aus dem Jahre 1144, abgedruckt: Codex Tradit. Corbeiensium, ed. J.F. Falke Lipsiae 1752, S.138.
4 Vgl. Anm.3.
5 Göhmann, H.W., Kloster Amelungsborn 1135-1985. 850 Jahre St. Marien auf dem Odfeld, Holzminden 1982, S. 21.
6 Heutger, S.17.
7 Genaueres zur Abtfolge siehe Mahrenholz, C., Studien zur Amelungsborner Abtliste I, in: Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte 61 (1963), S.13-31.
8 Heutger, S.20.
9 Göhmann (wie Anm.5), S. 22.
10 Heutger, S. 71.
11 MGH D H. d. L., Nr. 34, S. 48.
12 MGH D H. d. L., Nr. 73, S. 106.
13 Heutger, S. 72.
14 MGH DD L III. Nr. 10, 15, 21, 24, 31, 33, 59, 85, 92, 114, S. 12, 18, 30, 35, 47, 51, 92, 133, 143, 182.
15 Heutger, S. 16.
16 Vgl. Aufg. 2.
17 Heutger, S. 69.
18 Rustenbach, R., Geschichte des Klosters Amelungsborn, Sonderabdruck aus dem Braunschweigischen Jahrbuch 1909, S.21ff.
19 Eggeling, F., Chronik von Stadtoldendorf, der Homburg und Kloster Amelungsborn, Stadtoldendorf 1921, S.238f.
20 Lisch, G. C. F., Geschichte der Besitzungen auswärtiger Klöster in Mecklenburg ... Amelungsborn, in: Jahrbuch des Vereins für mecklenburgische Geschichte 13 (1848) S.122.
21 Ebenda, S.135.
22 Heutger, S. 2.
23 Eingehende Charakterisierung der archivalischen Quellen bei Heutger, S.2-5.
24 Jaffé, Ph., Regesta Pontificium Romanorum, Bd.I, Leipzig 1885, Nr.7378.
25 Nach Heutger, S.65: St. A. Wolfenb. VII Hs. B. 113 Nr.3a, nicht bei Jaffé.
26 Jaffé (wie Anm.24), Bd.II, Nr. 17572.
27 Der Bestand der Urkunden und Güterverzeichnisse ist weitgehend ungedruckt. Genaue Fundangaben der einschlägigen Archivalien finden sich in folgendem Artikel: Asch, Amelungsborn, in: U. Faust ( Bearb.): Die Männer- und Frauenklöster der Zisterzienser in Niedersachsen, München 1994, S.29-62 (= Germania Benedictina, Bd.XII).
28 Lisch (wie Anm.20), S.117.
29 Ediert: Dürre, H., Anniversaria fratrum et benefactorum ecclesiae Amelungsbornensis, in: Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen (1877), S.1-106.
30 Mahrenholz, C., Die Amelungsborner Bibel von 1280/1290, Berlin 1963.
31 Leuckfeld, J.G., Antiquitates Michaelsteinenses et Amelunxsbornenses, Wolfenbüttel 1710, S.37.
32 Ebenda, S. 3, 39, 40.
33 Asch (wie Anm. 27), S.53.
34 Aufgebauer, P., Zeitgeschichtliche Beobachtungen bei Dietrich Engelhus, in: Dietrich Engelhus. Beiträge zu Leben und Werk, hg. v. Volker Honemann (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 104), Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 1991, S. 110-112.
35 Steenweg, H., Zur Biographie des Dietrich Engelhus, in: Dietrich Engelhus. Beiträge zu Leben und Werk, hg. v. Volker Honemann (Mitteldeutsche Forschungen, Bd. 104), Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 1991, S. 12-19.
Häufig gestellte Fragen zum Inhalt
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Vorschau eines Textes über die Geschichte des Klosters Amelungsborn, seiner Urkunden, seines Grundbesitzes und zeitgenössischer literarischer Quellen. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselwörter und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
Welche Hauptthemen werden in der Geschichte des Klosters Amelungsborn behandelt?
Die Geschichte behandelt die Gründung des Klosters, seine Beziehungen zur weltlichen Macht (Edelherren von Homburg, Grafen von Everstein, Heinrich der Löwe), zum Papst und zu den Bischöfen (insbesondere Bischöfe von Hildesheim und Minden). Außerdem werden der Besitz des Klosters, Wirtschaft und Verwaltung sowie die Ausbreitung des Ordens in den Osten thematisiert.
Wann wurde das Kloster Amelungsborn gegründet und von wem?
Das Kloster wurde um 1129 von Siegfried IV. von Boyneburg und Homburg gegründet. Die Stiftung wurde 1144 durch die Vicelinusurkunde sichergestellt.
Welche Rolle spielten die Zisterzienser bei der Gründung und Entwicklung des Klosters?
Siegfried berief die Zisterzienser aufgrund ihres asketischen Drangs zur inneren Kolonisation und ihrer Ausrichtung auf Neugründungen. Amelungsborn war eine Gründungsgruppe aus dem Kloster Altenkamp.
Wie waren die Beziehungen des Klosters zu den Edelherren von Homburg und den Grafen von Everstein?
Das Kloster pflegte positive Beziehungen zu beiden Häusern und nutzte seine Grenzlage zwischen ihnen, um seine Selbstständigkeit zu bewahren.
Welche Bedeutung hatte Heinrich der Löwe für das Kloster?
Heinrich der Löwe kaufte und überließ dem Kloster Land und schenkte dem Kloster einen Hof. Auch sein Sohn, Kaiser Otto IV., war dem Kloster wohlgesonnen.
Wie war der Urkundenbestand des Klosters beschaffen?
Der Urkundenbestand ist durch den Dreißigjährigen Krieg stark dezimiert worden. Es gibt 91 Originalurkunden im Staatsarchiv Wolfenbüttel sowie etwa 700 Urkunden in kopialer Überlieferung (Kopialbücher).
Welche päpstlichen Privilegien erhielt das Kloster im 12. Jahrhundert?
Das Kloster erhielt Privilegien von Papst Honorius II. (1129), Papst Coelestin II. (1143) und Papst Coelestin III. (1197), die den Schutz des Klosters, die Bestätigung seiner Besitzungen und die Zisterzienserregel betrafen.
Wie verwaltete das Kloster seinen Grundbesitz?
Die Zisterzienser führten eine Art Domänenwirtschaft ein und produzierten selbst für die Eigenversorgung. Außenstellen der klösterlichen Wirtschaft waren die Wirtschaftshöfe (Grangien), auf denen Konversen beschäftigt waren.
Welche Rolle spielte das Kloster bei der Ausbreitung des Ordens in den Osten?
Amelungsborn stellte den Gründungsabt für Kloster Mariental (1138) und entsandte einen Konvent zur Gründung des Klosters Riddagshausen (1145). Ein Mönch aus Amelungsborn gründete das Kloster Doberan (um 1170).
Welche zeitgenössischen literarischen Quellen gibt es zum Kloster?
Es gibt ein Anniversarienbuch (um 1290), die fünfbändige Amelungsborner Bibel (um 1280/90) und eine wahrscheinlich aus Amelungsborn stammende Weltchronik von Dietrich Engelhus. Eine Chronik von Ulrich Mantwin ist verschollen.
Welche Bereiche deckt das Inhaltsverzeichnis ab?
Das Inhaltsverzeichnis bietet einen Überblick über die Geschichte des Klosters Amelungsborn, den Urkundenbestand des Klosters Amelungsborn, die Verzeichnisse des Grundbesitzes, zeitgenössische literarische Quellen und einen Anhang mit Hilfsmitteln, Quellen und Literatur.
- Quote paper
- Andreas Gohmann (Author), 1999, Das Kloster Amelungsborn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96238