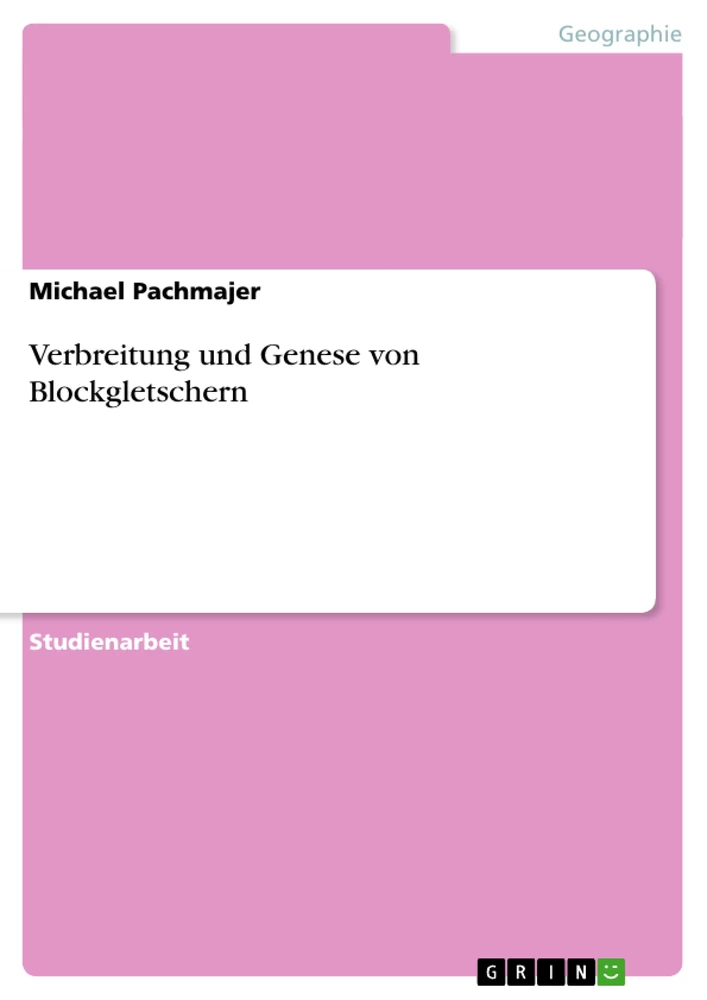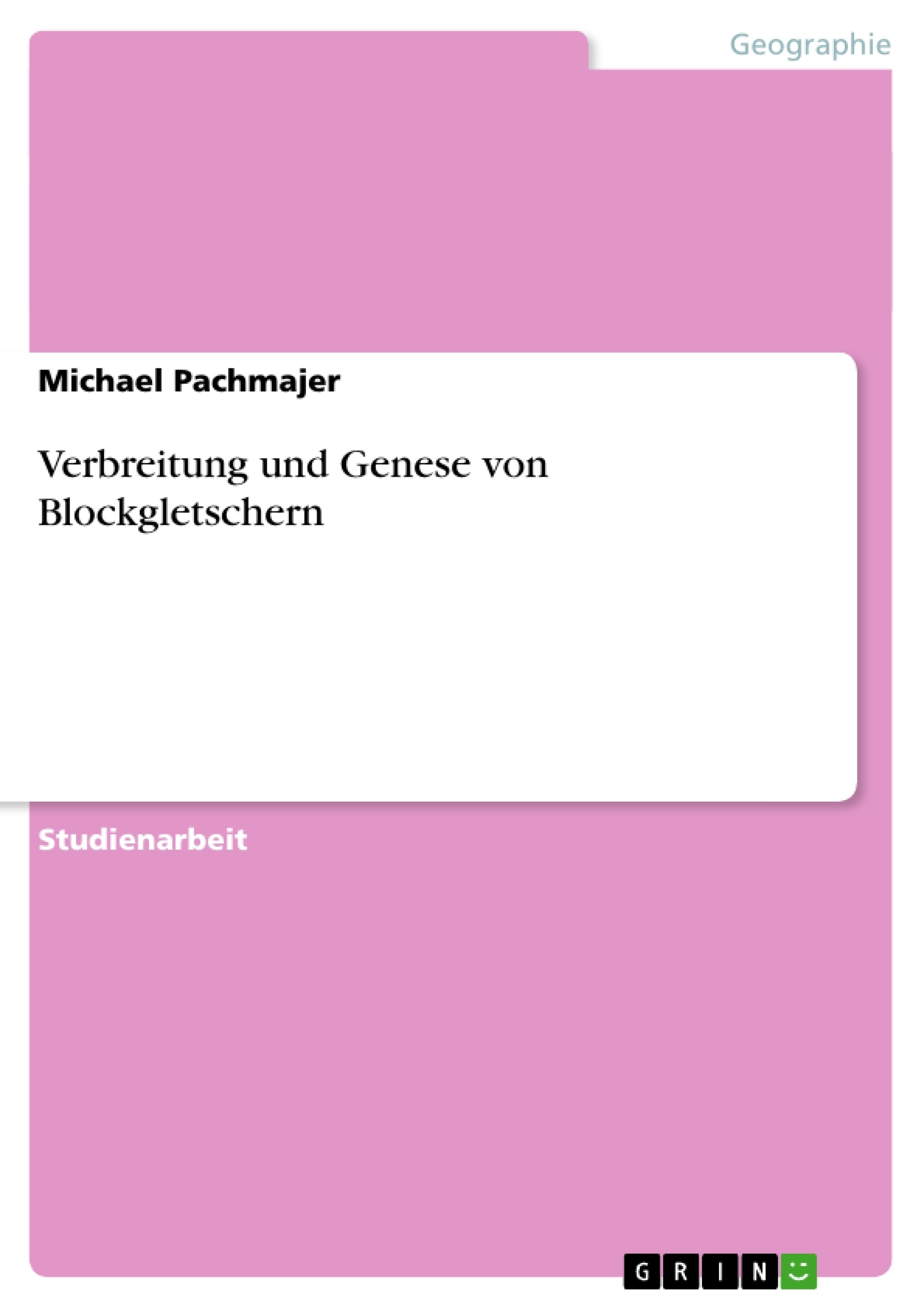Inhaltsverzeichnis
1.0 Einleitung
2.0 Verbreitung von Blockgletschern
2.1 Verbreitung von Blockgletschern in den Alpen
2.2 Verbreitung von Blockgletschern in den Pyrenäen
2.3 Verbreitung von Blockgletschern in Nordamerika
3.0 Genese von Blockgletscher
3.1 Formenhäufigkeit und -dichte
3.2 Charakteristiken von Blockgletschern
3.3 Schuttproduktion und Schutttransport
3.4 Blockgletscher und Permafrostverbreitung
3.5 Hypsometrische Stellung der Blockgletscher
4.0 Zusammenfassung
5.0 Schriftenverzeichnis
1.0 Einleitung
Blockgletscher können sich sowohl in enger räumlicher Beziehung zu Gletschern, als auch völlig entfernt davon entwickeln. Innerhalb der Grenzen ehemaliger Vergletscherungen sind zahlreiche Blockgletscher unabhängig von den vorhandenen Gletschern, entstanden. Neben der Genese und den charakteristischen Zügen der Blockgletscher, wird die Verbreitung jener Formen eine wichtige Rolle in diesem Referat einnehmen. Darüber hinaus werden Fragen zur Formenhäufigkeit und - dichte, Schuttproduktion und -transport sowie zum Zusammenhang von Blockgletschern und Permafrostverbreitung nachgegangen.
2.0 Verbreitung von Blockgletschern
Zunächst wird auf die Verbreitung der Blockgletscher eingegangen. Hierbei werden die Räume Alpen, Pyrenäen und Nordamerika einer genaueren Beobachtung unterstellt. Aktive und inaktive Blockgletscher werden in der Literatur auch für die Gebirge Skandinaviens, die Tatra in den Nord-Karpaten, die südspanische Sierra Nevada sowie für das Gran Sasso-Gebiet im Zentral-Apennin dargestellt und beschrieben. Die Hochozeanischen, winterschneereichen Abschnitte europäischer Gebirge sind frei von aktiven Blockgletschern. Des weiteren wird von Formen im kontinentalen, winterkalten südnorwegischen Hochland, oberhalb von 1450-1500 m, berichtet, wo sie eindeutig der subnivalen Fels-Schutt-Stufe zugeordnet werden können. Die Jahresmitteltemperatur liegt dort unter dem Gefrierpunkt.
2.1 Verbreitung von Blockgletschern in den Alpen
Bei genauerer Betrachtung der Verbreitung von Blockgletschern in den Alpen wird deutlich, daß eine Häufung dieser Formen in den Zentralalpen und im Internbogen der Westalpen vorkommt. Dagegen fehlen Blockgletscher in den Nord- und Südalpen sowie im Externbogen der Westalpen fast vollständig. Die Hinzunahme der Geologie läßt gewisse Zusammenhänge zwischen dem Auftreten der Blockgletscher und dem Faktor Gestein erkennen. In den Zonen, wo keinerlei Blockgletscher auftreten sind Karbonatgesteine zu finden.
Neben dem Faktor Gestein oder Relief spielt der Faktor Klima eine weitaus größere Rolle bei der Genese und der darausfolgenden Verbreitung von Blockgletschern. Die meisten aktiven Blockgletscher der Alpen liegen in der Umgebung rezenter Vergletscherungsgebiete mit zentraler bzw. abgeschirmter Lage (Höllermann, 1983a). Sie treten bevorzugt in jenen Gletschergebieten auf, die in der Nähe inneralpiner Trockengebiete liegen. Während Gebiete mit höherem Schneefall und starker Bewölkung arm an Blockgletschern bleiben oder sogar frei von diesen aktiven Formen sind. Die Blockgletscher konzentrieren sich zu rund 94 % in Gebieten mit einem sommerlichen Niederschlagsmaximum, wohingegen nur 6 % in Gebieten mit einem Herbstmaximum an Niederschlägen auftreten. Das deutet daraufhin, daß Blockgletscher Räume mit relativ geringem Winterschneeanteil bevorzugen. Die begünstigende kontinentale Lage der Blockgletscher in den Ostalpen läßt sich auch an der engen Beziehung zum sog. hygrischen Kontinentalitätsgrad nach Grams (1931/32) ablesen. Die hygrische Kontinentalität beschreibt eine Winkelfunktion ctg x = N/h (wobei N = die Jahressumme des Niederschlages und h = Meereshöhe ist). Danach liegen 92 % der Formen im Gebiet mit einer hygrischen Kontinentalität über 50° und 62 % im kontinentalen Kernbereich mit 60- 80°. Zusammenfassend kann man sagen, daß Blockgletscher die relativ kontinentalen, trockenen, strahlungsreichen und am stärksten abgeschirmten Binnenräume bevorzugen, die zugleich Bereiche mit überdurchschnittlicher Massenerhebung sind. In den ozeanischen, schnee- und wolkenreichen Alpengruppen nimmt die Formendichte dagegen sehr schnell ab.
Die Blockgletscher in den Alpen können in jeder Exposition auftreten, wobei sie größere Verbreitung in schattenseitigen Auslagen, also im NW, N und NE verzeichnen.
Die tiefsten inaktiven bzw. fossilen Blockgletscher reichen in die Waldstufe hinab. Der hypsometrische Verbreitungsschwerpunkt der aktiven Blockgletscher liegt in der subnivalen Schutt-Fels-Stufe. Allerdings können größere Zungen auch bis in die alpine Mattenstufe vordringen. Die Vertikalspanne zwischen dem Unterrand und dem höchsten Punkt der Umrahmung ist bei aktiven Blockgletschern mit 500 m im Mittel deutlich enger als bei den Gletschern mit etwa 650 m. Die höchsten Erhebungen der Einzugsgebiete ragen stellenweise über die Schneegrenze hinaus. Vergleiche und Zusammenhänge zwischen dem Verlauf der Untergrenze aktiver Blockgletscher mit der Schneegrenze bzw. Gleichgewichtslinie der Gletscher werden im Kapitel 3.4 erläutert.
2.2 Verbreitung von Blockgletschern in den Pyrenäen
Nach Höllermann (1983a) nimmt die Häufigkeit der Blockgletscher von den Zentralpyrenäen zu den kontinentaleren und trockeneren Ostpyrenäen (zwischen Andorra und der Canigou-Gruppe) zu. Auch hier ist, wie bereits bei den Alpen beschrieben, die beträchtliche Abschirmung, die hohe Einstrahlung und die ausgeprägte Massenerhebung charakteristisch für die blockgletscherreichen Kerngebiete der östlichen Pyrenäen. Auch hier wird deutlich, daß petrographisch die Kristallin- und Massengesteine (Granit, Granodiorit, Quarzmonzonit u.a.), im Gegensatz zu den Kalkgebirgsgruppen, bevorzugte Verbreitungsgebiete sind. In den Ostpyrenäen herrschen inaktive und fossile Blockgletscher vor. Diese Formen zeichnen sich durch eine eingesunkene Oberfläche, abgeflachte Stirn- und Randböschung und teilweiser Vegetationsbedeckung aus.
Der vertikale Verbreitungsschwerpunkt der inaktiven Blockgletscher liegt heute in den Ostpyrenäen in der alpinen Matten- und Zwergstrauchstufe
(mittlere Untergrenze um 2300-2350 m). Die durchschnittliche Vertikalspanne beträgt rund 370 m und ist damit geringer als die der Zentralalpengruppe.
2.3 Verbreitung von Blockgletschern in Nordamerika
In den mittleren Breiten zwischen 35° und 60° N bleiben die küstennahen hochozeanischen und winterschneereichen Gebirge des Pazifischen NW frei von aktiven Blockgletschern. Hierzu gehört der pazifiknahe Gürtel, der vom Kanadischen Küstengebirge bis zum NW-Kaliforniens reicht und der in seinen Hochlagen aufgrund seiner günstigen klimatischen Gegebenheiten reich an Gletschern ist. Inaktive Formen oder blockgletscherverdächtige Schuttakkumulationen treten dagegen häufiger auf. Bei hochozeanisch-schneereichem Klima rücken die Wald- und die Schneegrenze eng zusammen, so daß sich die Periglazialstufe fast gar nicht entwickeln kann. Die Blockgletscher haben ihren Verbreitungsschwerpunkt an den leeseitigen schneeärmeren NE- Expositionen der Gebirge mit abgeschwächtem ozeanischen Einfluß und ansteigenden Höhengrenzen. Aktive Blockgletscher sind weiter im N an der leewärtigen Binnenseite des Kanadischen Küstengebirges zusammen mit fossilen Formen anzutreffen.
Die Blockgletschervorkommen häufen sich in der kalifornischen Sierra Nevada am E Rand, weil entsprechend des asymmetrischen Pultschollenbaus der Sierra Nevada dort die höchsten Aufragungen und Steilformen vorkommen. Die leewärtige Sierra-Ostabdachung ist trockener und kontinentaler. Das Material der Blockgletscher wird i.e.L. von Massengesteinen geliefert, seltener von Metamorphiten. Die vertikale Spannweite beträgt rund 500 m und steigt im Längsprofil von N nach S an (im N in der oberen Waldstufe und nahe der Waldgrenze und im S oberhalb der Waldgrenze). Dort wo im mittleren Abschnitt der Hohen Sierra (um 37° 15° - 37° 30° N) das Einzugsgebiet der Blockgletscher am nächsten an die lokale Vergletscherungsgrenze heranreicht, sind aktive Blockgletscher am häufigsten anzutreffen (in Höhen von 3500-3650 m). Im Gebirge der Basin and Range-Provinz (die im Lee der Sierra Nevada gelegenen White Mountains) bevorzugen infolge des Relief- und Windeinflusses die Blockgletscher NE-Expositionen (Höllermann 1983a). Die Vielzahl der Gebirgsgruppen der Rocky Mountains sind reich an Blockgletschern. Die detailliertere Ausführung würde allerdings den Rahmen des Referates sprengen, ebenso die Beschreibung der Blockgletscherformen im NW-Kanadas und in Alaska.
3.0 Genese von Blockgletscher
Barsch (1983) definiert Blockgletscher als gefrorene Schuttmassen bzw. Schutt-Eis-Gemische, die sich aufgrund plastischer Deformation ihres Eisgehaltes der Schwerkraft folgend langsam hang- oder talabwärts bewegen. Diese allgemeine Definition ist eine anerkannte, die in den letzten Jahren von mehreren Autoren übernommen wurde und auf der die folgenden Ausführungen in diesem Referat basieren.
Was die Genese von Blockgletschern betrifft, so bestehen zwei Entwicklungsreihen für Blockgletscher. Die eine beschreibt, daß Blockgletscher aus schuttbedeckten Eisgletschern entstanden sind, also eine glaziale Entstehung aufzuweisen haben (Klaer 1974). Die andere Modellvorstellung geht davon aus, daß es sich bei Blockgletschern um reine periglaziale Phänomene handelt, in denen selbstverständlich zum Teil auch glazialer Schutt (Moränenmaterial) vielleicht sogar mit einzelnen eingelagerten Blöcken von Gletschereis eingearbeitet sein können (Barsch 1969, 1977a). Nach Barsch (1983) haben weder Aufgrabungen noch geoelektrische Messungen die glaziale Entstehungshypothese stützen können. Es gibt sehr wohl Blockgletscher mit recht großen Eisgehalten, die jedoch nicht so einfach aus schuttbedeckten Gletschern herzuleiten sind. Umgekehrt sind gefrorene, eisreiche Schuttkörper (z.B. Schutthalden), die sich nicht bewegen, keine Blockgletscher. Auch andere Autoren beziehen sich in der gängigen Literatur immer wieder auf die Entwicklungsreihe nach Barsch.
3.1 Formenhäufigkeit und -dichte
Bereits im Kapitel 2.0 "Verbreitung der Blockgletscher" ist deutlich geworden, daß Blockgletscher einer räumlichen Differenzierung unterliegen. In den verschiedenen Hochgebirgen, sind deutliche und regelhafte Abstufungen zu erkennen. So wächst die Zahl und die Flächenbedeckung der aktiven Blockgletscher zu winter-schneearmen, kontinental-winterkalten und trockenen Gebirgen an. Dies gilt vornehmlich für Gebirge in den mittleren Breiten und nicht für solche in den arktischkontinentalen Bereichen (Höllermann 1983a).
Wichtige Voraussetzung für die Genese ist die Verfügbarkeit von Schutt, und ein Klima, das die Erhaltung oder Neubildung von Eis in den Schuttkörpern ermöglicht, aber nicht zu einer ausgedehnten Vergletscherung bis in tiefe Lagen herab führt. Dafür sind trockene und kontinentale Gebiete am besten geeignet.
Unter ozeanischen Bedingungen, einem hohen Winterschneeanteil und gut ernährten Gletschern fehlen die aktiven Blockgletscher vollständig oder treten nur in relativ geringen Flächenanteilen auf.
In den Zentralalpen sind Blockgletscherdichten von über 10 Formen pro 100 km² zu finden. Ihr Flächenanteil liegt bei 0,5-1,0 % der Gesamtfläche (Barsch 1977a).
3.2 Charakteristiken von Blockgletschern
Blockgletscher sind einige zehner bis hundert Meter lang, einige zehner bis hundert Meter breit und einige zehner Meter mächtig. Sie kommen infolge der geomorphologischen Entwicklung und der topographischen Verhältnisse im Untergrund in loben- und zungenförmiger Gestalt, sowie in girlandenförmiger oder spaltenförmiger Anordnung vor.
Zungenförmige Blockgletscher setzen in breiter Front am Fuß von Schutthalden an, verengen sich und laufen in schmaler Zunge aus. Lobenförmige Blockgletscher sind breiter als lang, besitzen ein Gefälle zwischen 11-14° und 20-25° und säumen den Fuß der Karwände und lassen das Zentrum des Karbodens frei. Girlandenförmige Blockgletscher bestehen aus einer Aufeinanderreihung mehrerer Loben, breiter Zungen oder Blockgirlanden. Die Länge liegt bei 100-150 m, die Breite im Durchschnitt bei 800 m und das Gefälle hat ein Mittel von 20-25°. Die spaltenförmigen Formen setzen zungenförmig an und fließen zur Stirnpartie hin fächerartig auseinander.
Nach Weise (1983) und Buchenauer (1990) besitzen die Blockgletscheroberflächen ein regelmäßiges Kleinrelief in Form von Längs- oder Querwülsten und -wällen, die konvex gewölbt und in kerbenförmig eingetieften Gräben, Senken und trichterförmigen Toteislöchern gegliedert sind. Diese Formen erinnern an Bewegungen viskoser oder plastischer Massen. Es handelt sich wohl um differenzierte Bewegungsvorgänge infolge räumlicher und zeitlicher Schwankungen des Schutt- und Eishaushaltes.
Blockgletscher sind ein zweischichtiges Phänomen. Sie bestehen aus einer oberen Blockschicht und einer unteren feinmaterialreichen Schicht. Die obere Blockschicht ist i.d.R. nicht mächtiger als 2 bis 4 m. Die großen Blöcke sind ein Ergebnis der isoklastischen Zerlegung des entsprechenden Gesteins. Es sind meist kristalline Gesteine (z.B. Granit). Blockgletscher aus Sedimentgesteinen treten dagegen seltener auf (Barsch 1983).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 Kernbohrung des Blockgletschers Murtèl I am Corvatsch, Oberengadin
(Barsch 1977b)
Die ganze Schicht besitzt in der kalten Jahreszeit eine Temperatur von weniger als 0 °C. Vor allem im Frühjahr lagern sich größere Eismengen im Porenraum direkt über dem Permafrost an (Barsch 1973). Das Permafrostprofil wurde auf dem Blockgletscher Murtèl I am Corvatsch im Oberengadin (Graubünden/Schweiz) am 28.8-1.9.1978 von Barsch aufgenommen. Der Grund dafür war die Annahme, daß aktive Blockgletscher im alpinen Relief gute Indikatoren für Permafrost sein könnten. Diese Annahme wurde bestätigt.
Es wurde eine Kernbohrung durchgeführt, deren Kerndurchmesser 40 mm betrug. Mit dieser Bohrung wurden die obersten 10,4 m des aktiven Blockgletschers und damit die obersten 10 m eines alpinen Permafrostvorkommens erschlossen.
Zusammenfassend ist nach Barsch (1977) folgendes festzustellen: Die Auftautiefe beträgt 2,6 m (Obergrenze des Permafrostes). Die oberen 1,6 m gehören zur Blockschicht (aus Granit). darunter folgt ein Sand-Kies- Stein-Gemisch (Mächtigkeit 1 m). Der erschlossene Permafrost ist eisreich und enthält im Durchschnitt 50-60 % Eis (z.T nur als Porenraumfüllung, z.T. als Eislinse) über den Sand-Kies-Schichten. Es wurde kein Gletschereis erbohrt. Die Korngröße der gröberen Fraktion nimmt nach unten hin von Block über Stein zu Kies ab. Ungefrorene Partien oder Hohlräume wurden unterhalb der Permafrostgrenze nicht erreicht.
Es werden drei Arten von Blockgletschern unterschieden:
- aktive Blockgletscher,
- inaktive Blockgletscher,
- fossile Blockgletscher.
Aktive Blockgletscher
Blockgletscher werden als aktiv bezeichnet, wenn sie sich heute noch jedes Jahr meßbar vorwärts bewegen. Sie sind durch eine 35-42° steile Bewegungsstirn von dem sie umgebenden Gelände abgesetzt. Sie treten an Stellen auf, wo genügend Schutt durch Massenbewegung oder durch Gletscher zusammengetragen wird. Die klimatischen bzw. mikroklimatischen Verhältnisse sollten negative Bodentemperaturen in 2-3 m Tiefe aufweisen. Die Vergletscherung darf nicht so stark sein, daß alle verfügbaren topographischen Positionen von Gletschern eingenommen werden. Aus diesen Voraussetzungen leiten Barsch (1983) und Lieb (1991) u.a. ab, daß aktive Blockgletscher, neben der Basis-Temperatur (unter -3 °C) der winterlichen Schneedecke, in außerpolaren Hochgebirgen Indikatoren für diskontinuierlichen Permafrost sind.
Inaktive Blockgletscher
In dem Moment, wo die Bewegung völlig aufhört, der Gletscher inaktiv wird, beginnt die Abflachung der Stirn durch Massenbewegung (z.B. Schuttrutschungen). Der im Inneren vorliegende Eiskern ist noch nicht ausgeschmolzen. Allerdings erfolgt durch den Beginn der Eisschmelze das Einsinken der Blockgletscheroberfläche (Barsch 1973). Nach Barsch (1980) genügen folgende Kriterien zur Bezeichnung inaktiver Blockgletscher: Die Steilheit der Stirn liegt unter 35°, es kommt zu einem Vegetationsanflug auf den feinmaterialreichen Partien des Stirnhanges und die Mächtigkeit der hochsommerlich ungefrorenen Deckschicht beträgt oberhalb der Stirn 10-12 m (im Vergleich dazu liegt die Mächtigkeit bei aktiven Blockgletschern bei maximal 3,5 m).
Inaktive Blockgletscher können im Gegensatz zu fossilen wieder reaktiviert werden, wenn zusätzliches Eis im Inneren wieder angelagert und aufgrund eines vorhandenen Druckes plastisch verformt wird, so daß eine Fortbewegung wieder möglich wird.
Fossile Blockgletscher
Fossile Blockgletscher werden auch als kollabierte Formen bezeichnet. So kommt es neben dem Abschmelzen des gesamten Eisgehaltes zum weitflächigen Einsinken der gesamten Blockgletscheroberfläche. Eine weitere Kollapserscheinung ist die Ausspülung von Feinmaterial. Das ehemalige Oberflächenmuster, in Form von Wällen und Rinnen, bleibt allerdings erhalten. Das Schutt-Eis-Verhältnis im Blockgletscher ist dermaßen verringert, daß eine Bewegung nicht mehr möglich ist. Sie befinden sich in der Mehrzahl in der Stufe der alpinen Grasheide, wobei einige auch in den Bereich der subalpinen Bergwälder hinabreichen (Lieb 1991).
Weise (1983) zeigt Charakteristika für fossile Blockgletscher in den Seealpen auf. Danach besitzen sie eine Länge von 300-1400 m (meist 600-800 m) und eine Breite von 50-350 m. Ihr Gefälle beträgt 11-14° und sie sind in Karböden und Talschlüssen anzutreffen.
Die Fortbewegung von Blockgletschern, auch als Kriechphänomene im Permafrost bezeichnet, geschieht infolge einer plastischen Deformation des Eises im Schutt-Eis-Gemisch hang- oder talabwärts oder durch Gleitvorgängen an einer Gleitfläche. Die plastische Verformung ist eine Funktion des Druckes, der Temperatur, der Dauer der Beanspruchung, der Orientierung der Eiskristalle, des Konsolidierungsgrades und einer eventuellen Vorbelastung (Barsch 1983). Der Eiskörper im Inneren des Blockgletschers wird durch die auf ihn lagernden Gesteinstrümmer plastisch verformt. Dabei muß es sich nicht um Gletschereis handeln. Nach Barsch (1969) handelt es in den aktiven Blockgletschern vielmehr um Eis, das sich im Inneren der Schuttmasse aus eingelagertem Schnee oder aus Schmelzwasser neu gebildet hat. Dieses Eis tritt sowohl in Form von Eislinsen als auch als Eiszement (gefrorenes Feinmaterial) auf. Ab einem bestimmten Grenzwert beginnt durch plastische Deformation des Schutt-Eis-Körpers das Ausfließen der Schutthalde und damit die Entstehung eines Blockgletschers. Leichte Klimaverschiebungen beeinflussen die Fortbewegung. So nimmt mit einer Klimaverbesserung, sprich mit wärmeren Temperaturen, die Bewegungsgeschwindigkeit ab. Das hängt mit dem dadurch verursachten Ausschmelzen des für die Bewegung notwendigen Eisgehaltes zusammen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Mächtigkeit des Eiskörpers, die Mächtigkeit des gesamten Blockgletschers, die Neigung des Geländes sowie die Intensität der Schuttproduktion, die Geschwindigkeit von Blockgletscher bestimmen. Hier wird auch der Unterschied zu normalen Solifluktionsformen deutlich. Bei der Solifluktion findet der Bewegungsvorgang in der Auftauschicht statt. Dagegen bewegt sich bei den Blockgletschern der gesamte Schuttkörper mit dem in ihm enthaltenen Eis. Die Wandergeschwindigkeiten betragen zwischen einigen cm und einigen m pro Jahr. Das Geschwindigkeitsmaximum liegt ungefähr in der Mitte des Blockgletschers.
Nach Barsch (1983) liegt der Eisgehalt von aktiven Blockgletschern durchschnittlich zwischen 40 und 60 %. Beimengungen mineralischen Materials sowie andere "Verunreinigungen" verändern die physikalischen Eigenschaften des Eises beträchtlich.
3.3 Schuttproduktion und Schutttransport
Die Blockgletscher benötigen ein steiles schuttlieferndes Einzugsgebiet als Ausgangsrelief. Von ozeanischen Bereichen zu trocken-kontinentalen Bereichen nimmt die Reliefenergie zu. Sie steigt von 250/300 m bis auf 750/800 m an. Als Expositionspräferenz werden schattenseitige Auslagen bevorzugt (bei Zungenformen ausgeprägter zu beobachten als bei Lobenformen). Der Schutt wird durch Schutthalden, Haldenfußwälle und Moränen vorgegeben. An diesen Stellen entwickeln sich gefrorene Schuttmassen.
Barsch (1977a) hat Blockgletscher (Macun I und Murtèl I) in den Schweizer Alpen refraktionsseismisch untersucht und dabei die Höhenlage der Felssohle, der der Blockgletscher aufliegt, bestimmt. Genauerer Vermessungen der Oberfläche ergaben das Volumen der beiden Blockgletscher, die unter Hinzunahme des Eisgehaltes, zur Berechnung der Schuttproduktion im Einzugsbereich der Blockgletscher dient. Bei Vergleich zwischen Oberfläche und Einzugsgebiet konnte für den Bereich der aktiven Blockgletscher festgestellt werden, daß Blockgletscher unter Schutthalden ein etwa 1 bis 3 mal so großes und Blockgletscher unterhalb von Endmoränen ein etwa 1 bis 4 mal so großes Einzugsgebiet besitzen. Des weiteren kann davon ausgegangen werden, daß im Einzugsbereich der Blockgletscher, also in der Frostschuttstufe der Alpen im Bereich des diskontinuierlichen Permafrostes, mit Abtragsleistungen zwischen 28 und 5 m (Mittelwert 10 m) bzw. mit 4,5 bis 0,5 mm/a (Mittelwert 2,5 mm/a) gerechnet werden kann. Die Dauer der Schuttproduktion dürfte maximal 10.000 Jahre und minimal 6.000 Jahre betragen haben. Zu erwähnen ist noch, daß Unterschiede der Mittelwerte zwischen den verschiedenen Expositionen recht gering sind. Der in den Wänden produzierte Schutt wird, falls er in den Schutthalden nicht zu erliegen kommt, von verschiedenen Schutt-Transportsystemen (Gletscher, Blockgletscher, Wildbäche und Murgänge, Solifluktion) aufgenommen und weitertransportiert. Als Voraussetzungen des Massentransportes wird von Barsch (1977a) eine durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit von 0,3 m/a und eine durchschnittliche Hangneigung von 30 % (etwa 17°) der Blockgletscher genannt. Für die horizontale Massenverlagung pro Jahr ergibt sich ein Wert von 400 bis 650*106 m*t und für die vertikale Massenverlagerung pro Jahr ein Wert von 120 bis 190*106 m*t. Diese Material muß durch Frostverwitterung bereitgestellt werden.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die Schuttproduktion im Hochgebirge an den N-exponierten Wänden, im Bereich des diskontinuierlichen alpinen Permafrostes, am höchsten ist. Barsch (1977a) fand heraus, daß in den zentralen Schweizer Alpen 15-20 % der spezifischen periglazialen Massenverlagerung allein durch aktive Blockgletscher bewältigt werden.
3.4 Blockgletscher und Permafrostverbreitung
Makroklimatische Voraussetzungen scheinen offensichtlich eine besondere Rolle bei der Entstehung und Verbreitung von Blockgletschern zu spielen, da die Vertikalverbreitung aktiver Blockgletscher auf bestimmte Höhen beschränkt bleibt. In den Harris-Diagrammen werden die Permafrostzonen durch Einsatz von Gefrier- und Auftau-Indizes erfaßt und gegeneinander abgegrenzt. Daraus folgt ein klares Zuordnungsmuster (siehe Abb. 2). Die fossilen und inaktiven Blockgletscher (z.B. aus den Französischen Seealpen, Pyrenäen und den Gebirgen des Pazifischen NW der USA) erscheinen außerhalb aller Permafrostgrenzen (kontinuierlicher, diskontinuierlicher und sporadischer Permafrost) und weisen jeweils niedrige Gefrierindizes auf. Dagegen fallen die aktiven Formen, sowohl in Europa als auch in Nordamerika, in den Bereich des diskontinuierlichen ( 0 °C > T > - 5 °C) und des kontinuierlichen Permafrostes (T < - 5 °C). Es läßt sich damit ein Zusammenhang zwischen aktiven Blockgletschern und Permafrost herstellen. Untersuchungen mittels Bohrlochsondierung, seismische bzw. geoelektrische Versuche und Radar-Sondierungen in den Alpen und in den Rocky Mountains, in mittlerer Breite, zeigen, daß die Untergrenze der aktiven Blockgletscher i.d.R. der Reichweite des diskontinuierlichen Permafrostes entspricht oder zumindest ihr sehr nahe kommt. Allerdings kann Permafrost auch in der Umgebung der Blockgletscher und bis 100 m unterhalb aktiver Blockgletscher vorkommen. Im hochkontinentalen und arktisch-kontinentalen Gebiet Nordamerikas erscheinen Blockgletscher sogar erst im Bereich des kontinuierlichen Permafrostes und geben damit seine Grenze wieder. Zungenformen weisen eine engere Beziehung zu glaziologischen Grenzen auf als Lobenformen (Höllermann 1983a, Buchenauer 1990).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 Gefrier- und Auftau-Indizes für Verbreitungsgebiete von Blockgletschern in den Alpen, Pyrenäen und Nordamereika (Höllermann 1983a).
Die individuelle Untergrenze eines Blockgletschers ist von der orographischen Situation abhängig. Vor allem die potentielle Größe der Schuttanlieferungsfläche, die Wandhöhe über der Blockgletscherstirn und die konkrete Ausprägung der Blockgletscher sind entscheidende Faktoren (Schröder 1992).
Die Obergrenze der Blockgletscheraktivität ergibt sich nach Lieb (1991) aus den Faktoren Seehöhe, Umrahmung und Vergletscherung. Als ungefähre Obergrenze der aktiven Blockgletscher ist die Höhe der mittleren Schneegrenze der Gletscher anzunehmen, da oberhalb dieser Grenze die für die Entwicklung von Blockgletschern notwendige Schuttakkumulation nicht zur Verfügung steht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3 Höhengrenzen von Blockgletschern und Gletschern in den zentralen Ostealpen
(Höllermann 1983a).
Unter Schneegrenze wird in der Literatur nach Barsch (1980) immer die Gleichgewichtslinie (GWL) auf Gletschern verstanden. Je größer die Differenz zwischen Schneegrenze und Blockgletscheruntergrenze ist, umso größer ist die Spannweite in der sich aktive Blockgletscher bilden können. Im allgemeinen liegt die Differenz zwischen 200 und 300 m. Im Bereich deutlicher Massenerhebungen können Werte von über 500 m erreicht werden. Die Ursache dafür ist ein strahlungsreiches kontinentales Klima, das auf die Gleichgewichtslinie einen intensiveren Einfluß ausübt als auf den Blockgletscher und den Permafrost (Schröder 1992).
Jetzt läßt sich auch erklären wieso sich das Hauptverbreitungsgebiet der Blockgletscher im zentralalpinen kontinentalen Bereich befindet. Zum einen ist die Differenz zwischen Schneegrenze und Untergrenze der aktiven Blockgletscher und damit auch Untergrenze des diskontinuierlichen Permafrostes recht groß. Zum anderen rückt in den feuchten, ozeanischen Nordalpen die Schneegrenze und die Permafrostuntergrenze sehr nah zusammen, so daß aktive Blockgletscher keinen Raum zur Entwicklung besitzen.
Blockgletscher können also mit Recht als Indikatoren für diskontinuierlichen Permafrost im Hochgebirge angeführt werden und sind daher als eine periglaziale Form aufzufassen (Barsch 1980). Fossile Formen in tieferen Lagen sind Zeugen einer ehemaligen ausgedehnten Permafrostverbreitung und Depression der Jahrestemperatur (Buchenauer 1990).
3.5 Hypsometrische Stellung der Blockgletscher
Nach Höllermann (1983a) läßt sich im Idealfall eine regelhafte Höhenstufenabfolge erkennen. Wie in Abb. 4 zu sehen ist setzen am unteren Ende Sturzhalden ein, die dann höhenwärts über lobenförmige zu zungenförmigen Blockgletschern und schließlich zu jungen Moränen und Eisgletschern am oberen Ende fortschreiten. Dabei wird die Beziehung zwischen Sturzhalden und lobenförmigen Blockgletschern deutlich. Die zungenförmigen Blockgletscher finden sich unterhalb der mittleren Untergrenze der Gletscherherde wieder. Die Abb. 4 ist sehr schematisch und wird in der Natur durch das vorgegebene Relief, die geländeklimatische Differenzierung und durch die zeitliche Mehrschichtigkeit der Formenentwicklung abgewandelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4 Idealschema der hypsometrischen Formenverbreitung (Höllermann 1983a).
Innerhalb dieses Höhenschichtenmodells verschiebt sich das Schutt-Eis- Verhältnis. Zuerst liegen eisfreie unbewegte Halden vor, die über eiszementierte Blockgletscherloben und eisreiche Blockgletscherzungen bis zu schuttarmen Blankeisgletscher übergehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5 Schema des vertrikalen Verlaufs der Untergrenze aktiver Blockgletscher in Bezug zum Großklima und zu anderen Höhengrenzen (Höllermann 1983a).
Abb. 5 stellt die hypsometrische Stellung der aktiven Blockgletscher in Anhängigkeit zur wachsenden thermischen Kontinentalität dar. Als Bezugsniveau dient die obere Waldgrenze. Damit kann der Einfluß der absoluten Höhenlage und der geographischen Breite ausgeschaltet werden.
In hochozeanischen Gebirgen treten keine aktiven Blockgletscher auf, da die 0°-Jahresisotherme über der Vergletscherungsgrenze verläuft und im schmalen Höhensaum zwischen Wald und Gletscher kein Permafrost auftreten kann. Im Übergangsklima und mäßig kontinentalen Klima der Zentralalpen bleiben diese Formen auf den oberen, subnivalen Abschnitt der Periglazialstufe konzentriert. Im Kontinentalklima vom Typ der mittleren und südlichen Rocky Mountains sinkt die 0 -Jahresisotherme unter die Waldgrenze ab. Damit reicht die Permafroststufe in tiefere Lagen hinein. Die Untergrenze der aktiven Blockgletscher erreicht die obere Waldgrenze. Hier verläuft auch das Maximum im Höhenabstand zwischen der Untergrenze aktiver Blockgletscher und der Schneegrenze bzw. Vergletscherungsgrenze. Mit Erreichen des Polargebietes steigt die 0°- Jahresisotherme weiter ab. Der kontinuierliche Permafrost zieht ein. Die Untergrenze der aktiven Blockgletscher folgt diesem Trend nicht, sondern steigt in diesem Bereich gleichsinnig mit der Vergletscherungsgrenze, relativ zur Waldgrenze, an.
Die hypsometrische Stellung der aktiven Blockgletscher innerhalb der Periglazialstufe weist erhebliche regionale Unterschiede auf. Sie unterliegt nicht allein thermischen Regelhaftigkeiten. Es dürfen nach Höllermann (1983) deswegen die regionalen Geländebefunde nicht verallgemeinert werden.
4.0 Zusammenfassung
Blockgletscher haben ihre Verbreitungsschwerpunkte in den Alpen, den Pyrenäen und in Nordamerika. Darüber hinaus gibt es noch weitere Regionen auf dieser Erde, wo sie auftreten.
Sie bevorzugen winter-schneearmen, kontinental-winterkalten und trockenen Gebirgen. Wichtigste Voraussetzung für die Genese ist die Verfügbarkeit von Schutt, und ein Klima, das die Erhaltung oder Neubildung von Eis in den Schuttkörpern ermöglicht, aber nicht zu einer ausgedehnten Vergletscherung bis in tiefe Lagen herab führt. Barsch (1983) definiert Blockgletscher als gefrorene Schuttmassen bzw. Schutt-Eis-Gemische, die sich aufgrund plastischer Deformation ihres
Eisgehaltes der Schwerkraft folgend langsam hang- oder talabwärts bewegen. Daher werden Blockgletscher auch als Kriechphänomene angesehen.
Zu unterscheiden ist zwischen aktiven, inaktiven und fossilen sowie zwischen zungenförmigen und lobenförmigen Blockgletschern. Die Schuttproduktion im Hochgebirge an den N-exponierten Wänden ist im Bereich des diskontinuierlichen alpinen Permafrostes am höchsten. Eine nachweislich enge Beziehung zwischen Blockgletschern und dem Permafrost läßt den Schluß zu, daß Blockgletscher als Indikatoren für diskontinuierlichen Permafrost im Hochgebirge herangezogen werden können.
Im Idealfall ist eine regelhafte Höhenstufenabfolge erkennbar. Am unteren Ende setzen die Sturzhalden ein, die dann höhenwärts über lobenförmige zu zungenförmigen Blockgletschern und schließlich zu jungen Moränen und Eisgletschern am oberen Ende fortschreiten.
5.0 Schriftenverzeichnis
Barsch, D. (1969): Studien und Messungen an Blockgletschern in Macun, Unterengadin.- Z. Geomorphol. N. F., Suppl., 8: 11-30, 10 Abb., 1 Tab.; Berlin.
Barsch, D. (1973): Refraktionsseismische Bestimmung der Obergrenze des gefrorenen Schuttkörpers in verschiedenen Blockgletschern
Graubündens, Schweizer Alpen.- Z. Gletscherkde. u. Glazialgeol., 9, 1- 2: 143-167, 10 Abb.; Innsbruck.
Barsch, D. & Hell, G. (1975): Photogrammetrische Bewegungsmessungen am Blockgletscher Murtèl 1, Oberengadin, Schweizer Alpen.- Z. Gletscherkde. u. Glazialgeol., 11, 2: 111-142, 15 Abb., 9 Tab.; Innsbruck.
Barsch, D. (1977a): Eine Abschätzung von Schuttproduktion und
Schutttransport im Bereich aktiver Blockgletscher der Schweizer Alpen.- Z. Geomorphol. N. F., Suppl., 28: 148-160, 1 Abb., 4 Tab., 1 Taf.; Berlin.
Barsch, D. (1977b): Ein Permafrostprofil aus Graubünden, Schweizer Alpen.- Z. Geomorphol. N. F., 21, 1: 79-86, 1 Abb., 1 Taf.; Berlin.
Barsch, D. (1980): Die Beziehungen zwischen der Schneegrenze und der Untergrenze der aktiven Blockgletscher.- In: Jentsch, C. & Liedtke, H. [Hrsg.]: Arb. Geogr. Inst. der Univ. des Saarlandes: 119-133, 1 Abb.; Saarbrücken.
Barsch, D. (1983): Blockgletscher-Studien, Zusammenfassung und offene Probleme.- In: Poser, H. & Schunke, E. [Hrsg.]: Abh. Akad. Wiss., 35, 133-150, 1 Abb.; Göttingen.
Barsch, D. & Lorenz, K. (1989): Origin and geoelectrical resistivity of rockglaciers in semi-arid subtropical mountains (Andes of Mendoza, Argentinia).- Z. Geomorphol. N. F., 33, 2: 151-163, 5 Abb., 2 Tab., 3 Taf.; Berlin.
Barsch, D. & Zick, W. (1991): Die Bewegung des Blockgletschers Macun 1 von 1965-1988 (Unterengadin, Graubünden, Schweiz).- Z. Geomorphol.
N. F., 35, 1: 1- 14, 5 Abb., 4 Tab.; Berlin.
Buchenauer, H. W. (1990): Gletscher- und Blockgletschergeschichte der westlichen Schobergruppe (Osttirol).- Marburger Geogr. Schr., 117: 276 S., 30 Abb., 45 Tab., 16 Beil.; Marburg.
Haeberli, W. (1975): Eistemperaturen in den Alpen.- Z. Gletscherkde. u. Glazialgeol., 11, 2: 209-220, 4 Abb., 2 Tab.; Innsbruck.
Höllermann, P. (1983a): Blockgletscher als Mesoformen der
Periglazialstufe.- Bonner Geogr. Abh., 67: 73 S., 16 Abb., 2 Tab., 10 Taf.; Bonn.
Höllmann, P. (1983b): Blockgletscherstudien in europäischen und nordamerikanischen Gebirgen.- In: Poser, H. & Schunke, E. [Hrsg.]: Abh. Akad. Wiss., 35, 116-119; Göttingen.
Höllmann, P. (1983c): Probleme der Blockgletscherforschung. Referat der Diskussionsbeiträge.- In: Poser, H. & Schunke, E. [Hrsg.]: Abh. Akad. Wiss., 35: 151-159; Göttingen.
King, L. (1976): Permafrostuntersuchungen in Tarfala (Schwedisch Lappland) mit Hilfe der Hammerschlagseismik.- Z. Gletscherkde. u. Glazialgeol., 12, 2: 187-204, 5 Abb., 2 Tab.; Innsbruck.
Klaer, W. (1974): Kritische Anmerkungen zur Neueren Literatur über das Blockgletscherproblem.- In: Graul, H. & Fricke, W. [Hrsg.]: Heidelb. Geogr. Abh., 40: 275-291, 4 Abb.; Heidelberg.
Klaer, W. (1983): Die Blockgletscherfrage, ein terminologisches Problem.In: Poser, H. & Schunke, E. [Hrsg.]: Abh. Akad. Wiss., 35: 120-132, 6 Abb.; Göttingen.
Lieb, G. K. (1991): Die horizontale und vertikale Verteilung der
Blockgletscher in den Hohen Tauern (Österreich).- Z. Geomorphol. N. F., 35, 3: 345-365, 11 Abb., 6 Tab.; Graz.
Mühll, D. S. V (1993): Geophysikalische Untersuchungen im Permafrost des Oberengadins.- Diss.: 222 S., 95 Abb., 9 Tab.; Zürich.
Schröder, H. (1992): Aktive Blockgletscher im zentralen Teil des nördlichen Tienschan.- Petermanns Geogr. Mitt., 136, 2-3: 109-119, 8 Abb.; Gotha.
Vietoris, L. (1972): Über den Blockgletscher des äußeren Hochebenkars.-
Z. Gletscherkde. u. Glazialgeol., 8, 1-2: 169-188, 14 Abb., 3 Tab.; Innsbruck.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Blockgletscher?
Blockgletscher werden als gefrorene Schuttmassen bzw. Schutt-Eis-Gemische definiert, die sich aufgrund plastischer Deformation ihres Eisgehaltes der Schwerkraft folgend langsam hang- oder talabwärts bewegen. Sie können in enger räumlicher Beziehung zu Gletschern oder völlig entfernt davon entstehen.
Wo kommen Blockgletscher vor?
Blockgletscher sind verbreitet in den Alpen (besonders den Zentralalpen und im Internbogen der Westalpen), den Pyrenäen (zunehmend von den Zentral- zu den Ostpyrenäen) und in Nordamerika (z.B. in der kalifornischen Sierra Nevada und den Rocky Mountains). Sie kommen auch in Skandinavien, der Tatra, der Sierra Nevada in Spanien und im Gran Sasso-Gebiet in Italien vor.
Wie entstehen Blockgletscher?
Es gibt zwei Hauptthesen zur Entstehung: entweder aus schuttbedeckten Eisgletschern (glaziale Entstehung) oder als reine periglaziale Phänomene. Die gängige Theorie geht eher von einer periglazialen Entstehung aus, wobei auch glaziales Material eingebunden sein kann.
Welche Faktoren beeinflussen die Verbreitung von Blockgletschern?
Wichtige Faktoren sind die Verfügbarkeit von Schutt, ein Klima, das die Erhaltung oder Neubildung von Eis ermöglicht (aber keine ausgedehnte Vergletscherung), eine kontinentale Lage (trocken, strahlungsreich), und das Vorhandensein von Massengesteinen (z.B. Granit). Blockgletscher bevorzugen schattenseitige Auslagen (NW, N, NE).
Welche Arten von Blockgletschern gibt es?
Man unterscheidet aktive, inaktive und fossile Blockgletscher. Aktive bewegen sich noch, inaktive haben ihre Bewegung eingestellt (aber enthalten noch Eis), und fossile haben ihr Eis verloren und sind kollabiert.
Was sind die charakteristischen Merkmale von Blockgletschern?
Blockgletscher bestehen aus einer oberen Blockschicht (2-4 m mächtig) und einer unteren, feinmaterialreichen Schicht. Ihre Oberfläche weist ein regelmäßiges Kleinrelief mit Längs- oder Querwülsten und -wällen auf. Sie können zungen-, loben-, girlanden- oder spaltenförmig sein.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Blockgletschern und Permafrost?
Aktive Blockgletscher sind oft Indikatoren für diskontinuierlichen Permafrost in Hochgebirgen. Die Untergrenze der aktiven Blockgletscher entspricht in der Regel der Reichweite des diskontinuierlichen Permafrostes.
Wie schnell bewegen sich Blockgletscher?
Die Wandergeschwindigkeiten von Blockgletschern liegen zwischen einigen Zentimetern und einigen Metern pro Jahr. Das Geschwindigkeitsmaximum liegt ungefähr in der Mitte des Blockgletschers.
Welche Rolle spielt die Schuttproduktion und der Schutttransport bei der Entstehung von Blockgletschern?
Blockgletscher benötigen ein steiles, schuttlieferndes Einzugsgebiet. Der Schutt wird durch Schutthalden, Haldenfußwälle und Moränen vorgegeben. Die Schuttproduktion ist im Hochgebirge an den N-exponierten Wänden am höchsten.
Was versteht man unter der hypsometrischen Stellung der Blockgletscher?
Im Idealfall gibt es eine Höhenstufenabfolge: Sturzhalden am unteren Ende, die höhenwärts über lobenförmige zu zungenförmigen Blockgletschern und schließlich zu jungen Moränen und Eisgletschern am oberen Ende fortschreiten. Die hypsometrische Stellung variiert jedoch regional.
- Quote paper
- Michael Pachmajer (Author), 1996, Verbreitung und Genese von Blockgletschern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96225