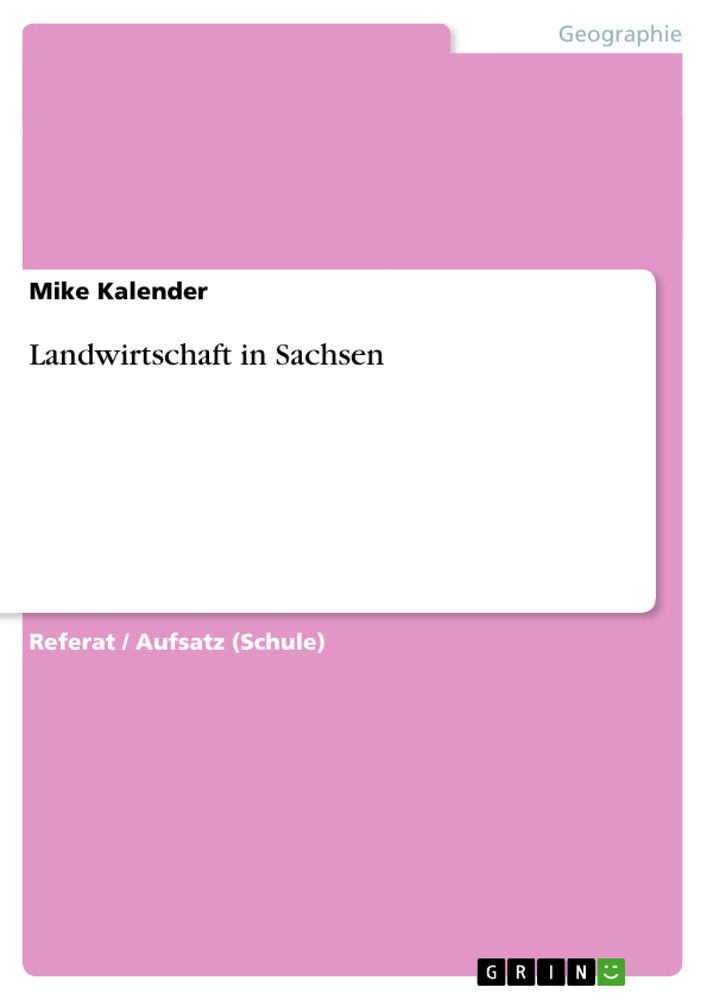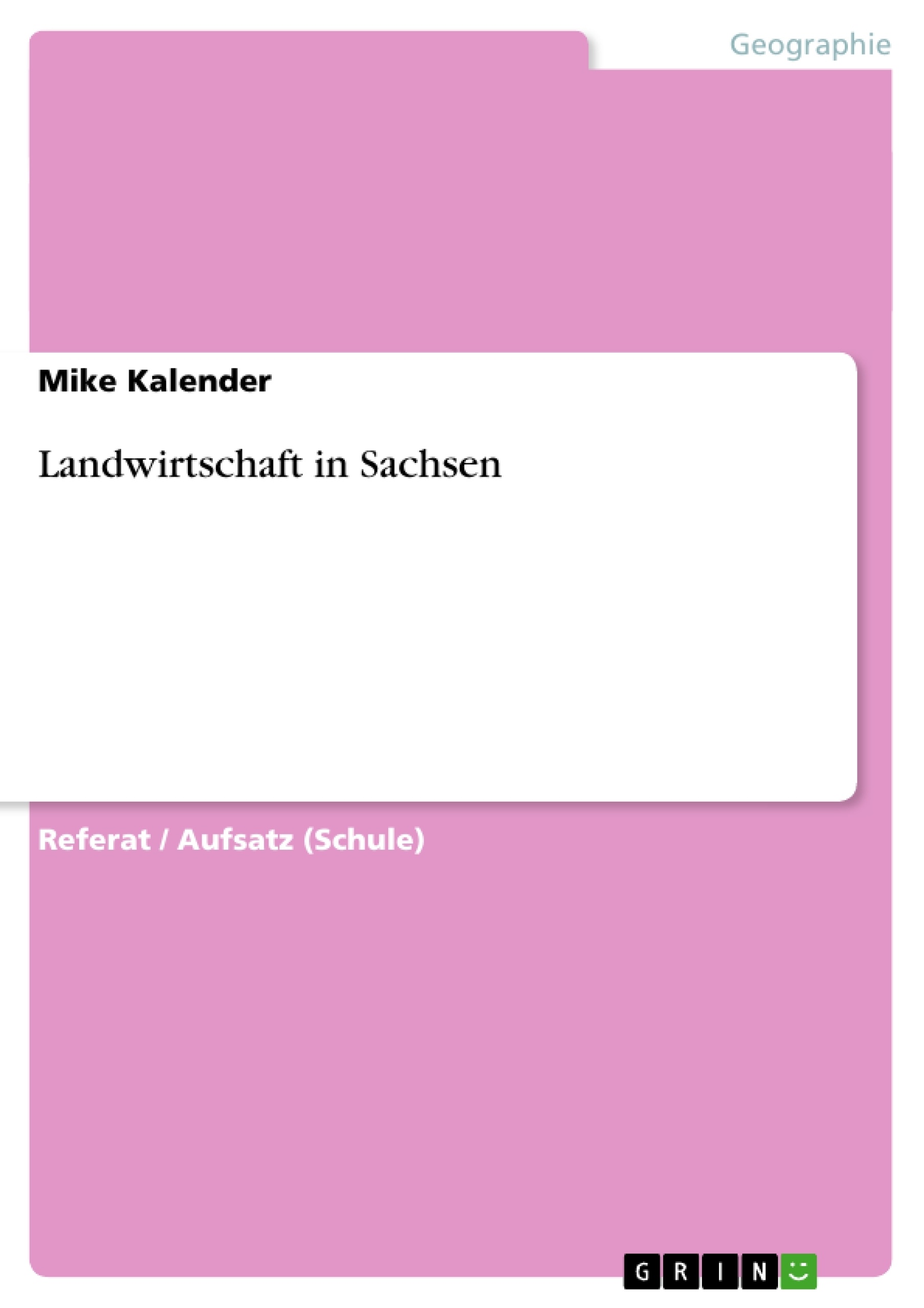Landwirtschaft in Sachsen
1. Umstellungsprobleme durch die „Deutsche Einheit“
Die Landwirtschaft in Sachsen befindet sich seit der Wende vor allem durch die Einführung der Marktwirtschaft und der Abhängigkeit von der EG-Agrarstrukturpolitik und deren Marktordnung im völligen Wandel.
Die Organisationsstrukturen der DDR (LPG, VEG) waren unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr aufrecht zu erhalten und wurden aufgelöst. Somit änderten sich auch die Produktionsziele und Anbaustrukturen in Sachsen.
2. Wandel der Flächennutzung und Produktionsziele
Das Ziel der sozialistischen Agrarpolitik der DDR war es, eine soweit wie mögliche Nahrungsmittelautarkie zu erreichen. So entstanden Produktionsmethoden, deren einziges Ziel es war die Maximalproduktion an landwirtschaftlichen Gütern zu sichern. Um dies umzusetzen, wurde in der DDR auf allen zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen Anbau betrieben, sogar auf Böden aus Verwitterungsschutt und Sand, die eine sehr schlechte Fruchtbarkeit besitzen. Nach der Wende rückte nun die Kapitalverwertung in den Mittelpunkt der Produktion. Das heißt, die Bauern orientieren sich jetzt am maximalen Gewinn und nicht mehr an den maximalen Erträgen. Eine logische Konsequenz daraus ist, dass die Bauern nur noch die Flächen bestellen, deren Erträge mindestens die Kosten decken. Daher ging die Zahl der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Sachsen von 1 056 000 Hektar (1989) auf 805 000 Hektar (1992) zurück. Ebenso gingen auch die Viehbestände und die Anzahl der Arbeitsplätze im Bereich der Landwirtschaft stark zurück. 1989 waren in Sachsen noch 165 000 Menschen im Agrarsektor beschäftigt, 1992 nur noch 40 000. Die Viehbestände sanken seit 1989 auf 50%, dieser Rückgang ist bedingt durch die niedrigen Abnahmepreise und durch den schlechten Stand der weiterverarbeitenden Industrie in Sachsen. Außerdem ist seit der Wende eine klare Differenzierung der Flächennutzung zu beobachten. 57% der Gesamtfläche Sachsens werden landwirtschaftlich genutzt, davon 72% als Ackerland und 23% als Grün- bzw. Weideland. Jedoch verändert sich dieses Verhältnis von Region zu Region. Während im Norden Sachsens auf den fruchtbaren Diluvial- und Lößböden vor allem Ackerbau betrieben wird (Bsp.: Kreis Meißen 86% Ackerlandanteil) nimmt in den Mittelgebirgen (Verwitterungsschutt) die Grünlandnutzung und damit die Viehwirtschaft stark zu.
Der Wandel der Flächennutzung in Abhängigkeit vom Produktionsziel der Landwirtschaft:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Begrenzung biologische Begrenzung des ökonomische Begrenzung des Anbaus Anbaus
3. Landwirtschaftliche Betriebsstrukturen in Sachsen
Die Betriebsstrukturen entwickelten sich in Sachsen in Abhängigkeit von der Bodenqualität. Die fruchtbarsten und besten Böden von Grimma bis nach Meißen (Lommatzsche Pflege) waren Anfang 1991 schon an kapitalstarke westdeutsche Neu- bzw. Wiedereinrichter vergeben, da die bestehenden Agrargenossenschaften und einheimischen Landwirte soviel Geld für die Pacht bzw. den Kauf dieser teueren Flächen nur sehr selten aufbringen konnten.
So verlegten die Agrargenossenschaften ihren Anbau auf Standorte mittlerer Qualität. Jedoch sind auf diesen Flächen hohe Überschüsse nicht immer sicher. Auch der Einsatz westdeutschen Kapitals ist hier eher die Ausnahme. Neben den Genossenschaften dominieren auf diesen Gebieten die einheimischen Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe.
Fast alle landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen sind allerdings auf die Zupachtung von Flächen angewiesen, um ökonomisch Anbau betreiben zu können. Dazu kommt noch, dass das gesamte Land, das unter das Bodenreformgesetz gefallen war, heute von der Treuhand verwaltet wird und ebenfalls gepachtet werden muss.
4. Allgemeine Trends der sächsischen Landwirtschaft
- Klare Zunahme des Getreideanbaus durch gute Bodenqualität (Bodenwertzahlen in manchen Regionen um 50)
- Zunahme des Anbaus von Raps und Sonnenblumen
- Arbeitskräfteintensive Viehhaltung eher verstärkt in Genossenschaften und ostdeutsch geleiteten Betrieben
- Abnahme des Kartoffelanbaus
Häufig gestellte Fragen zu "Landwirtschaft in Sachsen"
Was sind die Hauptumstellungsprobleme der sächsischen Landwirtschaft nach der Deutschen Einheit?
Die Einführung der Marktwirtschaft und die Abhängigkeit von der EG-Agrarstrukturpolitik führten zu einem vollständigen Wandel in der sächsischen Landwirtschaft. Die Organisationsstrukturen der DDR (LPG, VEG) waren unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr haltbar und wurden aufgelöst, was zu Änderungen in den Produktionszielen und Anbaustrukturen führte.
Wie hat sich die Flächennutzung und die Produktionsziele in Sachsen verändert?
Das Ziel der DDR war Nahrungsmittelautarkie, was zu maximaler Produktion auf allen verfügbaren Flächen führte. Nach der Wende rückte die Kapitalverwertung in den Mittelpunkt, was dazu führte, dass nur noch ertragreiche Flächen bestellt wurden. Dies führte zu einem Rückgang der landwirtschaftlich genutzten Flächen, der Viehbestände und der Arbeitsplätze im Agrarsektor.
Wie haben sich die landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen in Sachsen entwickelt?
Die Betriebsstrukturen entwickelten sich in Abhängigkeit von der Bodenqualität. Die besten Böden wurden oft an kapitalstarke westdeutsche Investoren vergeben, während Agrargenossenschaften und einheimische Landwirte sich auf Standorte mittlerer Qualität konzentrierten. Zupachtung von Flächen ist für fast alle Betriebe notwendig, um ökonomisch arbeiten zu können.
Welche allgemeinen Trends sind in der sächsischen Landwirtschaft zu beobachten?
Es gibt eine Zunahme des Getreideanbaus aufgrund guter Bodenqualität, eine Zunahme des Anbaus von Raps und Sonnenblumen, arbeitskräfteintensive Viehhaltung in Genossenschaften, eine Abnahme des Kartoffelanbaus und eine Tendenz zu Großfarmen nach amerikanischem Vorbild auf hochwertigen Böden.
Welchen Einfluss hatte die Bodenqualität auf die Landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen?
Die Bodenqualität hatte einen großen Einfluss. Die Gebiete mit den fruchtbarsten Böden gingen größtenteils an westdeutsche Neu- oder Wiedereinrichter, da die bestehenden Agrargenossenschaften sich diese Flächen nicht leisten konnten.
Welche Bedeutung hat die Treuhand bei der Verpachtung von Landflächen?
Das gesamte Land, das unter das Bodenreformgesetz gefallen war, wird heute von der Treuhand verwaltet und muss von den Landwirten gepachtet werden. Dies macht die Landwirtschaftlichen Betriebe bei der Zupachtung von Flächen abhängig.
- Quote paper
- Mike Kalender (Author), 1999, Landwirtschaft in Sachsen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96222