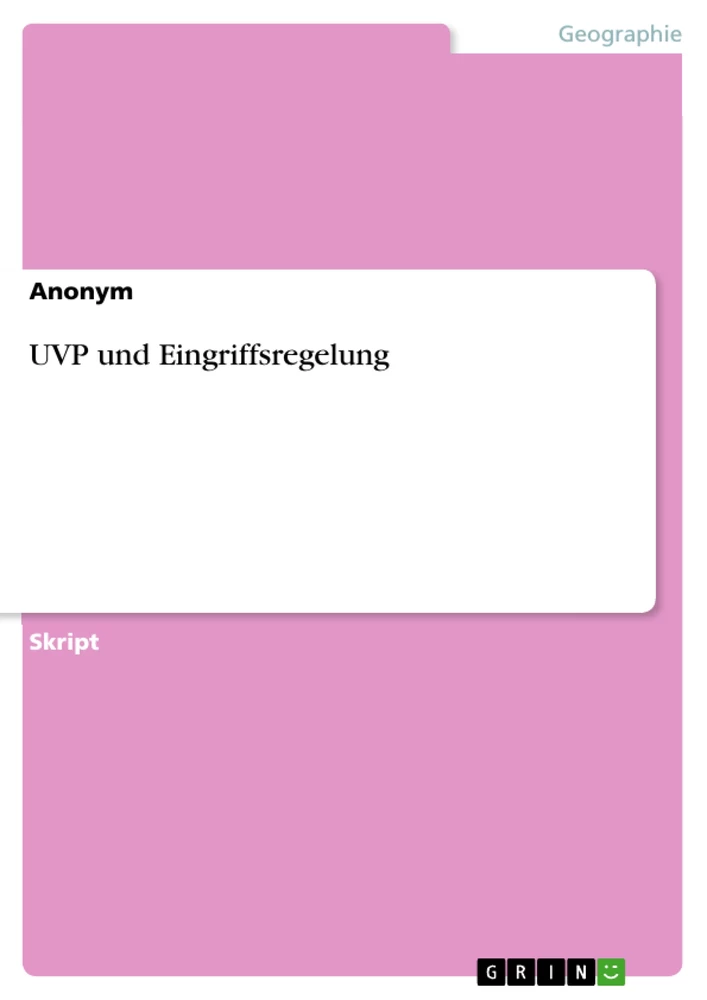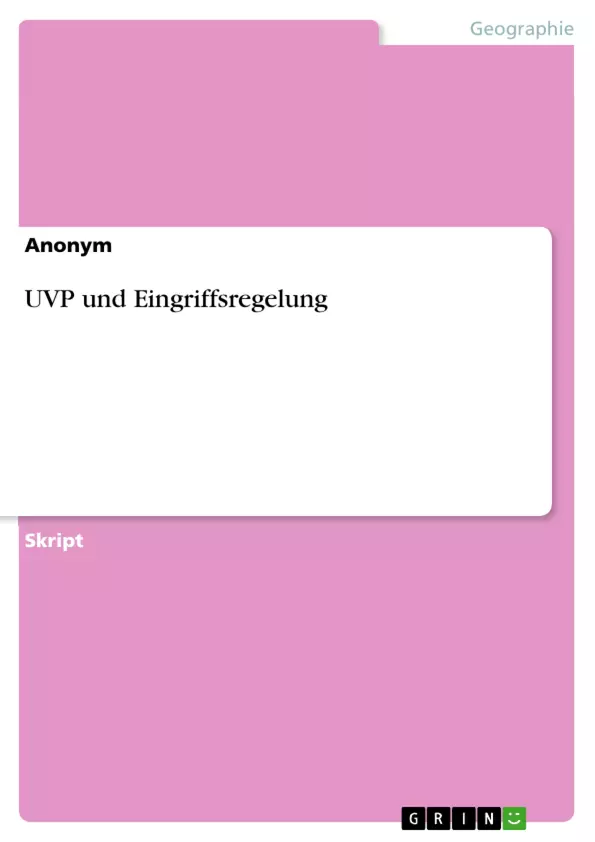Stehen wir wirklich vor dem ökologischen Kollaps, oder gibt es Wege, die Balance zwischen menschlichen Eingriffen und dem Schutz unserer Umwelt zu wahren? Dieses Buch dringt tief in die komplexen Mechanismen der Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ein, um Ihnen ein umfassendes Verständnis der gesetzlichen Grundlagen und praktischen Anwendungen zu vermitteln. Entdecken Sie, wie das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ineinandergreifen, um die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild zu schützen, während gleichzeitig die Interessen von Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigt werden. Erfahren Sie, welche Kriterien bei der Beurteilung von Eingriffen eine Rolle spielen, wie Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden, und welche Herausforderungen bei der Kompensation von Umweltschäden auftreten. Anhand von Beispielen aus der Praxis, insbesondere aus Niedersachsen, werden die Mängel in der Anwendung der Eingriffsregelung schonungslos aufgedeckt und Lösungsansätze für eine effektivere Umsetzung diskutiert. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die sich beruflich oder privat mit Fragen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen, sei es in Behörden, Planungsbüros, Naturschutzorganisationen oder als interessierte Bürger. Es bietet nicht nur einen fundierten Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die praktische Vorgehensweise, sondern regt auch zur kritischen Reflexion über die Effektivität unserer Naturschutzinstrumente an und zeigt Wege auf, wie wir unsere Umwelt besser schützen können. Von der Biotoptypenkartierung bis zur Eingriffsbilanzierung, von der Vermeidung von Stoffeinträgen bis zur Wiederherstellung von Lebensräumen – dieses Buch liefert das notwendige Wissen und die Werkzeuge, um die Herausforderungen des Umweltschutzes im 21. Jahrhundert erfolgreich zu meistern. Tauchen Sie ein in die Welt der Geoökofaktoren, der Biozönosen und der Kompensationsmaßnahmen, und werden Sie Teil einer Bewegung, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Die Reise durch die deutsche Gesetzgebung und die komplizierten Verfahrensweisen, die unsere Umwelt schützen sollen, wird durch dieses Buch wesentlich leichter und verständlicher.
1. Gesetzliche Grundlagen
Eingriffsregelung
Nach dem BNatSchG versteht man unter Eingriffen Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbilds erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Nach §8 des BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen ist ein Ausgleich vorgeschrieben. Ein Eingriff gilt als ausgeglichen, wenn keine Beeinträchtigung des Naturhaushalts zurückbleibt und das Landschaftsbild wiederhergestellt ist. Verboten sind Eingriff für die keine Vermeidung der Beeinträchtigung oder Ausgleich möglich ist.
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
Nach §2 des UVPG ist eine UVP ein Verfahren, das der Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben dient. Die UVP umfaßt die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkung eines Vorhabens auf das Landschaftsökosystem, den Menschen sowie Kultur- und sonstige Sachgüter. Die Durchführung erfolgt unter Einbeziehung der Öffentlichkeit. Zu Beginn der UVP sind vom Träger des Vorhabens Unterlagen einzureichen, die das Vorhaben, die zu erwartenden Emissionen und Reststoffe insb. Luftverunreinigungen, Abfälle und Abwasser sowie Auswirkungen auf die Umwelt beschreiben. Außerdem ist eine Erläuterung von Maßnahmen, die erhebliche Beeinträchtigungen vermeiden, vermindern oder ausgleichen sowie gegebenenfalls von Ersatzmaßnahmen erforderlich. Weitere Angaben umfassen eine Beschreibung des Landschaftsökosystems und eine Übersicht über Vorhabensalternativen.
Vergleich zwischen Eingriffsregelung (BNatSchG) und UVP (UVPG)
Die Schutzgüter im Sinne des BNatSchG umfassen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts (Geoökofaktoren) und das Landschaftsbild als Lebensgrundlage des Menschen. Diese beiden Aspekte werden auch weitgehend durch das UVPG abgedeckt. Das UVPG geht aber darüber hinaus indem es Kultur- und andere Sachgüter sowie explizit den Menschen schützt. In Bezug auf den Geltungsbereich überschneiden sich die beiden Gesetze zum Teil, d.h. es existieren Vorhaben, die sowohl eingriffsregelungs- als auch UVP-pflichtig sind (z.B. Fernstraßenbau).
2. Vorgehensweise in der Praxis
Eingriffsregelung
Liegt ein Eingriff vor, wird eine Prüfung der Maßnahme durchgeführt. Zunächst wird festgestellt, ob eine Vermeidung der Beeinträchtigung möglich ist. Ist dies der Fall, ist eine Vermeidung zwingend. Andernfalls stellt sich die Frage nach Ausgleichsmaßnahmen. Sind diese nicht möglich wird geprüft, ob die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorgehen. Sofern dies zutrifft, ist die Maßnahme unzulässig, ansonsten zulässig. Wird die Maßnahme durchgeführt, sind Ersatzmaßnahmen (Wiederherstellung des Naturhaushalts oder Landschaftsbilds in ähnlicher Art und Weise) zu planen.
Ausgleichbarkeit
Ein Ausgleich wird nur erreicht, wenn die Biotoptypen mit zugehörigen Biozönosen in einem überschaubaren Zeitraum wiederhergestellt werden können. Daher stellt sich auch die Frage nach den Wiederbesiedelungsbedingungen. Kriterien hierfür sind z.B. Minimalareale der Arten, Nähe und Erreichbarkeit von ausbreitungsfähigen Populationen. Bei stark gefährdeten Arten ist eine Wiederbesiedelung nicht vorstellbar. Eine große Rolle spielt die zeitliche Wiederherstellbarkeit. Als zeitnah nicht wiederherstellbar gilt naturnahe Vegetation. Ausschließlich jüngere Sukzessionsstadien, z.T. Heiden, Magerrasen und artenreiches Grünland sind zeitnah wiederherstellbar.
Kompensationsmaßnahmen
Kompensationsmaßnahmen kommen bei Verlust an Lebensräumen, Individuen- und Artenverlusten sowie Veränderungen der abiotischen Standortfaktoren zur Anwendung. Die Kompensation erfolgt bei den erstgenannten Fällen z.B. durch Neuanlage von Biotopen und Ergänzung und Verbesserung vorhandener Biotope. In Bezug auf den letzten Fall sind z.B. Entsiegelung, Vernässung und Reduzierung des Schadstoffeintrags denkbar.
Informationsbedarf
Im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung sind Informationen über das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften erforderlich. Nach einer Vorgabe des Niedersächsischen Landesamt für Ökologie ist hierfür zunächst eine Erfassung der Biotoptypen (flächendeckende Biotoptypenkartierung) und der Pflanzen- und Tierarten (Zeigerarten bzw. -gruppen, gefährdete Arten, flächendeckend Arten der Roten Liste) durchzuführen. Eine Bewertung der obigen Ergebnisse erfolgt mittels Wertstufen von 1-3 für die Kriterien Naturnähe des Biotoptyps und Vorkommen gefährdeter Arten. Ein weiterer Bestandteil ist eine Aufführung der Hauptbeeinträchtigungsfaktoren wie z.B. Stoffeinträge, Grundwasserentnahme, Bau technischer Einrichtungen, Beseitigung von Vegetation. Anhand von Meßgrößen läßt sich die Beeinträchtigung abschätzen, z.B. Auswirkungen auf die Biotopdiversität, Populationsgröße einzelner Arten, bodenchemischen und bodenphysikalischen Eigenschaften, Schadstoffkonzentrationen (Boden, Luft, Wasser), Grundwasserflurabstand. Um Beeinträchtigungen zu vermeiden, sind Vorkehrungen im Rahmen der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung notwendig. Als Maßnahmen kommen z.B. Unterschutzstellung, Modifizierung von Vorhaben, Vermeidung von Stoffeinträgen und Lärm, Durchführung bestimmter Maßnahmen außerhalb von Vegetations-, Brut- und Laichzeiten in Frage.
Eingriffsbilanzierungen
Bei Eingriffsbilanzierungen wird eine Werteliste der Biotoptypen (Wertepunkte pro qm) erstellt. Anhand eines Vergleichs zwischen dem Gesamt-Biotopwert vor und nach Durchführung eines Vorhabens läßt sich das Ausgleichsdefizit ermitteln. Dieses Defizit wird durch Kompensationsmaßnahmen egalisiert.
Mängel in der Anwendung
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Eingriffsregelung nach dem BNatSchG?
Die Eingriffsregelung bezieht sich auf Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbilds erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können. Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen, und unvermeidbare Beeinträchtigungen müssen ausgeglichen werden. Ein Eingriff gilt als ausgeglichen, wenn keine Beeinträchtigung des Naturhaushalts zurückbleibt und das Landschaftsbild wiederhergestellt ist.
Was ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem UVPG?
Eine UVP ist ein Verfahren zur Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben. Sie umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf das Landschaftsökosystem, den Menschen sowie Kultur- und sonstige Sachgüter. Die Öffentlichkeit wird dabei einbezogen.
Wie unterscheiden sich Eingriffsregelung (BNatSchG) und UVP (UVPG)?
Beide Gesetze schützen im Wesentlichen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild. Das UVPG geht aber darüber hinaus, indem es auch Kultur- und andere Sachgüter sowie explizit den Menschen schützt. Der Geltungsbereich überschneidet sich teilweise, d.h. einige Vorhaben sind sowohl eingriffsregelungs- als auch UVP-pflichtig.
Wie läuft die Vorgehensweise bei der Eingriffsregelung in der Praxis ab?
Zunächst wird geprüft, ob eine Beeinträchtigung vermieden werden kann. Wenn nicht, werden Ausgleichsmaßnahmen geprüft. Wenn auch diese nicht möglich sind, wird geprüft, ob die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorgehen. Wenn die Maßnahme durchgeführt wird, sind Ersatzmaßnahmen zu planen.
Was bedeutet Ausgleichbarkeit im Kontext der Eingriffsregelung?
Ein Ausgleich ist nur gegeben, wenn Biotoptypen mit zugehörigen Biozönosen in einem überschaubaren Zeitraum wiederhergestellt werden können. Dabei spielen Wiederbesiedelungsbedingungen wie Minimalareale der Arten und die Nähe zu ausbreitungsfähigen Populationen eine Rolle. Naturnahe Vegetation gilt als zeitnah nicht wiederherstellbar.
Welche Kompensationsmaßnahmen gibt es?
Kompensationsmaßnahmen werden bei Verlust an Lebensräumen, Individuen- und Artenverlusten sowie Veränderungen der abiotischen Standortfaktoren angewendet. Beispiele sind die Neuanlage von Biotopen, die Ergänzung und Verbesserung vorhandener Biotope, Entsiegelung, Vernässung und die Reduzierung des Schadstoffeintrags.
Welche Informationen sind im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung erforderlich?
Es sind Informationen über Arten und Lebensgemeinschaften erforderlich, insbesondere eine Erfassung der Biotoptypen und der Pflanzen- und Tierarten (Zeigerarten, gefährdete Arten, Arten der Roten Liste). Die Ergebnisse werden anhand von Wertstufen für die Kriterien Naturnähe des Biotoptyps und Vorkommen gefährdeter Arten bewertet.
Was sind Eingriffsbilanzierungen?
Bei Eingriffsbilanzierungen wird eine Werteliste der Biotoptypen erstellt. Durch einen Vergleich des Gesamt-Biotopwerts vor und nach Durchführung eines Vorhabens wird das Ausgleichsdefizit ermittelt, welches dann durch Kompensationsmaßnahmen egalisiert wird.
Welche Mängel gibt es in der Anwendung der Eingriffsregelung?
Eine niedersächsische Untersuchung ergab erhebliche Defizite in der Praxis der Eingriffsregelung. Die Handhabung bleibt hinter den gesetzlichen Anforderungen zurück, und die Möglichkeiten werden nicht ausgeschöpft. Nur in wenigen Fällen wurde ein tatsächlicher Ersatz oder Ausgleich erreicht.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2000, UVP und Eingriffsregelung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96217