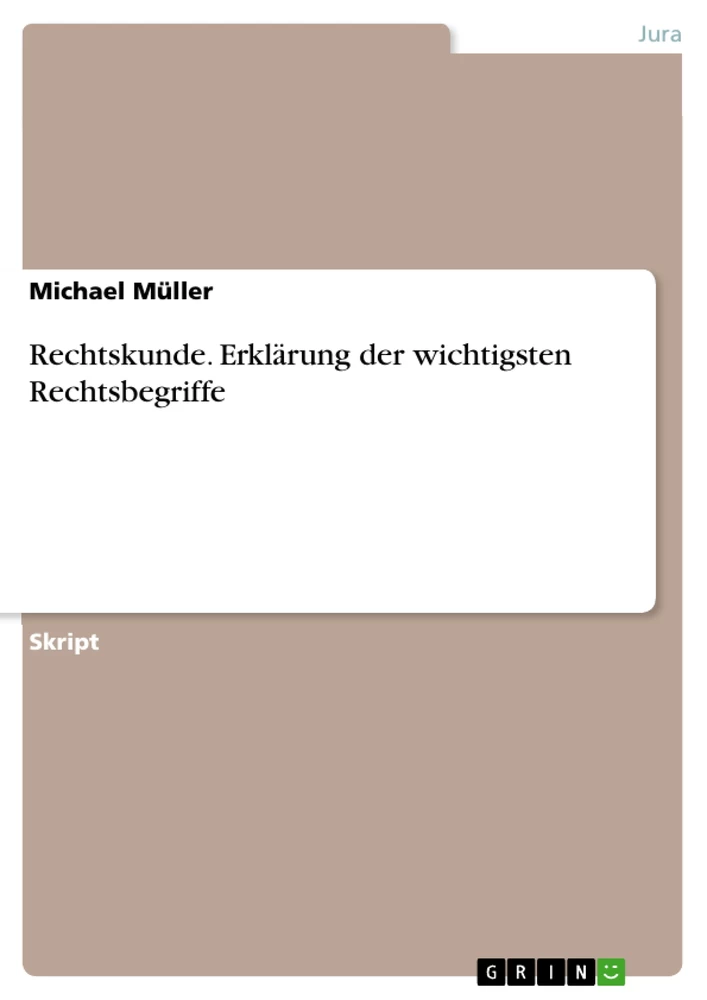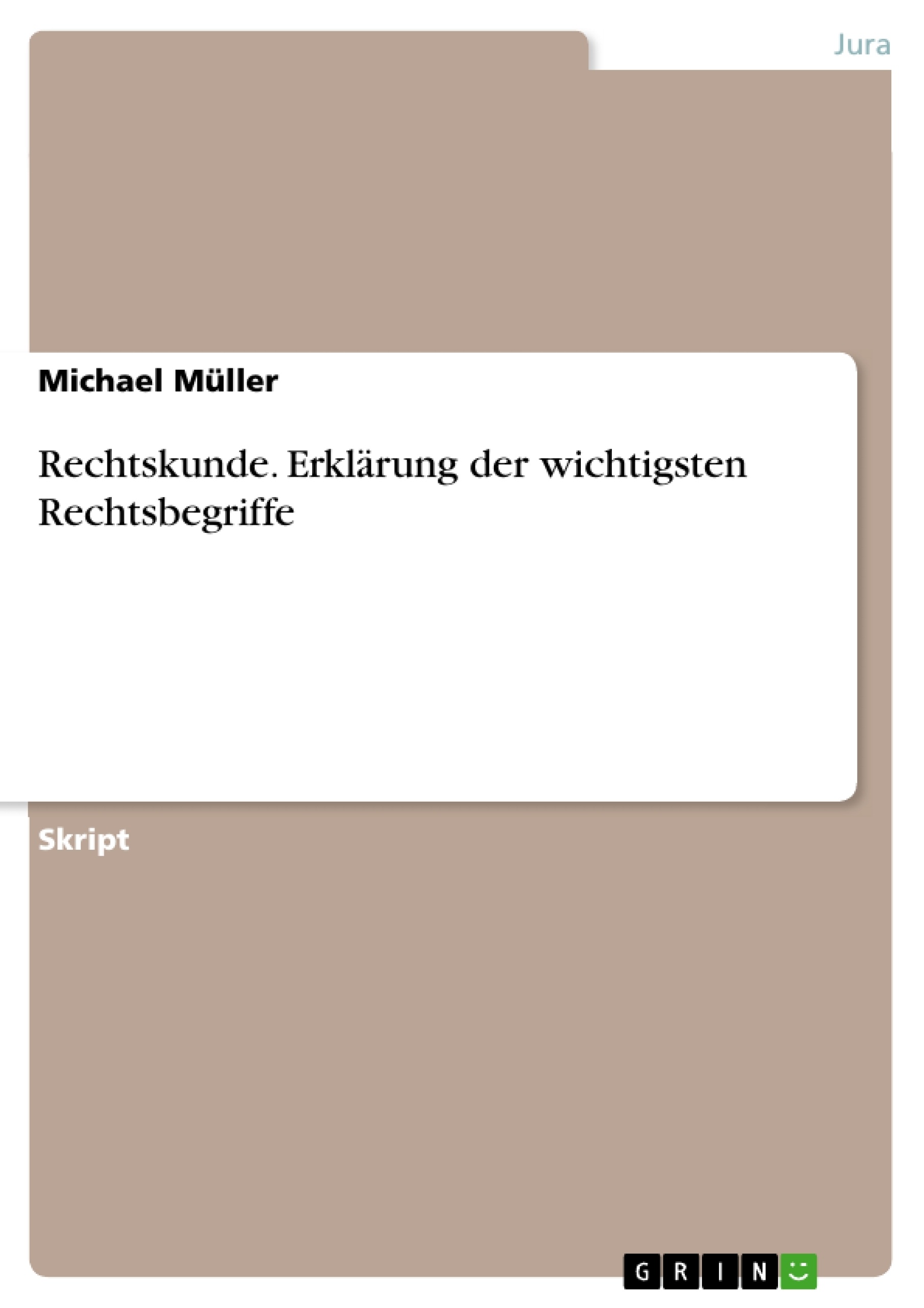Tauchen Sie ein in die komplexe Welt des deutschen Rechts! Dieses umfassende Werk bietet einen fundierten und praxisnahen Einblick in die zentralen Bereiche des Rechtswesens, von den grundlegenden Begriffsbestimmungen und den Feinheiten des Strafrechts (StGB) über das Ordnungswidrigkeitenrecht (OWiG) bis hin zum Polizeirecht (PolG) und Verwaltungsrecht (VwVfG, VwGO). Entdecken Sie die subtilen Unterschiede zwischen materiellem und formellem Recht, das Legalitäts- und Opportunitätsprinzip und die Bedeutung der Subsumtion. Lernen Sie die Voraussetzungen für eine Straftat kennen, von der Tatbestandsmäßigkeit über die Rechtswidrigkeit bis hin zur Schuld, und verstehen Sie die verschiedenen Schuldformen wie Vorsatz und Fahrlässigkeit. Erforschen Sie die Prinzipien der Spezial- und Generalprävention sowie die Mechanismen des Strafprozessrechts, einschließlich der Aufgaben von Staatsanwaltschaft und Polizei. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Recht der Ordnungswidrigkeiten, den forstlich relevanten OWi's und dem Ablauf eines Bußgeldverfahrens. Aber auch die Kompetenzen von Revierleitern und die Abgrenzung von Straftaten werden erläutert. Detaillierte Ausführungen zum Polizeirecht, insbesondere zur Gefahrenabwehr und den verschiedenen Störertypen, sowie zum Verwaltungsrecht, einschließlich des Verwaltungsaktes und seiner Anfechtbarkeit, runden das Bild ab. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die sich mit dem deutschen Recht auseinandersetzen möchten, sei es im Studium, im Beruf oder im Alltag. Es bietet eine klare Struktur, verständliche Erklärungen und zahlreiche Beispiele, die das komplexe Thema zugänglich machen und ein tiefes Verständnis fördern. Ergreifen Sie die Chance, Ihr Wissen im Bereich Recht zu erweitern und sich in der deutschen Rechtsordnung sicher zu bewegen. Lassen Sie sich von der Klarheit und Präzision dieses Buches überzeugen und meistern Sie die Herausforderungen des Rechts mit Bravour. Ob Strafrecht, Ordnungswidrigkeiten oder Verwaltungsrecht – hier finden Sie die Antworten, die Sie suchen. Ein Wegweiser durch den Paragraphen-Dschungel, der Ihnen hilft, Ihre Rechte und Pflichten zu verstehen und erfolgreich durchzusetzen.
Rechtskunde
Allgemeine Begriffsbestimmungen: unbestimmter Rechtsbegriff: wie z.B. bedeutend, geringfügig, erheblich etc., dabei hat man je nach Argumentation einen Beurteilungsspielraum, aber es muß dann eine logische Beantwortung mit ja oder nein möglich sein. (Ist die Einwirkung erheblich? Ja, weil ) Strafrecht: (StGB)
Justizgewährungsanspruch -> d.h. Gerichte müssen entscheiden (wg. Verbot der Selbstjustiz)
materielles Recht -> d.h. rechtliche Beziehung zwischen Rechtssubjekten (also Menschen und juristischen Personen)
oder Rechtssubjekten und Rechtsobjekten (also Sachen und Forderungen) formelles Recht -> d.h. Rechtsdurchsetzungsrecht = Prozeßrecht
genaue Abgrenzung für öffentliches Recht -> d.h. entscheidend ist, daß min. einer der am Rechtsverhältnis Beteiligten
in seiner Eigenschaft als Hoheitströger handelt
Subsumtion -> ist die Prüfung ob ein konkreter Lebenssachverhalt unter eine abstrakte gesetzliche Regelung paßt (bei
S. ist das Gesetz auszulegen -> grammatikalische (Wortauslegung) und teleologische (logische d.h.
Sinn und Zweck einer Rechtsnorm)
Analogie -> bei einer Gesetzeslücke, Frage: paßt ein ähnlicher Rechtssatz? Umkehrschluß -> spricht eine bewußte Gesetzeslücke gegen Analogie
Spezialprävention -> Sühne für begangenes Unrecht; Besserung und Sicherung des Einzelnen
Generalprävention -> Abschreckung der Allgemeinheit vor Straftaten
Die Straftat, deren Rechtsfolge Strafe ist, setzt folgende Dinge voraus: (siehe auch unten)
- Tatbestandsmäßigkeit -> d.h. die Handlung eines Menschen paßt auf die Umschreibung einer Vorschrift des beson-
deren Teils des StGB
-Handlung und Erfolg -> d.h. willensgetragenes menschliches Verhalten mit Außenwirkung; bei Erfolgsdelikten
muß zwischen Handlung und tatbestandsmäßigen Erfolg eine Verknüpfung bestehen: ein Kausalzusammen-
hang; kausal ist jede Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne daß der Erfolg entfällt
-> Äquivalenztheorie
- Rechtswidrigkeit -> d.h. tatbestandsmäßiges Handeln widerspricht der Rechtsordnung (Rechtswidrigkeit fehlt aus-
nahmsweise bei Vorliegen von Rechtfertigungsgründen -> Notwehr, Notstand etc.)
- Schuld -> Vorwerfbarkeit des Fehlverhaltens i.d.R. muß diese vorsätzlich sein; Schuldform ist "fahrlässig", "grob
fahrlässig", "vorsätzlich" etc. Schuldformen:
Vorsatzschuld -> setzt Wissen und Wollen der Tat voraus
Fahrlässigkeitsschuld -> es fehlt das Wissen, min. aber das Wollen
Unbewußte Fahrlässigkeit -> täter sieht nicht vorher was durch seine Handlung passieren kann
Bewußte Fahrlässigkeit -> täter hofft dabei auf das Ausbleiben des Erfolgs
Grobe Fahrlässigkeit = Leichtfertigkeit -> handelt nicht (bzw. darf nicht vorsätzlich handeln
Tateinheit (Idealkonkurrenz) -> durch eine Handlung werden mehrere Tatbestände oder derselbe Tatbestand
mehrfach verletzt § 52
Tatmehrheit (Realkonkurrenz) -> mehrere selbständige Handlungen verletzen mehrere Strafgesetze
-> Aspirationsprinzip -> mehrere Einzelstrafen werden gebildet; die h"chste Einzelstrafe wird herausgenommen und
angemessen erhäht
Antragsdelikte -> Delikte, die nur auf Antrag verfolgt werden
Strafantrag -> antragsberechtigt ist grundsätzlich der Verletzte
Strafanzeige -> jeder - bei allen möglichen Delikten kann Strafanzeige erstatten
Aufbau und Vorraussetzungen einer Straftat bzw. dem Zustandekommen einer Verurteilung nach dem Strafgesetz:
Strafprozeßrecht: (StPO)
Offizialprinzip -> Staatsanwaltschaft wird von Amtswegen tätig (d.h. Verfolgung von Straftaten durch den Staat
§ 152 I Ermittlungsaufgabe von Staatsanwalt und Polizei
Legalitätsprinzip -> Staatsanwalt ist zur Aufklörung und Klageerhebung verpflichtet § 152 II
Opportunitätsprinzip -> es erfolgt die Verfolgung und Ausübung - im Gegensatz zum Legalitäts-
prinzip - nach pflichtgemäßen Ermessen d.h. keine Willkür, Beachtung des Gleichheits-
grundsatzes § 47 OWiG (O. findet grundsätzlich Anwendung bei OWi's)
grundsätzlich wird das Legalitätsprinzip angewendet; Ausnahmen bilden § 153 ff = Opportunitätsprinzip
förmliche Rechtsmittel:
Berufung -> vor einem häheren Gericht eine Neuauflage der I. Instanz (Sachverhalt)
Revision -> es geht nur um Rechtsfragen: rechtlicher Schluß und Prozeßfehler kännen angefochten werden
Weitere Grunds"tze der Verfahrensführung:
Untersuchungsgrundsatz: das Gericht sucht selbst nach der Wahrheit und ist an Beweismittel nicht gebunden
§ 155 II und § 244 II (im Gegensatz zu einem Zivilprozeß, in dem die Parteien Vorschlöge unterbreiten und das Gericht nur darüber entscheidet) Unmittelbarkeit: alle Beteiligten müssen immer anwesend sein öffentlichkeit: Hauptverhandlungen in Strafsachen sind grundsätzlich öffentlich Beweisgrundsatz: "in dubio pro reo" (im Zweifelsfalle für den Angeklagten) Rechtliches Gehör: der Angeklagte muß stets gehört werden
Ablauf: Ermittlungsverfahren § 160 -> Einreichung der Anklageschrift § 170 I (oder Einstellung durch den Staats-
anwalt § 170 II -> Zwischenverfahren § 203 (Entscheidung über Einstellung § 153 ff oder Hauptverfahren)
-> Hauptverfahren vor Gericht mit Hauptverhandlung und dem Urteil als Abschluß
Hilfsbeamte -> neben der Polizei haben auch Forstbetriebsbeamte (Baden-Württemberg) die Verpflichtung den An-
ordungen der Staatsanwaltschaft Folge zu leisten (Revierleiter sind auch jagdliche
Hilfsbeamte B.-W.)
keine Hilfsbeamten sind Forstamtsleiter! Legalitätsprinzip Konsequenz bei der Stellung als Hilfsbe-
amter ist dabei auch wenn Gefahr im Verzug ist Untersuchungsmittel zu Verfügung stehen, die sonst
nur dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft zustehen (Durchsuchung § 105, Beschlagnahme § 98,
körperliche Untersuchung des Beschuldigten oder Unverdächtigen §§ 81a, 81c etc.) Anwendung in
der Praxis nicht besonders relevant.
Recht der Ordunugswidrigkeiten (OWiG):
Forstlich relevante OWi's: §§ 83 ff (Waldbesucher), §§ 83 III,84 (Waldbesitzer) LWG von B.-
W.
OWi's sind nach ihrer Definition Handlungen, die keinen Verstoß gegen ethische Grundwerte und kein kriminelles
Unrecht darstellen. Sie sind abgegrenzt zur Straftat: OWi's sind eine rechtswidrige, vorwerfbare Handlung in šberein-
stimmung mit dem Tatbestand eines Gesetzes, dessen Ahndung mit einer Geldstrafe (Geldbuße oder Verwarnung) bedroht ist.
Zunächst Zuständigkeit von Verwaltungsbehörden. Verwaltung ist immer Exekutive!
Ablauf: 1. Verwarnung §§ 56,57: bei geringfügigen OWi's (mündlich durch Beamten (Revierleiter) oder schriftlich
durch Behörde (Forstamt)) oder 1.1 Einstellung: (erledigt) oder 1.2 Anhörung: (Einstellung oder Bußgeld-
bescheid weiter bei 3.); 2. Verwarnung wird bezahlt: (erledigt und kann nicht mehr als OWi
verfolgt wer-
den); 2.1 Ablehnung der Verwarnung: oder keinen geringfügigen OWi (Bußgeldbescheid); 3. förmliches
Bußgeldverfahren § 66: (Annahmeanordnung ans LOK) oder 3.1 Einspruch: innerhalb von 2 Wochen (Ab-
gabe des Verfahrens an die Staatsanwaltschaft oder Behörde nimmt Bescheid zurück und erläßt evtl. einen
neuen); 4. Abgabe an die Staatsanwaltschaft: (Amtsgericht) oder Rückgabe an die letzte Behörde wg. Ermit-
tlungsmängel) 5. Amtsgericht: (Hauptverhandlung oder Rückgabe an die letzte Behörde wg. Ermittlungs-
mängel) 6. Hauptverhandlung: 6.1 Freispruch oder 6.2 Geldbuße: (bezahlt oder u.U. Rechtsbeschwerde
beim OLG) oder 6.3 Nebenfolge: (Befolgung oder wieder u.U. Rechtsbeschwerde beim OLG) oder 6.4 Ein-
stellung des Verfahrens: (evt. wieder u.U. mit Rechtsbeschwerde beim OLG); 7. Rechtsbeschwerde beim
OLG: 7.1 Verwerfung: (Rechtsbeschwerde gilt als zurückgenommen oder 7.2 wird zugelassen: Neuauf-
wicklung des Verfahrens)
Kosten von Verwarnungen und Geldbußen: Verwarnung: min. DM 10,- max. DM 75,- keine Gebühren
Geldbuße: min. DM 10,- Gebühr 5% von der Geldbuße, min. aber DM 25,- und z.Zt. DM 11,- Zustellkosten
Bußgeldbescheid besteht formell aus: 1. Sachverhalt, 2. Beweismitteln, 3. Geldbuße und
Kosten und 4. Ordnungswi-
drigkeit (Gesetzestext)
Aufbau von OWi's: keine Ahndung ohne Gesetz § 1, Begehen durch Unterlassen § 8, Vorsatz und Fahrlässigkeit
§ 10, Notwehr u. Notstand §§ 15/16, Tatumstands- u. Verbotsirrtum § 11, Rücktritt § 13 III
Vereinfachung im Ggs. zum Strafrecht durch: Verantwortlichkeit des Nichterwachsenen § 12, Versuch stets nur Buß-
geldbewährt § 13 II, Einheitstäterbegriff! § 14, kürzere Verjährung
Zuständigkeit (nach § 85 LWG): in B.-W. bei Verstäßen der Waldbesucher und § 83 III das Forstamt; bei Ver-
stäßen der Waldbesitzer § 83 III, 84 die Forstdirektion
Zusammentreffen von OWi und Straftat: Bei Tateinheit § 19 von OWi und Straftat wird nur das Strafgesetz angewen-
det § 21. Die Sache ist also an die Staatanwaltschaft abzugeben. Wird der Tatverdacht der Straftat abgelehnt, ist es noch möglich eine Abrügung nach § 21 geltend zu machen, vorausgesetzt es handelt sich um keinen Freispruch § 84.
Verwarnung und Straftat: Wenn eine Verwarnung schon durchgeführt wurde, aber die Straftat gewertet wird, kann
trotz erteilter Verwarnung ein Strafverfahren durchgeführt werden; anders wenn Owi: nach erteilter Verwarnung kann kein Bußgeldbescheid mehr erfolgen
Revierleiter: er ist verpflichtet, festzustellen, zu verfolgen und Fortsetzungen zu verhindern sowie dem FA Owi's an-
zuzeigen (dabei handelt es sich um Vorschriften nach § 83 LWG, NaturschutzG, AbfallG,
FischereiG,
§§ 118, 111, 120 und 121 OWiG sowie um die Landesbauordnung) Polizeirecht: (PolG)
Definition: 1. Gefahrenabwehr, also den Einzelnen und das Gemeinwesen vor drohender
Verletzung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung zu schützen -> präventive Sicherheit und Störungen zu beseitigen -> repressive tätigkeit
Generalklausel §§ 1,3
Gefahr: Zustand, der erkennbar die objektive Möglichkeit eines Schadens enthält öffentliche Sicherheit: Schutz vor Schäden in Bezug auf Staat, dem Einzelnen
Es gibt allgemeine und besondere Polizeibehörden; den besonderen Polizeibehörden sind spezielle Polizeiaufgaben
übertragen (z.B. Gesundheitsämter, Gewerbeaufsichtsämter, Eichämter, Forstbehörden (auf dem Gebiet der Forstauf-
sicht -> Verstäße der Waldbesitzer und des Forstschutzes -> Verstäße der Waldbesucher). Der Revierleiter hat somit
die Funktion eines Polizeivollzugsbeamten (Forstschutzbeauftragter). Er kann als Vollzugsorgan über die polizeilichen
Anordnungen des FA hinaus selbständig polizeilich notwendige Anordnungen treffen ("Gefahr in Verzug"). Zustän-
digkeit siehe unter § 82 LWG D.h. bei Störungen (Handlungs- u. Zustandsstörer) kann der Revierleiter nach pfichtge-
mäßen Ermessen Maßnahmen ergreifen, um diese Störungen zu unterbinden (Opportunitätsprinzip) und Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz (Nachteil darf nicht außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg stehen)!
(siehe auch oben unter
Revierleiter!)
Handlungs- und (Verhaltens-) störer § 6
Zustandsstörer § 7 -> Inhaber oder Gewalthaber einer Sache, durch deren Zustand die öffentliche Sicherheit und
Ordnung gefährdet ist
Anscheinstörer -> Maßnahmen des Vollzugsbeamten sind rechtmäßig Scheinstörer -> Maßnahmen des Vollzugsbeamten sind rechtswidrig
Schuldhaftes Handeln: strafrechtliche und zivilrechtliche Verantwortlichkeit sind für die Polizeipflichtigkeit nicht er-
forderlich
Nichtstörer § 9 -> Inanspruchnahme von Hilfe von Dritten (polizeilicher Notstand) gegen Entschädigung (z.B. Polizist
leiht sich Fahrrad zur Verfolgung eines Diebes
Unmittelbare Ausführung § 8 -> einer Maßnahme, wenn Polizeipflichtiger (z.B. Waldbesitzer ) nicht kann (ist z.B.
gerade verreist) durch die Polizei selber oder Beauftragte gegen Kostenerstattung (Polizeizwang dann, wenn Poizeipflichtiger nicht will) Wichtige Gesetze neben den vorher schon genannten:
- Personenfeststellung Durchsuchung von Personen und Sachen §§ 26, 29, 30
- Sicherstellung von Sachen zugunsten des Eigentümers § 32
- Beschlagnahme § 33
- Unmittelbarer Zwang §§ 50 ff
- Schußwaffengebrauch §§ 53 ff
Kompetenz des Polizeivollzugsdienstes: uniformierte Polizisten haben die selben Befugnisse im Wald wie Revierleiter
eine Ahndung auf Verdacht: widerspricht dem Verantwortungsprinzip Bsp.: Kennzeichenanzeigen bei denen zwar der
halter nicht unbedingt, aber der Fahrer gefunden wird
Spezialfälle: Feuer im bzw. am Wald: OWi: wenn ohne Genehmigung des FA Feuer angezündet wird § 41 mit § 83 I
LWG; Straftat: konkrete Brandgefahr: dabei muß der Tatbestand dieser Straftat - wie z.B. Feuer in
Dickung - erfüllt sein § 306 f StGB, Brandstiftung: sobald durch ein Feuer Wald oder Teile davon in
Brand gesetzt sind §§ 306, 306 d StGB
Trunkenheit im Verkehr: unter 0,5 Promille erlaubt; OWi: wenn Alkoholspiegel > 0,5 - 1,09 Promille
und korrekte Fahrweise und Straftat nach § 316 StGB bei 1,1 und mehr Promille und korrekter Fahrweise
und bei > 0,5 - 1,09 und nicht korrekter Fahrweise Verwaltungsrecht VwVfG und VwGO
Die Verwaltung handelt mit der Figur des Verwaltungsaktes § 35 VwVfG. Gebundene Verwaltung: Tätigkeitszwang (z.B. § 15 LWG) Frei Verwaltung: Ermessensfreiraum (§ 40 VwVfG)
Begriff der kollegialen Behörde: Entscheidungen treffen mehrere d.h. Abgeordnete der
Gemeinden und Staatsbedienstete
gemeinsam, im Gegensatz zur Verwaltungsbehörde (z.B. das Forstamt), in der nur der Forstamtsleiter "das Sagen hat" Bsp. für kollegiale Behörden: Körperschaftsdirektionen und Kreisjagdämter
Bestandteile des Verwaltungsaktes: 1. erster, verfügender Teil (Teuor) der Betreff; 2. Begründung; 3. Rechts-
mittelbelehrung -> bedarf einer Rechtsgrundlage d.h. Legitimation oder Erm"chtigungsgrundlage
Arten von Verwaltungsakten:
- begünstigender
- Mitwirkungsbedürftiger
- rechtsgestaltende und feststellende
- zweiseitiger
- belastender etc.
Anfechtbarkeit von Verwaltungsakten: ohne Widerspruch oder Klage wird der Verwaltungsakt nach Ablauf der Wider-
spruchs- bzw. Klagefrist (1 Monat = 30 Tage) unanfechtbar und damit bestandskräftig
Evidenzprinzip: = Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes § 44 I, III (wenn er z.B. aus tatsächlichen Gründen nicht ausführbar
ist, oder wegen Fehlerhaftigkeit oder Nichtausstellung einer Urkunde). Widerspruch bei Nichtigkeit
bedeutet "juristisches Nullum"; Widerspruch bei Fehlerhaftigkeit oder bei juristischem
Wehren mit Hilfe
eines Rechtsanwalts gegen den Verwaltungsakt bedeutet Anfechtbarkeit §§ 68 ff VwGO
Bedingungen unter denen ein Verwaltungsakt anfechtbar wird § 35 VwVfG: Es muß ein belastender Einzelfall sein, in dem
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein unbestimmter Rechtsbegriff?
Ein unbestimmter Rechtsbegriff ist ein Begriff, der einen Beurteilungsspielraum eröffnet, z.B. "bedeutend", "geringfügig" oder "erheblich". Eine logische Beantwortung mit Ja oder Nein muss aber möglich sein.
Was ist der Justizgewährungsanspruch?
Der Justizgewährungsanspruch bedeutet, dass Gerichte entscheiden müssen (wegen des Verbots der Selbstjustiz).
Was unterscheidet materielles und formelles Recht?
Materielles Recht regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Rechtssubjekten (Menschen und juristischen Personen) oder zwischen Rechtssubjekten und Rechtsobjekten (Sachen und Forderungen). Formelles Recht ist das Rechtsdurchsetzungsrecht, also das Prozessrecht.
Wie grenzt man öffentliches Recht ab?
Entscheidend für öffentliches Recht ist, dass mindestens einer der am Rechtsverhältnis Beteiligten in seiner Eigenschaft als Hoheitsträger handelt.
Was bedeutet Subsumtion?
Subsumtion ist die Prüfung, ob ein konkreter Lebenssachverhalt unter eine abstrakte gesetzliche Regelung passt. Dabei ist das Gesetz auszulegen (grammatikalisch und teleologisch).
Was ist Analogie im Recht?
Analogie wird bei einer Gesetzeslücke angewendet, wobei geprüft wird, ob ein ähnlicher Rechtssatz passt. Ein Umkehrschluss kann gegen eine Analogie sprechen.
Was sind Spezial- und Generalprävention?
Spezialprävention ist die Sühne für begangenes Unrecht sowie die Besserung und Sicherung des Einzelnen. Generalprävention ist die Abschreckung der Allgemeinheit vor Straftaten.
Welche Voraussetzungen muss eine Straftat erfüllen?
Eine Straftat setzt Tatbestandsmäßigkeit, Handlung und Erfolg (mit Kausalzusammenhang), Rechtswidrigkeit (außer bei Rechtfertigungsgründen) und Schuld voraus.
Was sind die verschiedenen Schuldformen im Strafrecht?
Es gibt Vorsatzschuld (Wissen und Wollen der Tat) und Fahrlässigkeitsschuld (fehlendes Wissen oder Wollen). Fahrlässigkeit kann unbewusst oder bewusst sein. Grobe Fahrlässigkeit wird auch als Leichtfertigkeit bezeichnet.
Was ist Tateinheit und Tatmehrheit?
Tateinheit (Idealkonkurrenz) liegt vor, wenn durch eine Handlung mehrere Tatbestände oder derselbe Tatbestand mehrfach verletzt werden. Tatmehrheit (Realkonkurrenz) liegt vor, wenn mehrere selbstständige Handlungen mehrere Strafgesetze verletzen. Bei Tatmehrheit kommt das Aspirationsprinzip zur Anwendung.
Was sind Antragsdelikte?
Antragsdelikte sind Delikte, die nur auf Antrag verfolgt werden. Antragsberechtigt ist grundsätzlich der Verletzte.
Was ist der Unterschied zwischen Strafantrag und Strafanzeige?
Ein Strafantrag kann nur vom Verletzten gestellt werden, während eine Strafanzeige von jeder Person bei allen möglichen Delikten erstattet werden kann.
Was sind die Grundsätze des Strafprozessrechts?
Die Grundsätze des Strafprozessrechts sind das Offizialprinzip (Staatsanwaltschaft wird von Amts wegen tätig), das Legalitätsprinzip (Staatsanwalt ist zur Aufklärung und Klageerhebung verpflichtet) und das Opportunitätsprinzip (Verfolgung nach pflichtgemäßem Ermessen). Weitere Grundsätze sind der Untersuchungsgrundsatz, die Unmittelbarkeit, Öffentlichkeit, der Beweisgrundsatz ("in dubio pro reo") und das rechtliche Gehör.
Was ist der Unterschied zwischen Berufung und Revision?
Die Berufung ist vor einem höheren Gericht eine Neuauflage der ersten Instanz (Sachverhalt). Bei der Revision geht es nur um Rechtsfragen: rechtlicher Schluss und Prozessfehler können angefochten werden.
Was sind Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft?
Neben der Polizei haben auch Forstbetriebsbeamte (in Baden-Württemberg) die Verpflichtung, den Anordnungen der Staatsanwaltschaft Folge zu leisten. Revierleiter sind auch jagdliche Hilfsbeamte. Forstamtsleiter sind keine Hilfsbeamten.
Was sind Ordnungswidrigkeiten (OWi)?
Ordnungswidrigkeiten sind Handlungen, die keinen Verstoß gegen ethische Grundwerte und kein kriminelles Unrecht darstellen. Sie sind rechtswidrige, vorwerfbare Handlungen in Übereinstimmung mit dem Tatbestand eines Gesetzes, dessen Ahndung mit einer Geldstrafe bedroht ist.
Wie läuft ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ab?
Der Ablauf eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens umfasst Verwarnung, Anhörung, Bußgeldbescheid, Einspruch, Abgabe an die Staatsanwaltschaft (Amtsgericht), Hauptverhandlung (mit Freispruch, Geldbuße, Nebenfolge oder Einstellung des Verfahrens) und Rechtsbeschwerde beim OLG.
Was ist das Legalitätsprinzip im Zusammenhang mit Hilfsbeamten?
Das Legalitätsprinzip im Zusammenhang mit Hilfsbeamten bedeutet, dass bei Gefahr im Verzug Untersuchungsmittel zur Verfügung stehen, die sonst nur dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft zustehen (z.B. Durchsuchung, Beschlagnahme, körperliche Untersuchung).
Welche Kosten entstehen bei Verwarnungen und Geldbußen?
Verwarnungen kosten mindestens DM 10,-, maximal DM 75,- ohne Gebühren. Geldbußen kosten mindestens DM 10,-, zuzüglich einer Gebühr von 5% der Geldbuße (mindestens aber DM 25,-) und Zustellkosten (z.Zt. DM 11,-).
Welche Zuständigkeiten gibt es bei Ordnungswidrigkeiten im Forstbereich in Baden-Württemberg?
Bei Verstößen der Waldbesucher (§ 83 LWG) ist das Forstamt zuständig, bei Verstößen der Waldbesitzer (§ 83 III, 84 LWG) die Forstdirektion.
Was passiert bei Zusammentreffen von OWi und Straftat?
Bei Tateinheit von OWi und Straftat wird nur das Strafgesetz angewendet (§ 21 OWiG). Die Sache ist an die Staatsanwaltschaft abzugeben.
Was ist das Polizeirecht?
Das Polizeirecht dient der Gefahrenabwehr (Schutz vor drohender Verletzung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung) und der Beseitigung von Störungen. Grundlage ist die Generalklausel (§§ 1, 3 PolG).
Was ist der Unterschied zwischen Handlungs- und Zustandsstörer?
Handlungsstörer verursachen eine Gefahr durch ihr Verhalten. Zustandsstörer sind Inhaber oder Gewalthaber einer Sache, durch deren Zustand die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist.
Was sind die Kompetenzen des Polizeivollzugsdienstes im Wald?
Uniformierte Polizisten haben die selben Befugnisse im Wald wie Revierleiter.
Was ist die Bedeutung des Verwaltungsaktes?
Die Verwaltung handelt mit der Figur des Verwaltungsaktes (§ 35 VwVfG). Es gibt gebundene Verwaltung (Tätigkeitszwang) und freie Verwaltung (Ermessensfreiraum).
Was sind die Bestandteile eines Verwaltungsaktes?
Die Bestandteile eines Verwaltungsaktes sind: 1. Verfügender Teil (Tenor) der Betreff; 2. Begründung; 3. Rechtsmittelbelehrung.
Unter welchen Bedingungen wird ein Verwaltungsakt anfechtbar?
Ein Verwaltungsakt wird anfechtbar, wenn es sich um einen belastenden Einzelfall handelt, in dem etwas nach außen hin wirksam geregelt ist und von einer Verwaltungsbehörde erlassen wurde (§ 35 VwVfG).
Was bedeutet Bestandskraft eines Verwaltungsaktes?
Ohne Widerspruch oder Klage wird der Verwaltungsakt nach Ablauf der Widerspruchs- bzw. Klagefrist (1 Monat = 30 Tage) unanfechtbar und damit bestandskräftig.
- Quote paper
- Michael Müller (Author), 2000, Rechtskunde. Erklärung der wichtigsten Rechtsbegriffe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96208