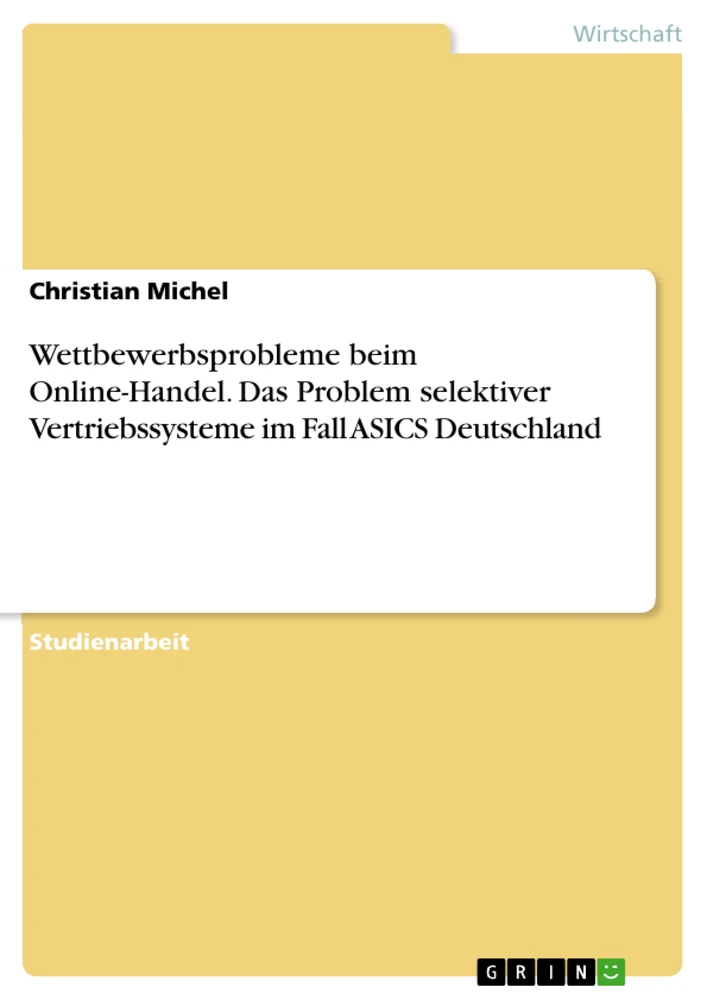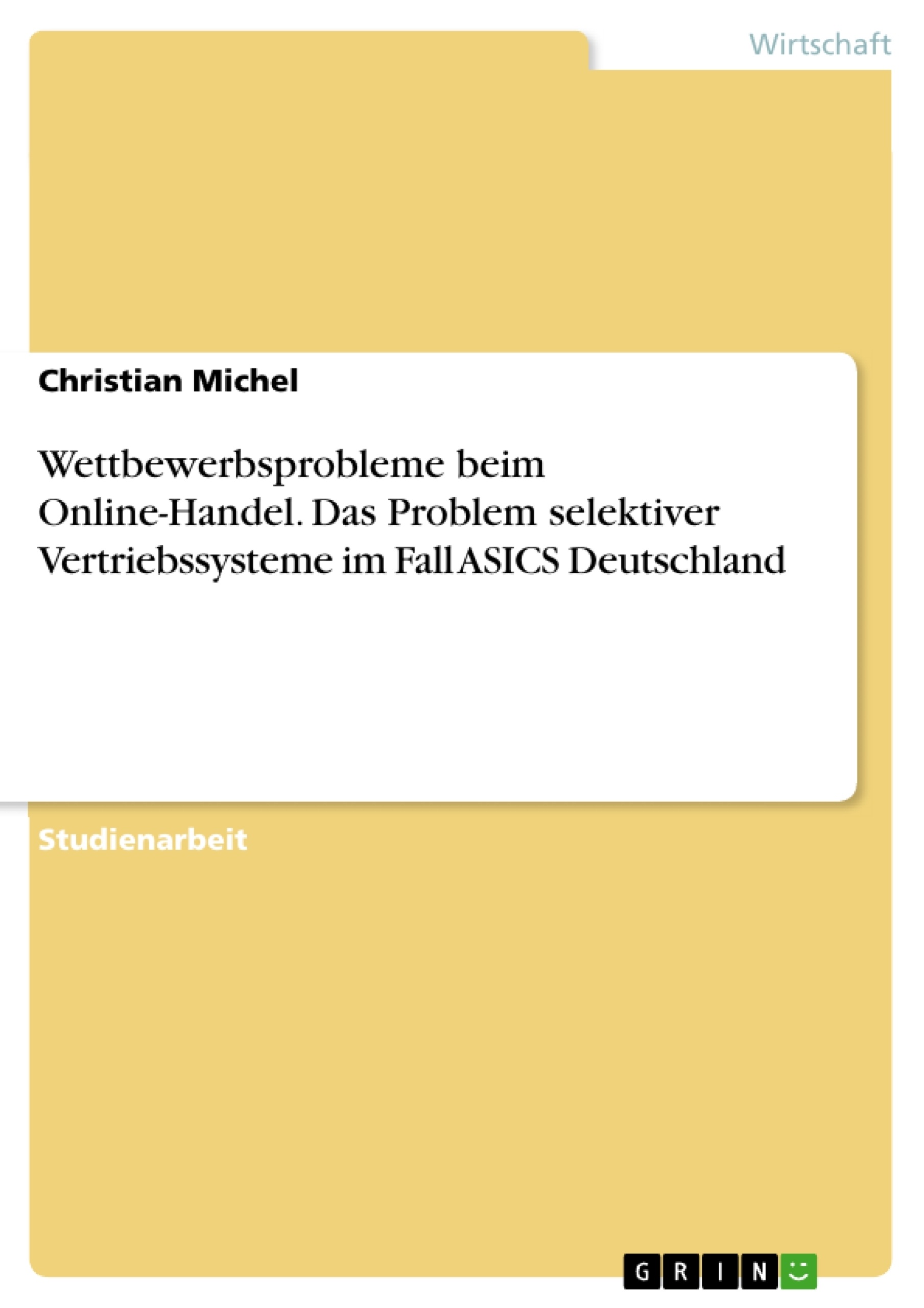In der Arbeit werden ökonomische Theorien, der rechtliche Rahmen und die Auswirkungen von vertikalen Vereinbarungen, wobei der Fokus hier auf selektiven Vertriebssystemen liegt, analysiert.
Ein passendes Beispiel im Bereich dieses Themenfeldes ist der ASICS-Fall, zu dem am 26.08.2015 das Bundeskartellamt ein Urteil gefällt hat. In diesem Urteil wurde im Zusammenhang mit den von dem Hersteller auferlegten Vertriebsbeschränkungen eine Kartellrechtswidrigkeit festgestellt. Es empfiehlt sich, diesen Fall vor dem Hintergrund der ökonomischen Effekte für alle Beteiligten zu untersuchen, um die jeweiligen Rechtsauffassungen der verschiedenen Akteure sowie die des Bundeskartellamtes nachvollziehen zu können.
Aufgrund der rasanten Verbreitung des Internets und der damit einhergehenden wachsenden Bedeutung des Internetvertriebs kommen aktuell eine Vielzahl wettbewerbsrechtlicher Fragen auf die europäische Wirtschaftspolitik zu.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vertikale Vereinbarungen
- Gründe für vertikale Vereinbarungen
- Wettbewerbsbeschränkungen durch vertikale Vereinbarungen
- Selektive Vertriebssysteme
- Wettbewerbspolitische Haltung gegenüber selektiven Vertriebssystemen
- Gesetzesgrundlage
- Der Fall ASICS Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung analysiert ökonomische Theorien, den rechtlichen Rahmen und die Auswirkungen vertikaler Vereinbarungen, insbesondere selektiver Vertriebssysteme, am Beispiel des ASICS-Falls. Die Zielsetzung ist es, die wettbewerbsrechtlichen Fragen im Online-Handel zu beleuchten und die Entscheidung des Bundeskartellamtes zu verstehen.
- Vertikale Vereinbarungen und ihre ökonomischen Auswirkungen
- Selektive Vertriebssysteme im Online-Handel
- Wettbewerbsrechtliche Beurteilung vertikaler Beschränkungen
- Der ASICS-Fall als Beispiel für wettbewerbswidrige Praktiken
- Die Rolle des Bundeskartellamtes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der wettbewerbsrechtlichen Fragen im Online-Handel ein und benennt den Fokus auf vertikale Vereinbarungen, speziell selektive Vertriebssysteme. Der ASICS-Fall wird als praxisrelevantes Beispiel eingeführt, das die Notwendigkeit einer ökonomischen und rechtlichen Analyse dieser Thematik unterstreicht. Der Zusammenhang mit dem Seminar „Aktuelle Probleme der europäischen Wettbewerbspolitik“ wird hergestellt.
Vertikale Vereinbarungen: Dieses Kapitel definiert vertikale Vereinbarungen im Gegensatz zu vertikalen Zusammenschlüssen und hebt die Bedeutung des Kooperationsklimas zwischen den beteiligten Unternehmen hervor. Es wird die vorherrschende wettbewerbspolitische Ansicht dargelegt, dass vertikale Vereinbarungen oft zu Effizienzsteigerungen führen. Der Fokus liegt auf dem Produzenten-Händler-Verhältnis, wie es im ASICS-Fall zu finden ist.
Gründe für vertikale Vereinbarungen: Dieser Abschnitt präsentiert verschiedene ökonomische Anreize für vertikale Vereinbarungen, wie z.B. die Vermeidung von Hold-up-Problemen, Kostenreduktion und Förderung von Innovationen. Die Ausgestaltung von Marktmacht und Investitionen in die Markterschließung, insbesondere "Sunk Costs", werden diskutiert. Die Möglichkeit des Alleinvertriebs und die damit verbundenen Vor- und Nachteile (Monopolstellung, Effizienz- und Wohlfahrtsverluste) werden ebenfalls betrachtet. Die Reduzierung vertikaler Externalitäten wird als ein wesentlicher Vorteil hervorgehoben.
Wettbewerbsbeschränkungen durch vertikale Vereinbarungen: Trotz der potenziellen Vorteile werden die wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen missbräuchlicher vertikaler Vereinbarungen erläutert. Es wird auf die negativen Folgen für die Konsumenten hingewiesen, wie steigende Preise und reduzierte Qualität, Auswahl und Innovation. Das Ziel der Unternehmen, die eigene Marktposition zu verbessern und Gewinne zu maximieren, wird als Motiv für solche Praktiken genannt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse vertikaler Vereinbarungen am Beispiel des ASICS-Falls
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung analysiert vertikale Vereinbarungen, insbesondere selektive Vertriebssysteme, unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten. Der Fall ASICS Deutschland dient als praxisrelevantes Beispiel zur Beleuchtung wettbewerbsrechtlicher Fragen im Online-Handel und zur Interpretation der Entscheidung des Bundeskartellamtes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Ausarbeitung behandelt ökonomische Theorien zu vertikalen Vereinbarungen, den rechtlichen Rahmen, die Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Rolle des Bundeskartellamtes. Schwerpunkte sind die ökonomischen Auswirkungen vertikaler Vereinbarungen, selektive Vertriebssysteme im Online-Handel, die wettbewerbsrechtliche Beurteilung vertikaler Beschränkungen und die Analyse des ASICS-Falls als Beispiel für potenziell wettbewerbswidrige Praktiken.
Welche Kapitel umfasst die Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu vertikalen Vereinbarungen (inkl. Gründen und wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen), ein Kapitel zu selektiven Vertriebssystemen, die wettbewerbspolitische Haltung dazu, die Gesetzesgrundlage und eine detaillierte Fallstudie zum ASICS-Fall.
Was sind vertikale Vereinbarungen und warum werden sie geschlossen?
Vertikale Vereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen unterschiedlicher Produktions- oder Vertriebsstufen (z.B. Hersteller und Händler). Gründe für den Abschluss solcher Vereinbarungen sind die Vermeidung von Hold-up-Problemen, Kostenreduktion, Förderung von Innovationen, Reduzierung vertikaler Externalitäten und die Ausgestaltung von Marktmacht und Investitionen (inkl. "Sunk Costs"). Auch Alleinvertrieb mit den damit verbundenen Vor- und Nachteilen (Monopolstellung, Effizienz- und Wohlfahrtsverluste) wird thematisiert.
Welche wettbewerbsrechtlichen Probleme können durch vertikale Vereinbarungen entstehen?
Trotz potenzieller Vorteile können vertikale Vereinbarungen wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen haben, z.B. durch steigende Preise, reduzierte Qualität, Auswahl und Innovation für Konsumenten. Unternehmen können diese Vereinbarungen nutzen, um ihre Marktposition zu verbessern und Gewinne zu maximieren.
Welche Rolle spielt der ASICS-Fall in dieser Ausarbeitung?
Der ASICS-Fall dient als Fallstudie, um die theoretischen Überlegungen zu vertikalen Vereinbarungen und selektiven Vertriebssystemen zu konkretisieren und anhand eines realen Beispiels zu veranschaulichen. Die Entscheidung des Bundeskartellamtes wird analysiert und im Kontext der wettbewerbsrechtlichen Fragen im Online-Handel eingeordnet.
Was ist die Zielsetzung der Ausarbeitung?
Die Zielsetzung ist es, die wettbewerbsrechtlichen Fragen im Online-Handel zu beleuchten und die Entscheidung des Bundeskartellamtes im ASICS-Fall zu verstehen, indem ökonomische Theorien und der rechtliche Rahmen analysiert werden.
Welche Schlüsselbegriffe werden behandelt?
Schlüsselbegriffe umfassen vertikale Vereinbarungen, selektive Vertriebssysteme, Online-Handel, Wettbewerbsrecht, Bundeskartellamt, ASICS-Fall, ökonomische Auswirkungen, wettbewerbsbeschränkende Praktiken, Hold-up-Problem, "Sunk Costs", und Effizienzsteigerungen.
- Quote paper
- Christian Michel (Author), 2018, Wettbewerbsprobleme beim Online-Handel. Das Problem selektiver Vertriebssysteme im Fall ASICS Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/961255