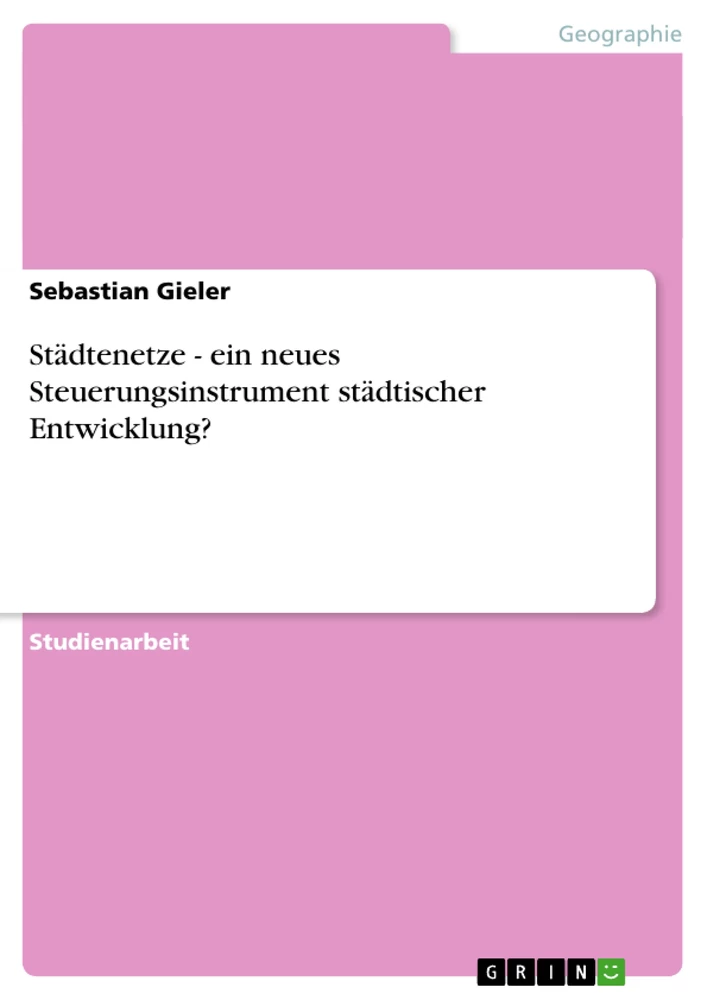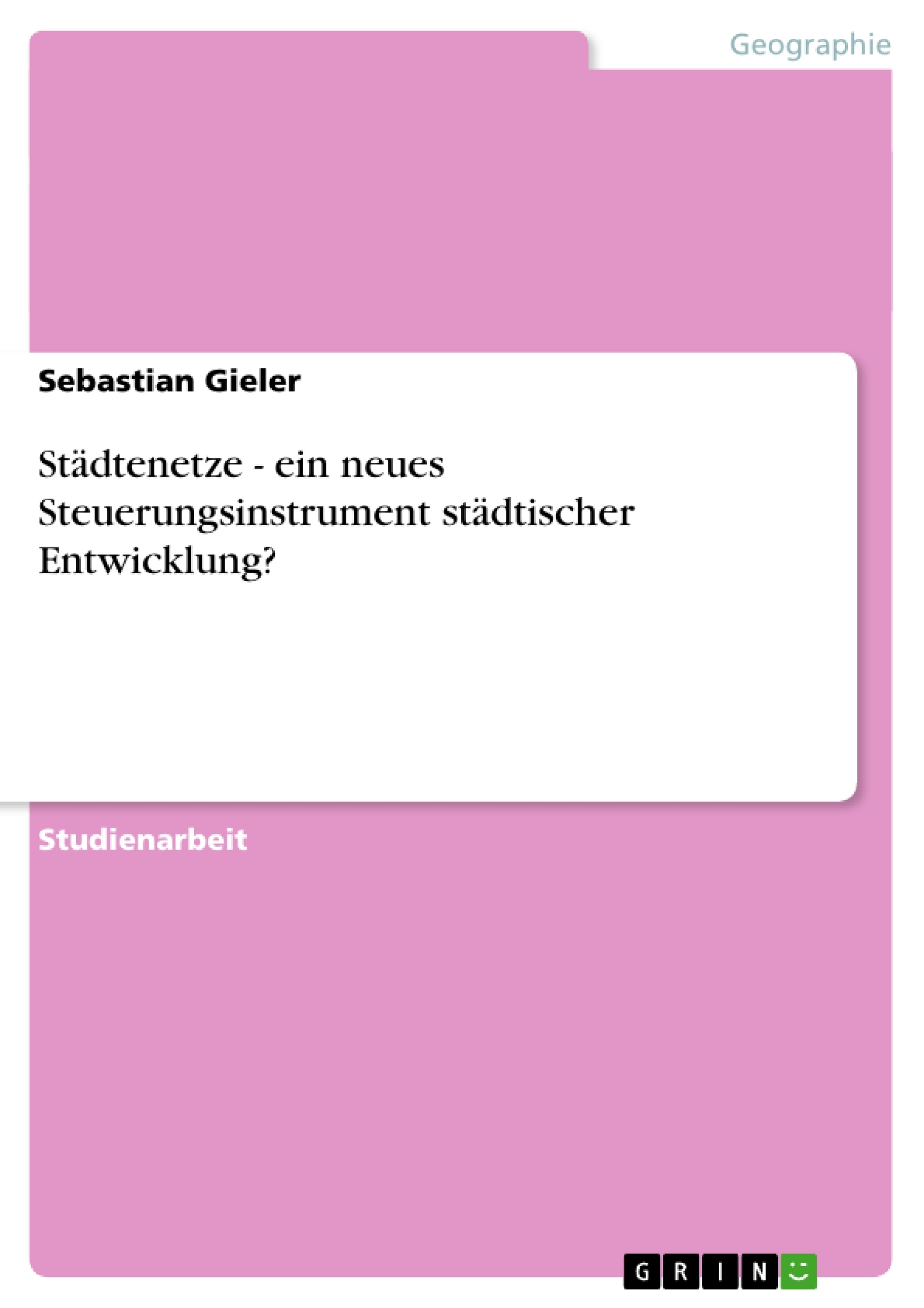Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Städte nicht länger isoliert existieren, sondern sich zu dynamischen Netzwerken verbinden, um gemeinsam Herausforderungen zu meistern und neue Möglichkeiten zu erschließen. Diese tiefgreifende Analyse taucht ein in die aufkommende Bedeutung von Städtenetzen als innovative Steuerungsinstrumente in der modernen Raumplanung. Im Fokus stehen die Definitionen, Einteilungen und Motive dieser Netzwerke, die von wirtschaftlicher Kooperation über die gemeinsame Nutzung von Ressourcen bis hin zur Stärkung regionaler Identitäten reichen. Untersucht werden die Bedingungen, die für eine erfolgreiche Vernetzung von Städten notwendig sind, sowie die potenziellen Auswirkungen auf die Raumordnungspolitik. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob Städtenetze eine sinnvolle Ergänzung zu traditionellen Planungsinstrumenten wie dem Zentrale-Orte-System darstellen oder ob sie gar dessen Grundlagen gefährden könnten. Anhand von Fallstudien wie dem Städtenetz „MAI“ (München, Augsburg, Ingolstadt) und dem „Sächsisch-Bayerischen Städtenetz“ werden die Chancen und Herausforderungen der interkommunalen Zusammenarbeit in der Praxis verdeutlicht. Es wird analysiert, wie diese Netzwerke zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen beitragen, die Lebensqualität der Bürger verbessern und neue Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung setzen können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle von Städtenetzen im Rahmen des ExWoSt-Programms (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau) und den daraus gewonnenen Erkenntnissen für die zukünftige Raumplanung. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob Städtenetze tatsächlich das Potenzial haben, eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung städtischer Räume zu fördern, oder ob sie lediglich eine Modeerscheinung in der Planungslandschaft darstellen. Dieses Buch bietet somit eine umfassende und kritische Auseinandersetzung mit einem hochaktuellen Thema der Raumplanung und Stadtentwicklung. Es richtet sich an Studierende, Planer, Politiker und alle, die sich für die Gestaltung unserer zukünftigen Lebensräume interessieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Städtenetze und entdecken Sie die Chancen und Herausforderungen einer vernetzten Zukunft.
0. Gliederung
1. Einleitung
2. Definition von Städtenetzen
3. Einteilung und Katalogisierung
4. Förderliche und notwendige Bedingungen zur Arbeit in Städtenetzen
5. Motive und Ziele von Städtenetzen
6. Städtenetze als Steuerungsinstrument im Einklang mit der Raumordnung?
6.1. Städtenetze in raumordnerischen Dokumenten
6.2. Städtenetze und das Zentralörtliche System
6.3. Förderung von Städtenetzen im ExWoSt-Programm
7. Beispiele für Städtenetze in Deutschland
7.1. Beispiel 1: Das Städtenetz „MAI“
7.2. Beispiel 2: Das „Sächsisch-Bayerische Städtenetz“
8. Schlußbemerkung
9. Literaturverzeichnis
10. Abbildungen
1. Einleitung
Nach dem Siegeszug des Netzwerkansatzes in vielen Lebensbereichen hat der Begriff „Vernetzung“ nun auch in der Raumordnungs- und Regionalplanungsdiskussion Einzug gehalten. Das im Jahre 1991 von der für Regionalpolitik zuständige Kommission der Europäischen Gemeinschaft veröffentlichte Dokument „Europa 2000“ hebt die Bedeutung der Städtevernetzung (vom englischen „urban networks“) als zukunftsweisendes Planungsmittel hervor.
Die Städte reagieren damit auf die zunehmende Internationalisierung Europas, in dem sich einzelne Städte nur schwer im Standortwettbewerb durchsetzen können. Deshalb wird versucht, durch die Vorteile der gesamten Region entscheidende Punkte im immer härter werdenden Rennen um Investitoren zu sammeln.
Obwohl die Initialzündung für die Gründung eines Städtenetzes oft wirtschaftlicher Art ist, sollen nach dem Willen der EG auch andere Bereiche wie Umweltschutz, Siedlungspolitik oder gemeinsame Ressourcennutzung aufgegriffen werden.
Da es sich bei der Städtevernetzung um ein sehr junges Thema handelt, liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Auch die Auswirkungen und der längerfristige Erfolg kann bislang nicht sicher abgeschätzt werden.
Diese Hausarbeit versucht, eine Antwort auf die Fragen zu geben, was Städtenetze sind, welche Möglichkeiten und Gefahren zu erwarten sind und ob sie mit anderen Raumplanungsinstrumenten in Einklang gebracht werden können. Dabei wird auch über die bisher in der Praxis gesammelte Erfahrung referiert.
2. Definition von Städtenetzen
Eine genaue Definition des Begriffs „Städtenetz“ zu geben ist fast unmöglich, da es in diesem Bereich viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen gibt. Nicht zuletzt ist auch das Dokument „Europa 2000“ der EG-Kommission dafür mitverantwortlich, da hier der Vernetzungsbegriff sehr breit und unpräzise verwendet wird (PRIEBS/DANIELZYK 1996, 9).
Ein Städtenetz, soweit sind sich die Autoren einig, ist eine Zusammenarbeit von mehreren Städten zur Bewältigung von Problemen, die alle Teilnehmer betreffen.
Übereinstimmend werden von allen Fachleuten einige Anhaltspunkte genannt, die ein Städtenetzwerk charakterisieren:
- Ein Städtenetz muß aus mehr als zwei Städten bestehen.
- Die Beziehungen, die durch ein Städtenetz geknüpft werden, müssen mehrdimensional sein, d.h. sich auf mehrere Aufgabengebiete beziehen (und unterscheiden sich so z.B. von Zweckverbänden).
- Als hauptsächliche Intention wird die Erzielung von Synergieeffekten (Zusammenwirken von mehreren Kräften zu einer abgestimmten Gesamtleistung) angegeben.
- Die Netzpartner müssen gleichberechtigt sein und freiwillig zusammenarbeiten.
- Das Gesamtgebiet ist räumlich abgegrenzt, die Städtevernetzung hat funktionalen Charakter.
3. Einteilung und Katalogisierung
Da das Städtenetzeprinzip noch sehr jung ist, gibt es eine Reihe von unterscheidlichen Einteilungskriterien:
- Räumlich: Es werden weltweite, europaweite (Netz von 58 Eurocities), nationale, regionale und grenzüberschreitende (z.B. ANKE) Netze unterschieden. Eine zweite Möglichkeit ist die Einteilung in interregionale (Vernetzung mehrerer Regionen) und intraregionale (Vernetzung innerhalb einer Region) Netze.
- Größe der Städte: Es bestehen sowohl Netzwerke zwischen gleichgroßen Städten als auch zwischen einer Metropole und ihren Umlandgemeinden (s. Bspe weiter unten).
- Art des Netzes: GLEISENSTEIN, KLUG, NEUMANN (1997, 40) differenzieren zwischen physischen (Vernetzung der verkehrlichen Infrastruktur), funktionalen (Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten wie Kultur, Wirtschaft), kooperative/strategische (nur Austausch von immateriellen Gütern wie Information und Erfahrung) und kommunikativen (Vernetzung der Entscheidungsträger der Städte zur Durchsetzung von lokalen Projekten) Netzen.
- KNIELING (1997, 167) unterscheidet im verdichtungsfernen Raum zwischen „Auffang“-Netzen (in strukturschwachen ländlichen Räumen), „Stabilisierungs“-Netzen (in gering verdichteten Räumen mit industriellen Entwicklungstendenzen) und „Aufhol“-Netzen (in stärkerverdichteten Transiträumen mit Entwicklungspotential).
- PRIEBS (1996, 37) fordert die Abgrenzung von normativen Städtenetzen, die „von oben“ verordnet werden, anstatt „von unten“ zu wachsen. Diese Art von Netzbildung gibt die sächsische Landesregierung in der Raumordnung als Ziel vor.
4. Förderliche und notwendige Bedingungen zur Arbeit in Städtenetzen
Trotz verschiedener Ansichten gibt es im Bereich Städtenetze einige Grundaussagen, die von allen Autoren als notwendig oder förderlich für ein funktionierendes Netzwerk angegeben werden.
- Gleichberechtigung der Netzpartner: Alle Städte in einem Netz müssen den gleichen „Rang“ einnehmen, es darf keine Unterschiede in der Entscheidungskompetenz geben.
- Freiwilligkeit: Alle beteiligten Gemeinden müssen freiwillig am Netzwerk teilnehmen. Dieses sog. „bottom up“-Prinzip, bei dem die Entscheidung, ein Netzwerk zu gründen, „von unten“, also von den Teilnehmern, getroffen wird, steht im Gegensatz zu dem in der Raumordnung (und auch bei normativen Netzen) oft auftretenden „top down“-Prinzip.
- Städte müssen selbst die Rolle der Akteure übernehmen.
- Es besteht eine Kooperationsbereitschaft der Beteiligten, die ggf. noch kultiviert und strukturiert werden muß (BRAKE in PRIEBS/DANIELZYK 1996, 21).
- Gemeinsame Ziele: Es sollen schon im Vorfeld gemeinsame Interessensgebiete und Ziele formuliert werden, an dem alle Teilnehmer arbeiten und die alle Teilnehmer erreichen möchten.
- Ein Städtenetz muß auf einen längeren oder sogar unbefristeten Zeitraum ausgelegt sein. Auch wenn die anfangs formulierten Ziele erreicht sind, können und sollen neue hinzukommen.
- Der Erfolg hängt stark von Interesse und Engagement der beteiligten Personen (oft politische Veraltungsbeamte) ab.
- Es sollte eine eigenständige Institutionalisierung erfolgen. Dabei entstanden in der Vergan-genheit verschiedene Organisationsformen (s. Abb. 3 und 4) Viele Städte sind in sog. „Kommunalen Arbeitsgemeinschaften“ organisiert, die große Offenheit bei möglichst geringer Verpflichtung gewährleisten. Andere Städtenetze (z.B. MAI, s.u.) sind in Vereinen mit eigenen Mitarbeitern und Finanzhoheit organisiert. Meist unterteilt sich die Steuerung in eine Lenkungsgruppe zur Koordination und verschiedene Arbeitskreise (FAHRENKRUG in PRIEBS/DANIELZYK 1996, 53f). Oftmals steht eine Projektforschung oder -betreuung zur Seite, die jedoch nur informativ und beratend eingreifen sollte.
5. Motive und Ziele von Städtenetzwerken
Wie schon erwähnt ist das vorrangige Motiv die Erzielung von Synergieeffekten, die in erster Linie durch Kooperation, Arbeitsteilung und Spezialisierung unter den Netzpartnern erreicht wird. Dabei können alle entwicklungsrelevanten Aufgabengebiete miteinbezogen werden.
PRIEBS (1996, 36) stellt die „gemeinsame, selbstorganisierte Bewältigung eines alle beteiligten Städte betreffenden Problems“ im Vordergrund.
Die meisten Städtenetze entstehen aus wirtschaftlichen Interessen. Viele Gemeinden hoffen, im räumlichen Verbund verschiedene Probleme zu bewältigen. So haben viele Städte mit leeren Kassen zu kämpfen und wollen durch Vernetzung (u.a. der infrastrukturellen Einrichtungen) Kosten einsparen bzw. für höherwertige Einrichtungen verwenden.
Im durch erhöhte Veränderungsdynamik gekennzeichneten Europa wird der Kampf um Investoren und die damit verbundenen Arbeitsplätze immer härter. Aus diesem Grund schließen sich Städte einer Region zur Gesamtvermarktung des Standortes zusammen, um die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere gegenüber den europäischen Metropolen zu steigern.
Viele Städtenetze entschließen sich zu einer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere beim ÖPNV. Dabei gilt zu beachten, daß mit der Zunahme der Austauschbeziehungen oftmals auch eine Zunahme des Verkehrs festzustellen ist, der auf diese Weise entgegengewirkt werden soll.
Mit Städtenetzen wird versucht, die Stadt-Umland-Problematik zu bekämpfen. Einerseits soll das Umland von Agglomerationen wiederbelebt, andererseits sollen Metropolen und Städte mit Entlastungsbedarf z.B. von ihrem hohen Siedlungsdruck befreit werden.
Durch die Bereitstellung raumrelevanter Infrastruktur (z.B. gemeinsame Technologiezentren) für alle beteiligten Städte wird versucht, Defizite auf diesen Bereichen zu beheben.
Durch eine gezielte Regionalvermarktung wird ein einheitliches Tourismusleitbild geschaffen. So sollen weitreichende Möglichkeiten und Angebote im gesamten Netzgebiet die Attraktivität als Urlaubsgegend steigern.
Ein Auftreten als geschlossene Gemeinschaft gegenüber Ministerien oder Abgeordneten kann ein Zusammenschluß sinnvoll sein, um so politische Ziele besser durchzusetzen.
In einigen Fällen ist das Ziel, ein Wir-Gefühl unter den Bewohnern der Städte zu erreichen. Durch Identifikation mit der Region können Austauschbeziehungen aufgebaut bzw. gefestigt werden.
6.Städtenetze als Steuerungsinstrument im Einklang mit der Raumordnung?
Zur Steuerung städtischer Entwicklung werden in der Raumplanung verschiedene Instrumente verwendet. Es gilt zu klären, ob Städtenetze eine sinnvolle Ergänzung oder ein komplett neues Planungsverfahren ist oder bestehenden Instrumenten gar im Wege steht. Besonders erhitzt das Zusammenspiel von Städtenetzwerken mit dem Zentrale-Orte-System die Gemüter.
6.1. Städtenetze in raumordnerischen Dokumenten
Nachdem die EG Städtenetze bereits 1991 als ein förderliches Planungsinstrument erkannte, maß das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (BmBau) im Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen (ORA), der das neue räumliche Leitbild für Gesamtdeutschland darstellt, der Netzidee besondere Bedeutung zu. Darin heißt es:
Der weitere Ausbau der städtischen Vernetzung ist wünschenswert, da
- städtische Kooperationen begünstigt werden,
- Stadtregionen ihre Standortvorteile am besten entfalten können,
- es zu einer besseren Nutzung der großräumigen Infrastruktur kommt,
- zusätzliche Entwicklungsimpulse über die engeren Regionalgrenzen hinaus gegeben werden.
Außerdem soll das Leitbild der dezentralen Konzentration unterstützt werden mit dem Ziel, das Umland von Agglomerationen wiederzubeleben und in ballungszentrenfernen Regionen Eigenkräfte als Motor für eine ausgeglichene Raumstruktur zu nutzen (GLEISENSTEIN, KLUG, NEUMANN 1997, 39).
Im 1995 vorgelegten Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen werden die Ziele konkreti-siert und versucht, Städtenetze mit dem Zentralörtlichen System in Einklang zu bringen:
Städtenetze sind keine neue Planungsebene, sondern auf Grundlage des bewährten Zentrale-Orte- Systems ein dynamisches Instrument zur Bewältigung neuer raumwirksamer Problemstellungen.
(...)
Die Vernetzung von Städten hat zwei wesentliche Aufgaben:
- Sicherung der Konkurrenzfähigkeit des Standorts Deutschland und seiner Regionen, etwa durch Schaffung leistungsfähiger Gegengewichte zu den großen Metropolen der Europäischen Union sowie
- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit im Innern, z.B. Arbeitsteilung bei der Bereitstellung raumbedeutender Infrastruktur oder Abstimmung bei der Bereitstellung von Bauland.
(...)
Der Ausbau städtischer und regionaler Vernetzung soll aus raumordnerischer Sicht zudem zu einer Stärkung der dezentralen Siedlungsstruktur in Deutschland beitragen: Das bewährte Zentrale-Orte- System wird dabei nicht in Frage gestellt, sondern durch Erweiterung der Möglichkeiten zu interkommunaler Zusammenarbeit flexibler und stärker auf Umsetzung ausgestaltet.
So soll also versucht werden, die Vorteile des Zentrale-Orte-Systems mit denjenigen der Städtenetze zu kombinieren und die Nachteile auszuschalten.
6.2. Städtenetze und das Zentralörtliche System
Wie in Kap. 6.1. abzulesen ist, erwarten Experten große Fortschritte von Städtenetzwerken. Ob diese die Erwatungen in der Praxis erfüllen können, bleibt vorerst ungewiß. Tatsächlich kann ein Städtenetz vieles leisten. Eine bedeutende Anzahl von Unterschieden zum Zentralörtlichen System (s. Tab. 1) lassen eine vielseitige Anwendbarkeit erkennen, doch werden immer wieder drei Befürchtungen laut:
- Die in Deutschland dezentral ausgerichtete Struktur wird gefährdet, da sich bevorzugt starke Netzpartner zusammenschließen und schwache Kommunen immer schwächer werden.
- Auch innerhalb einer Städtenetzregion können diejenigen Gemeinden, die nicht aktiv als Netzknoten agieren (sog. Netzmaschen) durch die Vernetzung benachteiligt werden.
- Die flächendeckende Versorgung mit Infrastruktur wird gefährdet, wenn die Netzpartner nicht besondere Rücksicht auf schwächere, oft ländliche Räume nehmen.
BRAKE, KNIELING und andere Autoren halten jedoch besonders Städtenetze in verdichtungsraumfernen Gebieten (Auffang-, Stabilisierungs- und Aufholnetze) für ein geeignetes Raumordnungsinstrument, um die Grundversorgung zu sichern. Hier kann - bei genügend Weitsicht der Akteure - die Aufwertung auch kleiner Gemeinden erfolgen und eine gezielte positive (infrastrukturelle und industrielle) Entwicklung erreicht werden.
Tab. 1: Übersicht über die Unterschiede zwischen Zentrale-Orte-System und Städtenetzen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: eigene Herstellung nach PRIEBS (1996, 42f) und BRAKE in PRIEBS/DANIELZYK (1996, 23)
6.3. Förderung von Städtenetzen im ExWoSt-Programm
Das Forschungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ des BmBau hat sich zum Ziel gesetzt, „durch die Initiierung von Modellvorhaben innovative Lösungsansätze für ausgewählte Fragen der Regional- und Stadtentwicklung“ zu finden (FAHRENKRUG in PRIEBS/DANIELZYK 1996, 47).
Als ein Forschungsschwerpunkt wurden Städtenetze in dieses Programm aufgenommen, um an praktischen Experimenten zu klären, ob Städtenetze als neue Kooperationsmethode die bisherigen Planungsmethoden um ein flexibles und projektorientiertes Instrument erweitern können. Dabei soll sowohl bei den Netzknoten als auch bei den Netzmaschen Potentiale und Bertoffenheit festgestellt werden (ADAM 1994, 517).
Durch die Förderung erhofft sich das BmBau die Bestätigung der im ORA formulierten Ziele (s. 6.1.).
Seit 1995 werden 11 ausgewählte Städtenetze (s. Abb. 1) durch das ExWoSt gefördert. Dabei wurden Netze mit unterschiedlicher Struktur (z.B. grenzüberschreitende oder im ländlichen Raum liegende Netze) miteinbezogen. Konkrete Ergebnisse können noch nicht gemacht werden, es existieren lediglich Zwischenberichte (s. Bspe unten).
Zur Organisation des Städtenetz-Forschungsfeldes im ExWoSt-Programm s. Abb. 2.
7. Beispiele für Städtenetze in Deutschland
7.1 Beispiel 1: Das Städtenetz „MAI“
Das Städtenetz MAI wurde 1992 gegründet und umfaßte die Metropole München sowie die Stadtregionen Augsburg und Ingolstadt. Es zählt neben dem „Initiativkreis Wirtschaftsregion München“ und dem „Arbeitskreis Regionalentwicklung München“ zu den wichtigsten kooperativen Planungsmaßnahmen der bayerischen Landeshauptstadt. Nachdem zunächst vertraglich eine Zusammenarbeit mit einem jährlichen Treffen festgelegt wurde, folgte 1995 die Gründung des Vereins „Wirtschaftsraum Südbayern - München - Augsburg - Ingolstadt (MAI) e.V.“ (s. Abb. 3). Seit diesem Zeitpunkt können auch andere Gemeinden sowie Planungs-verbände, DGB, Einzelpersonen, Kammern und Wirtschaftsunternehmen beitreten.
Formuliertes Ziel war zu Beginn die Vermarktung der Gesamtregion sowie eine einheitliche Darstellung des Standortes nach außen (WECK 1996, 251).
Später wurden weitere, für Städtenetze typische Ziele hinzugefügt. Hierzu zählten:
- Erarbeitung eines regionalen Verkehrskonzepts sowie Planung der Anbindung an die großräumigen Schienen- und Transitnetze
- Zusammenarbeit bei Problemen der Siedlungspolitik, der Kultur und der Umwelt
- Förderung der Wirtschaft und Planung der räumlichen Arbeitsplatzverteilung
- Technologietransfer und Zusammenarbeit im Bildungs- und Forschungsbereich sowie
- Gemeinsames Tourismusmarketing.
In nach den obigen Schwerpunkten abgegrenzten Arbeitsgruppen wurden konkrete Maßnah-men beschlossen. Interessant ist in dieser Hinsicht ein Katalog der Defizite und Stärken der einzelnen Regionen, durch den z.B. Augsburg und Ingolstadt vom Innovationspotential der Münchner Wirtschaft profitierten. Umgekehrt soll München Probleme bei Verkehr und Siedlungsdruck durch das Flächenpotential der anderen teilnehmenden Gemeinden lösen.
Hier wird der Vorteil der Funktionsbetonung, der in Städtenetzen vorherrscht, gegenüber dem in der Raumordnung propagierten Funktionsausgleich deutlich. Die Freiwilligkeit der Akteure, die höhere Flexibilität, die prozeßorientierten Planungsverfahren gegenüber den institutionellen sowie die Teilnahme von privaten und öffentlichen Personen und Körperschaften tragen ebenfalls zu guten Ergebnissen bei.
Jedoch birgt MAI auch Probleme in sich. So ist das Städtenetz primär auf wirtschaftliche Interessen ausgelegt, die Entscheidungen werden von einer politischen und wirtschaftlichen Elite gefällt. Weiterhin bleiben verschiedene Gruppen wie Bürgerinitiativen, Kirchen und Wohlfahrtsverbände außen vor. Das projektorientierte Handeln kann ebenfalls zum Nachteil werden, weil hierbei langfristige Ziele leicht außer Acht gelassen werden oder andere regionale Ziele, z.B. von der Raumplanung geforderte Ausgleichshandlungen, auf der Strecke bleiben.
7.2 Beispiel 2: Das „Sächsisch-Bayerische Städtenetz“
Am Beispiel des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes soll die Vernetzung über eine Ländergrenze hinweg deutlich gemacht werden. Dabei ist besonders zu beachten, daß zwischen diesen Gebieten ein reger kultureller und wirtschaftlicher Austausch herrschte, ehe der „Eiserne Vorhang“ die Regionen trennte. Trotz sehr unterschiedlicher Entwicklung seit Ende des 2. Weltkrieges bis zur Wende entstand ein Netzwerk aus fünf Oberzentren, das sich aus den sächsischen Städten Chemnitz, Zwickau und Plauen und den bayerischen Städten Hof und Bayreuth zusammensetzt.
Wie das MAI wurde es in das Experimentelle Wohnungs- und Städtebauprogramm aufgenommen und gefördert, es handelt sich hier jedoch um etwa gleichgroße Netzpartner ohne Sonderstellung, die bei MAI durch München eingenommen wird.
Das Sächsisch-Bayerische Städtenetz entstand als eines der wenigen ohne das Ziel des wirtschaftlichen Interessensausgleichs. Vorrangig soll durch Synergie- und Ausgleichseffekte Nutzen für alle Regionen erreicht werden. Dadurch sollen in erster Linie die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessert werden und ein neues Wir-Gefühl entstehen. Es erfolgte eine Schwerpunktsetzung mit vier unterschiedlichen Arbeitsfeldern: Ausbau des Schienenverkehrs und des ÖPNV, gemeinsame Kulturplanung, Förderung des Tourismus in den Regionen und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Technologie.
Für jedes dieser vier Felder wurden Arbeitsgruppen gebildet, denen die zuständigen kommunalen Fachreferenten angehören. Wenn nötig werden weitere Entscheidungsträger und Fachleute hinzugezogen. Sie entscheiden über die Projekte in den einzelnen Arbeitsfeldern und führen diese durch. Der aus den Oberbürgermeistern und Vertreter der Landesplanungen bestehende Lenkungsausschuß legt bereits vor der Planung eines Projekts die Grundsätze und Leitlinien fest. Die zwischengeschaltete sog. Arbeitsgruppe dient dem Informationsaustausch der aktuellen Projektstände der Arbeitskreise. Die von der TU Chemnitz-Zwickau eingesetzte Projektforschung übernimmt meist nur moderierende, beratende und informative Funktion (s. Abb. 4).
Gemeinsam konnten die Städte eine Liste mit gemeinsamen Forderungen erarbeiten und somit geschlossen gegenüber der Bundes- und Landespolitik auftreten.
Konkrete Ergebnisse liegen in den Bereichen Verkehr (Planung einer Sachsen-Franken-Magistrale), Kultur (gemeinsame Veranstaltungen, z.B. von Musikfestivals) sowie Tourismus (Werbung für die Gesamtregion, Schaffung eines preiswerten Hotelpauschalangebots) vor.
Zusammenfassend könnte man sagen, daß zwar noch keine ganz spektakulären Neuerungen eingetreten sind, jedoch schon einige beachtliche Erfolge (besonders im Bereich Verkehr) erzielt wurden, die wahrscheinlich nicht ohne die Vernetzung zustande gekommen wären.
8. Schlußbemerkung
Eine endgültige Einschätzung über die Qualität und die Fähigkeiten von Städtenetzen wird man wohl erst in einigen Jahren erhalten, z.B. wenn die im ExWoSt beobachteten Netzwerke zuverlässige Resultate erbringen.
Meiner Erachtens enthalten Städtenetze ein großes Entwicklungspotential, besonders wenn sie das Zentralörtliche System in sinnvoller Weise und wie im Orientierungsrahmen gefordert ergänzen. Dazu gehört in erster Linie auch die Weitsicht und Rücksichtnahme der Akteure, die auch für Randgebiete und Netzmaschen Verantwortung tragen. Überdies sollte man über die durchaus wichtigen ökonomischen Aspekte andere Gebiete wie Umweltschutz oder Kultur nicht vergessen, sondern verstärkt in die Ziele der Netzwerke miteinarbeiten.
9. Literaturverzeichnis
ADAM, B. (1994): Städtenetze : Ein neues Forschungsfeld des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus. In: Informationen zu Raumentwicklung 1994 (7/8). S. 513-520.
BUNDESMINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, BAUWESEN UND STÄDTEBAU (Hg.) (1996): Raumordnung in Deutschland. Bonn.
BUNDESMINISTERIUM FÜR RAUMORDNUNG, BAUWESEN UND STÄDTEBAU (Hg.) (1993): Raumordnungsbericht 1993. Bonn.
GLEISENSTEIN, J. / KLUG, S. / NEUMANN, A. (1997): Städtenetze als neues „Instrument“ der Regionalplanung?. In: Raumforschung und Raumordnung 55. S. 38-47.
KNIELING, J. (1997): Städtenetze und Konzeption der Raumordnung. In: Raumforschung und Raumordnung 55. S.165-175.
KÖCK, H. (1992): Städte und Städtesysteme. Köln.
PRIEBS, A. (1996): Städtenetze als raumordnungspolitischer Handlungsansatz : Gefährdung oder Stütze des Zentrale-Orte-Systems?. In: Erdkunde, 50, S. 35-45.
PRIEBS, A. / DANIELZYK, R. (Hg.) (1996): Städtenetze - Raumordnungspolitisches Handlungsinstrument mit Zukunft?. Bonn.
SPANGENBERGER, V. (1996): Städtenetze : Der neue interkommunale und raumordnerische Ansatz. In: Raumforschung und Raumordnung 54. S. 313-320.
WECK, S. (1996): Neue Kooperationsformen in Stadtregionen. In: Raumforschung und Raumordnung 54. S. 248-256.
Universität Heidelberg
Geographisches Institut
Proseminar Athropogeographie „Verdichtungsräume“ Wintersemester 1997/98
Leitung: Prof. Dr. Hans Gebhardt
Städtenetze - ein neues Steuerungsinstrument städtischer Entwicklung?
Referent:
Sebastian Gieler Kaiserstr. 27
69115 Heidelberg
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Vom ExWoSt-Pro- gramm geförderte Städte- netze
Quelle: BMBAU (1996, 19)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Organisation des ExWoSt-Forschungsfeldes „Städtenetze“
Quelle: PRIEBS/DANIELZYK (1996, 49)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Organisationsauf-bau des Städtenetzes „MAI“
Quelle: PRIEBS/DANIELZYK (1996, 81)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Organisationsschema „Sächsisch-Bayerisches Städtenetz“
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments „Städtenetze - ein neues Steuerungsinstrument städtischer Entwicklung?“?
Das Dokument ist eine Hausarbeit über Städtenetze und deren Rolle in der Raumplanung. Es definiert Städtenetze, kategorisiert sie, untersucht die notwendigen Bedingungen für deren Funktionieren, die Motive und Ziele hinter ihnen, und analysiert, ob sie mit anderen Raumplanungsinstrumenten, insbesondere dem Zentralörtlichen System, vereinbar sind. Außerdem werden Beispiele für Städtenetze in Deutschland, wie das Städtenetz „MAI“ und das „Sächsisch-Bayerische Städtenetz“ vorgestellt.
Wie werden Städtenetze definiert?
Eine genaue Definition ist schwierig, aber im Allgemeinen ist ein Städtenetz eine Zusammenarbeit von mehreren Städten zur Bewältigung gemeinsamer Probleme. Charakteristisch sind mehr als zwei Städte, mehrdimensionale Beziehungen (d.h. mehrere Aufgabengebiete), die Erzielung von Synergieeffekten, Gleichberechtigung der Partner und freiwillige Zusammenarbeit, räumliche Abgrenzung und funktionaler Charakter.
Welche Einteilungskriterien für Städtenetze gibt es?
Es gibt verschiedene Kriterien, darunter räumliche (weltweit, europaweit, national, regional, grenzüberschreitend), Größe der Städte (gleichgroße Städte oder Metropole mit Umland), Art des Netzes (physisch, funktional, kooperativ/strategisch, kommunikativ) und räumliche Lage (Auffang-, Stabilisierungs-, Aufhol-Netze). Auch wird zwischen normativen und "von unten" gewachsenen Städtenetzen unterschieden.
Welche Bedingungen sind für die Arbeit in Städtenetzen förderlich?
Notwendig oder förderlich sind Gleichberechtigung der Netzpartner, Freiwilligkeit (Bottom-up-Prinzip), aktive Rolle der Städte, Kooperationsbereitschaft, gemeinsame Ziele, langfristige Auslegung, Interesse und Engagement der Beteiligten sowie eine eigenständige Institutionalisierung.
Was sind die Hauptmotive und Ziele von Städtenetzen?
Das vorrangige Motiv ist die Erzielung von Synergieeffekten durch Kooperation, Arbeitsteilung und Spezialisierung. Weitere Ziele sind die Bewältigung von Problemen, die alle beteiligten Städte betreffen, die Einsparung von Kosten, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die Zusammenarbeit in der Verkehrsinfrastruktur, die Bekämpfung der Stadt-Umland-Problematik, die Bereitstellung von Infrastruktur, die gezielte Regionalvermarktung und die bessere Durchsetzung politischer Ziele.
Wie passen Städtenetze in die Raumordnung?
Städtenetze sollen eine sinnvolle Ergänzung der Raumplanung sein, die bestehende Instrumente nicht ersetzen, sondern erweitern. Besonders das Zusammenspiel mit dem Zentrale-Orte-System ist dabei wichtig. Städtenetze sollen die dezentrale Siedlungsstruktur stärken, ohne das Zentrale-Orte-System in Frage zu stellen.
Welche Kritikpunkte gibt es an Städtenetzen in Bezug auf die Raumordnung?
Befürchtungen bestehen, dass die dezentrale Struktur gefährdet wird, da sich bevorzugt starke Netzpartner zusammenschließen und schwache Kommunen geschwächt werden, dass Gemeinden innerhalb eines Städtenetzes benachteiligt werden können, wenn sie nicht aktiv als Netzknoten agieren, und dass die flächendeckende Versorgung mit Infrastruktur gefährdet wird.
Was ist das ExWoSt-Programm und welche Rolle spielen Städtenetze darin?
Das ExWoSt-Programm (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau) des BmBau fördert Modellvorhaben zur Regional- und Stadtentwicklung. Städtenetze wurden als ein Forschungsschwerpunkt in dieses Programm aufgenommen, um zu klären, ob sie die bisherigen Planungsmethoden um ein flexibles und projektorientiertes Instrument erweitern können.
Welche Beispiele für Städtenetze in Deutschland werden im Dokument genannt?
Es werden zwei Beispiele genannt: Das Städtenetz „MAI“ (München, Augsburg, Ingolstadt) und das „Sächsisch-Bayerische Städtenetz“ (Chemnitz, Zwickau, Plauen, Hof, Bayreuth). Beide werden im Hinblick auf ihre Entstehung, Ziele, Organisation und Ergebnisse untersucht.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem Städtenetz „MAI“ und dem „Sächsisch-Bayerischen Städtenetz“?
Das Städtenetz „MAI“ ist primär auf wirtschaftliche Interessen ausgelegt und beinhaltet eine Metropole (München) mit Stadtregionen, während das „Sächsisch-Bayerische Städtenetz“ ohne wirtschaftlichen Interessenausgleich entstand und aus etwa gleichgroßen Netzpartnern besteht. Das „Sächsisch-Bayerische Städtenetz“ ist stärker auf Synergie- und Ausgleichseffekte ausgerichtet, um die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern und ein neues Wir-Gefühl zu schaffen.
- Quote paper
- Sebastian Gieler (Author), 1998, Städtenetze - ein neues Steuerungsinstrument städtischer Entwicklung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96121