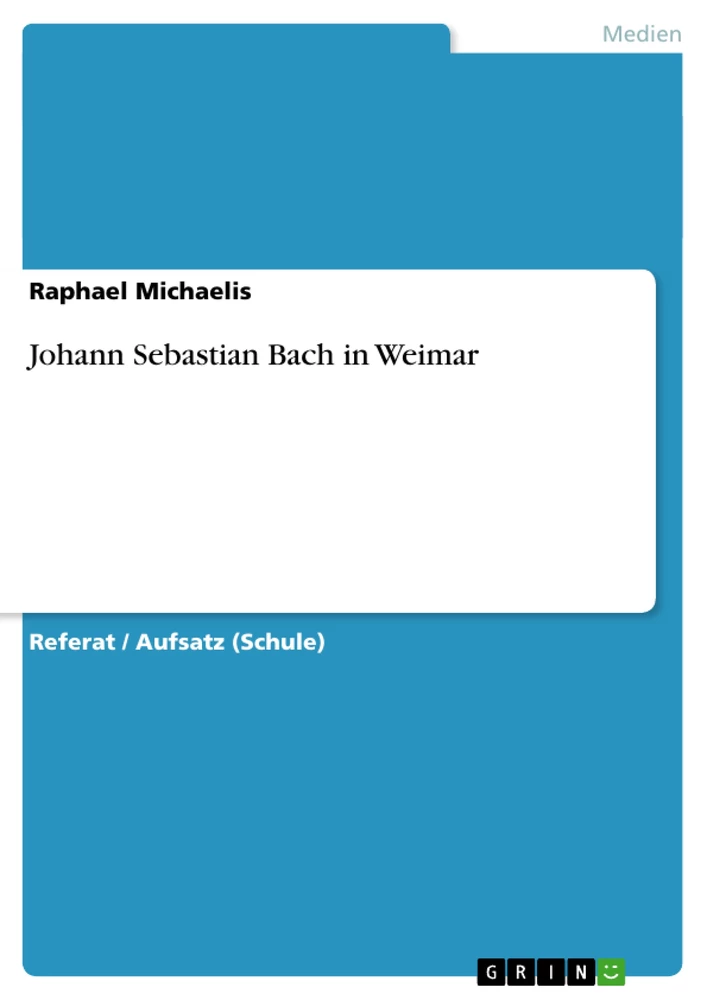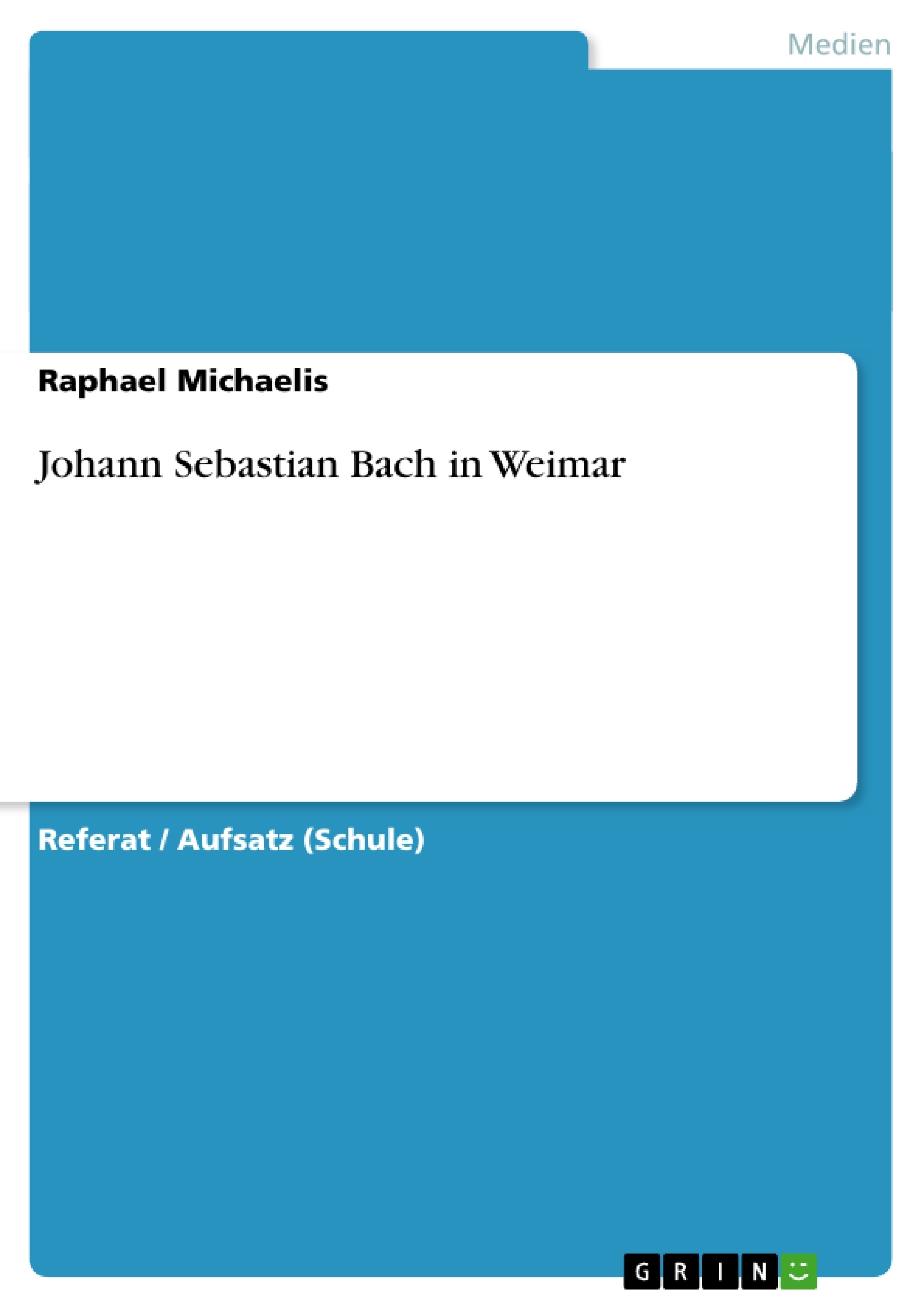Johann Sebastian Bach in Weimar
Impromtu
„Nicht Bach, sondern Meer müßte er heißen“, sprach einst Beethoven und hatte recht. Denn nicht nur die Musik Johann Sebastian Bachs, auch seine Persönlichkeit bietet heute noch Musikforschern sowie Musikhörern ein schier grenzenloses Betätigungsfeld. Sicher hatte Beethoven seinen Ausspruch als Ausdruck purer Bewunderung verstanden, aber schon zu Beethovens Zeit beschäftigte man sich mit einer Rekonstruktion der Bachschen Biographie und ist selbst heute noch nicht soweit , daß man sagen könnte, man ist nun fähig alles einzuordnen, zu katalogisieren, zu chronologisieren oder gar zu verstehen geschweige denn seine Musik. Man kann sich beispielsweise an einem Tag mit ,Bach in Weimar‘ beschäftigen, indem man die Touristeninformation in Weimar und danach historische Orte, die mit Bach in Verbindung stehen, aufsucht. Einschlägige „A-ha“ Erlebnisse sind dabei leider so gut wie ausgeschlossen, da die Bachpflege im Gegensatz zum Umgang mit Goethe in Weimar, sagen wir, sehr übersichtlich gehalten wird.
Johann Sebastian Bach wurde 1685 in Eisenach als jüngstes von vier Kindern geboren. Aus der Familie Bach gingen immer wieder große musische Geister hervor, die jeweils in ihrer Zeit nicht unbekannt waren. Unser Bach besuchte ab 1692 die Lateinschule in Eisenach und sang in der Kurrende mit. Nach dem Tod von Mutter und Vater nahm ihn sein älterer Bruder in Ohrdruf zu sich auf, welcher dort Organist war. In Ohrdruf besuchte Bach wieder eine Lateinschule und erhielt sehr profunden Orgelunterricht. 1700 kam er zusammen mit seinem Freund Erdmann an die Klosterschule der Sankt-Michaelis-Kirche zu Lüneburg, wo er Mitte 17021 seine Ausbildung abschloß und sich in Sangerhausen als Organist bewarb. Doch Bach bekam die Stelle nicht, wurde aber im März 1703 in Weimar als Hofmusicus eingestellt. Wahrscheinlich beabsichtigte man ihn sowieso nach der Fertigstellung der Orgel in Arnstadt im Sommer 17032 dort einzusetzen. Man beachte aber trotzdem, daß Bach immerhin eine Anstellung bei Hofe bekam, wofür er nicht einmal eine Art Vorspiel ableisten mußte3.
Der jüngere Bruder, Johann Ernst, des regierenden Herzogs Wilhelm Ernst besoldete Johann Sebastian Bach und war ein Liebhaber und Kenner der Musik und sicherlich hatte sich Bachs unglaubliches Vermögen schon bis zu ihm herumgesprochen.
Gegenüber dem fünf Monate dauernden Aufenthalt in Weimar 1703 verhalten sich die von mir benutzten Quellen ziemlich schweigsam, so daß Charles Sanford Terry bei den von mir verwendeten Büchern mit 40 Zeilen Spitzenreiter ist. (Platz zwei: Hans Heinrich Eggebrecht mit 15 Zeilen) Möglicherweise erfährt man durch tiefergehende Forschungen an dieser Stelle noch etwas interessantes, wie zum Beispiel das Zusammentreffen zwischen Bach und Telemann verlief, welches in diese Zeit datiert wird. Ich möchte mich dennoch vorwiegend der Zeit von 1708-1717 widmen, die in Bezug auf Bachs musikalisches Schaffen auch die bedeutungsvollere darstellt.
Zwei Jahre nach dem Amtsantritt 1703 in Arnstadt wurde Bach zunehmend unzufriedener mit qualitativen Möglichkeiten des Musizierens. Es fehlte generell an Personal und zudem an kompetenten Personen. Auch warf man ihm vor, und das ist sicherlich aus den Augen sonntäglicher Kirchgänger vertretbar, daß er die Gemeinde mit seinem oftmals kühnen Orgelspiel verwirrte. Außerdem stellte sich heraus, daß er eine Frau privat in der Kirche hatte singen lassen, in einer Zeit, in der Frauen das Singen in der Kirche noch verboten war. Bei dieser Frau handelt es sich höchstwahrscheinlich um seine zukünftige Gattin Maria Barbara Bach4. Ende 1705 nahm er sich noch einen vierwöchigen Urlaub um in Lübeck Buxtehude „zu behorchen“. Diesen Urlaub überschritt er kühn um drei Monate, da er sich nicht so recht von dem Meister und seinem Orgelspiel trennen wollte. Mitte 1707 wurde die Situation unhaltbar und Bach verließ Arnstadt, wo er zwar recht gut bezahlt wurde, was aber einen wahren Musiker wie ihn nicht davon abhielt seinen Kopf durchzusetzen zu wollen und so vielleicht auch seine Anstellung aufs Spiel zu setzen. Auch in Mühlhausen konnte Bach sich nicht richtig verwirklichen, was vermutlich durch einen schon länger währenden Streit zwischen verschiedenen Predigern der Stadt bedingt war. Bei Bachs Amtsantritt hatte zu dem gerade ein Brand viele Gebäude der Stadt vernichtet, so daß die Mühlhausener zu diesem Zeitpunkt nicht sonderlich an großer Kunst interessiert waren.
Durchf ü hrung
Anfang Juli 1708 wurde Bach als Hoforganist und Kammermusicus von Herzog Wilhelm Ernst in Weimar eingestellt. An Politik nicht sonderlich interessiert lag aber Wilhelm Ernst die Kunst sehr am Herzen. Ein neues Gymnasium mit kompetenten Lehrkräften und der Wiederaufbau der Sankt-Jakobs-Kirche sind ihm beispielsweise zu Gute zu halten. Dreh- und Angelpunkt für Zeremonien war die Schloßkapelle, deren Kapellmeister der nie richtig gesunde Samuel Drese war, der deswegen auch häufig von seinem Sohn Johann Wilhelm Drese, welcher Vizekapell- meister war, vertreten werden mußte. In der Stadtkirche war Johann Gottfried Walther als Organist angestellt, dem wir ein mit großer Sorgfalt zusammengestelltes Nachschlagewerk, ein „Musicalisches Lexicon“, verdanken, welches 1732 in Leipzig erschien und das erste seiner Art darstellt. In diesem Buch finden wir auch die ersten chronologischen Angaben zu Bach und Händel vor5. In Weimar erwarteten Bach deutlich bessere Zustände im musikalischen Bereich als in Mühlhausen. So war die Orgel der Schloßkirche nicht gerade monumental, soll aber einen sehr schönen ausgewogenen Klang gehabt haben, der auch Bach sehr zusprach. Allerdings war sie im Karnetton gestimmt, also eine kleine Terz über dem Kammerton, was Bach beim Spielen teilweise zu tonalem Umdenken veranlaßte, aber für ihn sicherlich kein spieltechnisches Problem darstellte.
Durch die Achtung und den Respekt, der ihm zweifelsohne von Herzog Wilhelm Ernst und seinem Mitregenten Johann Ernst entgegengebracht wurde, war Bach in seinem kompositorischen Schaffen nicht behindert worden. In Weimar schrieb er einen Großteil seiner Orgelwerke, darunter auch 22 Bearbeitungen von Instrumentalkonzerten italienischen Stils, davon neun von Vivaldi, der damals als der modernste aller Komponisten galt. Bach war ein großer Bewunderer Vivaldis. Die dreisätzigen Symphonien und die Solokonzerte erregten bei ihm großes Interesse. Man sagt, Vivaldi habe damals der Musik ein neues Gesicht gegeben. Bach begeisterte vor allem die bildliche Darstellung von Stimmungen und Bildern mit musikalischen Mitteln. Auch die kontrastierende Gegenüberstellung von Naturereignissen mit Hilfe des Affektes stellten etwas völlig neues dar. Vivaldi legte somit einen Grundstein für den später gebräuchlichen Themendualismus6. Bei Bach findet man dies wieder, so wie die für Vivaldi typisch gewordene ABA Form der Symphonien und Konzerte. Revolutionär war bei Bach vor allem die Selbstverständlichkeit, mit der er durch Orgelbearbeitungen von italienischen Symphonien weltliche Melodien sozusagen in die Kirche brachte.
Die Kunst der Form war entscheidend. Kirchliches und weltliches Schaffen hatten für Bach den gleichen Stellenwert in einer Art und Weise, daß keines von beiden jemals das andere schmälerte. So hat er auch einige Kantaten, die für festliche Anlässe an verschiedenen Höfen geschrieben wurden, später mit einem geistliche Text versehen und umgekehrt.
Diese Einstellung versuchte er auch seinen Schülern zu vermitteln. Johann Christoph Ziegler war ein Schüler Bachs in Weimar, später in Halle Organist und Verfechter des Bachschen Orgelspiels und dessen Unterrichtsmethodik. Er schrieb, daß er so von Bach unterrichtet wurde,: „daß ich die Lieder nicht nur so obenhin, sondern auch nach dem Affekt der Worte spiele“7. Das ist ein deutliches Zeichen der Bachschen Affektlehre und seines Anspruchs an die musikalische Ausdeutung des Textes. Sein erster Schüler war Johann Martin Schubert, den er schon in Mühlhausen unterrichtete und der später in Weimar Bachs Nachfolge als Hoforganist antrat. Schüler und Lehrlinge gingen im Bachschen Haus ein und aus. Maria Barbara Bach, eine Cousine zweiten Grades, die er in Dornheim geheiratet hatte, bewies viel Geduld in dem bewegten Haushalt und stand Bach als treue Gefährtin zur Seite. Auch um den zahlreichen Nachwuchs kümmerte sie sich liebevoll8, von dem das älteste Kind Catharina Dorothea war, und nach ihr noch fünf weitere Kinder in der Herderkirche zu Weimar getauft wurden. Darunter auch Carl Phillip Emanuel Bach, dem uns heute bekanntesten Sohn des Meisters. Bei ihm diente Georg Phillip Telemann als Namensgeber und Taufpate. Von der Freundschaft zwischen Telemann und Bach wird nicht viel berichtet, man vermutet, daß sie sich 1703 in Weimar kennenlernten, als Telemann Herzog Johann Ernst in Weimar besuchte, zu dem beide ein sehr gutes Verhältnis hatten. Ab 1721 war Telemann Kapellmeister in Hamburg und vererbte Carl Phillip Emanuel Bach 1767 das Amt. Johann Sebastian Bach unterhielt regen Kontakt zu den Lehrkräften des Gymnasiums. Johann Matthias Gesner, ein Bewunderer Bachs, wurde dort Konrektor. Siebzehn Jahre nach dem Verlassen Bach Weimars trafen sich beide in Leipzig als Amtskollegen wieder.
Von Weimar aus führten Bach viele Reisen quer durch Deutschland.
1709 reiste er nach Mühlhausen zur Einweihung der nach seinen Plänen umgebauten Orgel in der Davi Blasii Kirche. Eine Hofreise führte ihn 1713 nach Weißenfels zum Geburtstags des Herzogs Christian von Sachsen Weißenfels. Im gleichen Jahr erhielt er aus Halle ein Angebot, die neue Orgel der Liebfrauenkirche zu prüfen. Sein Spiel wurde begeistert aufgenommen, so daß man ihm das angesehene Amt des Organisten antrug, wenn er sich den üblichen Prüfungen unterziehen wolle.
Er mußte ein Stück nach damaliger Sitte unterbreiten, einstudieren und aufführen, was er auch tat. Dieses Stück stellte sich später als die in Weimar geschriebene Bekümmerniskantate heraus9. Sie wurde ungefähr ein halbes Jahr später in der Sankt-Jakobs-Kirche in Weimar ein zweites Mal aufgeführt. Der Gefallen an Bachs Werk in Halle drückte sich in einem konkreten Stellenangebot10 aus, welches an den Weimarer Hof geschickt wurde. Von Seiten Wilhelm Ernstes war kein Einverständnis vorhanden, Bach ließ sich aber trotzdem sehr viel Zeit mit der Entscheidung. Man weiß nicht genau, ob er in Weimar mit Blick auf Halle eine höhere Position forderte, oder sie ihm aus Angst vor einem Weggang seinerseits angeboten wurde. 1714 setzte man ihn in Weimar in „neue Würden“. Er wurde zum Vizekapellmeister berufen und sollte jeden Monat eine Kantate aufführen. Durch die höhere Besoldung, die dies mit sich brachte, durch seine kinderreiche Familie die einen Umzug erschwerte und durch die eiserne Hand des Herzogs, die sich später noch beweisen sollte, lehnte Bach die Stelle in Halle ab, was dort so interpretiert wurde, daß er das Stellenangebot nur eingeholt hätte, um seine Weimarer Anstellung aufzubessern. Das dies nicht der Absicht Bachs entsprach ist anzunehmen und der Groll in Halle legte sich auch wieder, so daß man ihm 1716 zur Prüfung der endlich fertiggestellten Orgel der Liebfrauenkirche einlud. Man hatte Diener für ihn und seine Mitarbeiter bereit gestellt und fuhr die feinsten Speisen auf. Natürlich nach getaner Tagesmüh. Die Prüfung der Orgel fiel sehr positiv aus und dem mehrgängigen Abschlußmahls ist wohl auch der Tintenfleck auf seiner Signatur der Honorarquittung zuzusprechen11. Ende 1714 begleitete er Herzog Wilhelm Ernst auf einer Hofreise nach Kassel, wo die italienische Oper sehr gepflegt wurde12. Seine bekannteste Reise ist die im Jahre 1717 nach Dresden, um die sich viele unterschiedliche Geschichten ranken. Definitiv ist, daß Louis Marchand am sächsischen Hof gefeierter Cembalist und Organist war und am Tag des Zusammentreffens mit Bach überraschend abreiste. War es nun ein Improvisationswettbewerb, ein geplantes Konzert mit Beiden, wurde Bach engagiert um dem „aufgeblasenen Franzosen“, wie Jean Babtiste Volumier ihn angeblich titulierte, eine Lehre zu erteilen, was eigentlich nicht Bachs Art entsprechen würde, oder wollte sich Marchand nicht blamieren13 ? Bach spielte jedenfalls alleine am sächsischen Hofe vor und erntete Begeisterungsstürme, die seinen Bekanntheitsgrad in Deutschland immens steigerten.
Mit Bachs Beförderung 1714 begann das regelmäßige Kantatenschaffen Bachs obwohl er auch in dieser Zeit an Symphonien im italienischen Stil und an Violinkonzerten arbeitete und eventuell schon Vorarbeit für die in Köthen entstandenen Brandenburgischen Konzerte leistete. Um die 30 Kantaten schrieb er in Weimar, wobei die meisten nur in einer Umarbeitung während der Leipziger Jahre vorliegen. Zur Verfügung standen in Weimar sechs Knaben und jeweils zweifach besetzte tiefere Stimmen, die aber gut ausgebildet waren, was er später in Leipzig vermißt haben mußte14. Seine Partituren lassen Rückschlüsse auf eine Unvoll- ständigkeit des Orchesters zu. Da Herzog Wilhelm Ernst ein Freund der Jagd war, waren Trompeten in der Überzahl vorhanden, die sicherlich fehlende Stimmen ersetzen mußten. Etliche Texte der Kantaten stammen von Salomon Franck, der seit 1702 Sekretär am Konsistorium in Weimar war. Bach gefielen die tiefgründigen Texte, zumal sie nicht nur aus reinen Choraltexten und Bibelversen bestanden. Franck bemühte sich „arienfähige“ Texte zum schreiben, die auch einen Wechsel zwischen Rezitativ und Arie erlaubten, wie dies in der italienischen Oper vorzufinden ist. In den geistlichen wie weltlichen Kantaten Bachs finden wir vor allem in den Arien die typische ABA-Form der italienischen Da capo Arie. Wieder hält ein weltliches Musikelement in der Kirche Einzug. Eine neue Dimension eröffnet sich hier der im Gegensatz zur höfischen Musikpflege schon sehr antiquierten Kirchenmusik. Man kann nun Bedeutungsschwerpunkte, Gefühle, Textaffekte etc. neben den althergebrachten Ausdrucksmit- teln wie Tempo, Rhythmik und Dynamik nun auf vier unterschiedliche Medien verteilen. Einerseits das Orchester, das zum Beispiel in Arien auch auf thematisches Material Zugriff bekommt15 und somit an Ausdruckskraft gewinnt; der Chor, dessen Rolle als erzählendes Element zunehmend manifestiert wird; so auch das Rezitativ, das durch halb Sprache, halb Gesang vielerlei Artikulationsmöglichkeiten zuläßt, und nicht zuletzt die Arie, die gezielt als der Handlungsstopper schlechthin eingesetzt wird, wodurch viel wirkungsvoller ein Gefühls- moment wiedergegeben werden kann als bei einer endlosen Aneinanderreihung von Arien wie es in der Anfangszeit der Oper der Fall gewesen ist. Musik im Dienste des Textes also, aber weit genug vom Realismus entfernt. Später flocht Bach neben geschriebenen Texten auch wieder originale Bibelzitate und Choralverse in seine Kantaten und Oratorien ein, was zu einer Vermischung führte, die spezifisch für sein geistliches Vokalaschaffen werden sollte.
Warum Bach Weimar am Ende auf eine doch so dramatische Weise verließ, ist nicht so genau zu bestimmen. Am 1.12.1716 starb Samuel Drese und Bach als Viezekapellmeister hatte einen gewissen Anspruch auf die Nachfolge als Kapellmeister16 zumal er den immerkranken Drese in dessen letzten Jahren zunehmend vertreten hatte. Die Stelle ging dennoch auf Dreses Sohn Johann Wilhelm Drese über, der im Vergleich zu Bach doch der musikalischen Mittelklasse zugerechnet werden mußte17.
Auch die herrschende Diskrepanz zwischen Wilhelm Ernst und Ernst August, (dem Neffen seines verstorbenen früheren Mitregenten Johann Ersnt), die alle musikalische Aktivität in Weimar beeinträchtigte18, mag wohl ein Beweggrund gewesen sein das vorliegende Angebot vom Köthener Hof anzunehmen. Dazu holte sich Bach aber nicht die Erlaubnis des Herzogs ein, was die Situation zusätzlich verschärfte. Die zu erwartende Besoldung in Köthen betrug fast das doppelte und mit besseren musikalischen Mitteln an Personal und Instrumentarium war auch zu rechnen, wobei ertsteres sicherlich nicht maßgeblich ausschlaggebend für Bachs Entscheidung war. Das Herzog Wilhelm Ernst sich vor den Kopf gestoßen fühlte ist nachvollziehbar. Auch war ihm als Kunstliebhaber der eventuelle Verlust einer Größe wie Bach ein Dorn in Auge und Seele, so daß er das ,nachgereichte’ Entlassungsgesuch Bachs verständlicherweise ablehnte. Bach stellte darauf hin sein Kantatenschaffen sofort ein, oder gab jedenfalls keine mehr heraus19. Da beide aber, ihrer eigenen Sturheit bewußt, nicht nachgaben, endete dieses Szenario für Bach in einem vierwöchigen Arrest vom 6.11.-2.12.1717, aus dem er in Ungnade entlassen wurde, was auch eine Streichung aus allen Registern der Stadt zur Folge hatte. Der Weg nach Köthen war nun frei, zu einem Preis, den es Bach sicher wert war ihn zu bezahlen.
Finale
In den Weimarer Jahren entwickelte sich Bach zu dem Organisten seiner Zeit schlechthin.
Seine „Halsstarrigkeit“ brachte er sicherlich auch seinen Schülern entgegen was das Üben betraf, so daß durch seine Hände viele spätere Meister gegangen sind. Bach sagte einmal, sich seiner eigenen Größe sicherlich bewußt: „Das ist eben nichts bewunderungswürdiges; man darf nur die rechten Tasten zur rechten Zeit treffen, so spielt das Instrument selbst.“
Wir wissen nicht, ob noch einmal einer kommt, der diesen Satz mit einer solchen Selbstverständlichkeit sagen kann. Wir haben alle unsere liebe Not damit.
-Raphael Michaelis -
[...]
1 nach A.Schweitzer beendete Bach seine Ausbildung erst 1703
2 wieder setzt Schweitzer hier ein Jahr später an
3 nach M.Geck habe sich Bach zwar vor seiner Anstellung am Hofe „hören lassen“, zu welchem Zweck ist aber unbekannt.
4 an dieser Stelle herrscht allgemeine Einigkeit der Quellen
5 Durch die Kürze des Eintrages über Bach vermutete Spitta eine Diskrepanz zwischen Ehrhardt und Bach, die sich aber nicht weiter begründen läßt.
6 nach Berg noch kein echter Dualismus, da die Themen in ihrer Grundstruktur noch zu viele Ähnlichkeiten aufweisen.
7 er eckte auch in Halle damit an, doch der voranschreitende Zeitgeist ließ ihn Recht behalten
8 über die Beziehung zwischen Bach und seiner Frau äußert sich nur C.S.Terry näher, der seine Quelle allerdings auch verschweigt.
9 nach Terry. Geck meint, es sei die Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“ BWV 61 gewesen; ist aber nicht so spektakulär, da man allgemein meint, die Brkümmerniskantate sei in Weimar uraufgeführt worden.
10 im Gegensatz zu Eggebrecht meint Geck, Bach habe von sich aus eine Bewerbung nach Halle geschickt.
11 Die Entstehung des Tintenflecks ist natürlich heute nicht mehr nachzuvollziehen und eher nebensächlich. Es handelt sich hier nur um eine im Laufe der Zeit entstandene Anekdote.
12 Bach hatte kein vehementes Interesse Opern im italienischen Stil zu schreiben, aber die Form derselben erregte vermutlich durch die häufigen und gekonnten Aufführungen am Kasseler Hofe sein Augenmerk.
13 Hier scheiden sich die Geister der Musikgeschichtsschreiber. Auf jeden Fall war Bach durchaus ein Bewunderer Marchands, was sich daran zeigt, daß er sogar Schüler in Weimar Sätze von Marchand hat üben und abschreiben lassen.
14 Mit Bachs wachsenden musikalischen Anspruch in seinen Werken überforderte er häufig Sänger und Instrumentalisten. Am deutlichsten vielleicht in Leipzig mit Antritt des Kantorenamtes an der Thomasschule. (siehe K.A.Findeisen)
15 das zeigt sich vor allem in seinen Solokonzerten.
16 andererseits war es auch geläufig, das ein Amt vom Vater auf den Sohn übertragen wurde.
17 obwohl Johann Wilhelm Drese einige Jahre vor Bachs Amtsantritt von Wilhelm Ernst nach Venedig geschickt wurde, um sich Aufschluß über die dort herrschende Musikszene zu verschaffen und Notenmaterial mitzubringen
18 z.Bsp. wurde von dem Einen dem Orchester befohlen nicht für den Anderen zu spielen und umgekehrt. Aufgrund dessen flüchtete vermutlich der Waldhornist Adam Andreas Reichardt, nachdem sein Entlassungsgesuch verweigert wurde. Er wurde gefaßt und erhängt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Johann Sebastian Bach in Weimar"?
Der Text beleuchtet Johann Sebastian Bachs Zeit in Weimar, insbesondere die Jahre 1708-1717, und untersucht seinen musikalischen Werdegang und seine Einflüsse während dieser Periode. Er behandelt seine Anstellung am Hof, seine kompositorischen Leistungen, seine Beziehungen zu anderen Musikern und seine Schüler.
Was waren Bachs Aufgaben in Weimar?
Bach war Hoforganist und Kammermusicus bei Herzog Wilhelm Ernst in Weimar. Zu seinen Aufgaben gehörte das Komponieren und Aufführen von Musik, insbesondere das Schreiben von Kantaten.
Wer war Herzog Wilhelm Ernst und welche Rolle spielte er in Bachs Leben in Weimar?
Herzog Wilhelm Ernst war Bachs Arbeitgeber in Weimar und ein Förderer der Künste. Er schätzte Bachs Talent und ermöglichte ihm, sich musikalisch zu entfalten. Es gab allerdings später Konflikte, die zu Bachs Weggang führten.
Welchen Einfluss hatte die italienische Musik, insbesondere Vivaldi, auf Bachs Werk in Weimar?
Bach war ein großer Bewunderer Vivaldis und ließ sich von dessen Kompositionen inspirieren. Er bearbeitete viele italienische Instrumentalkonzerte für die Orgel und übernahm Elemente wie die ABA-Form und die bildhafte Darstellung von Stimmungen in seine eigene Musik.
Was ist die Affektlehre und wie beeinflusste sie Bachs Musik in Weimar?
Die Affektlehre war eine musikalische Theorie, die besagte, dass Musik bestimmte Emotionen (Affekte) ausdrücken sollte. Bach legte Wert darauf, dass seine Musik die Affekte des Textes widerspiegelte, und forderte dies auch von seinen Schülern.
Wer waren Bachs Schüler in Weimar?
Zu Bachs Schülern in Weimar gehörten Johann Christoph Ziegler und Johann Martin Schubert. Er unterrichtete sie in Orgelspiel und Komposition und vermittelte ihnen seine musikalischen Prinzipien.
Warum verließ Bach Weimar?
Bachs Weggang aus Weimar war das Ergebnis verschiedener Faktoren. Er fühlte sich bei der Besetzung der Kapellmeisterstelle übergangen, und es gab Spannungen zwischen Herzog Wilhelm Ernst und Ernst August, die das musikalische Leben am Hof beeinträchtigten. Zudem erhielt er ein lukratives Angebot vom Hof in Köthen.
Was geschah nach Bachs Entlassungsgesuch?
Herzog Wilhelm Ernst lehnte Bachs Entlassungsgesuch zunächst ab, woraufhin Bach seine Kantatenaufführungen einstellte. Dies führte schließlich zu einem vierwöchigen Arrest und seiner Entlassung in Ungnade.
Welche Bedeutung hatte Bachs Zeit in Weimar für seine musikalische Entwicklung?
Die Weimarer Jahre waren prägend für Bachs musikalische Entwicklung. In dieser Zeit entwickelte er sich zu einem herausragenden Organisten und Komponisten und schuf einen Großteil seiner Orgelwerke und Kantaten. Er experimentierte mit neuen musikalischen Formen und Einflüssen und prägte seinen eigenen Stil.
Was ist das "Musicalisches Lexicon" von Johann Gottfried Walther?
Das "Musicalisches Lexicon" ist ein von Johann Gottfried Walther, dem Organisten der Stadtkirche in Weimar, zusammengestelltes Nachschlagewerk. Es erschien 1732 in Leipzig und gilt als das erste seiner Art. Es enthält auch die ersten chronologischen Angaben zu Bach und Händel.
- Quote paper
- Raphael Michaelis (Author), 1999, Johann Sebastian Bach in Weimar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96119