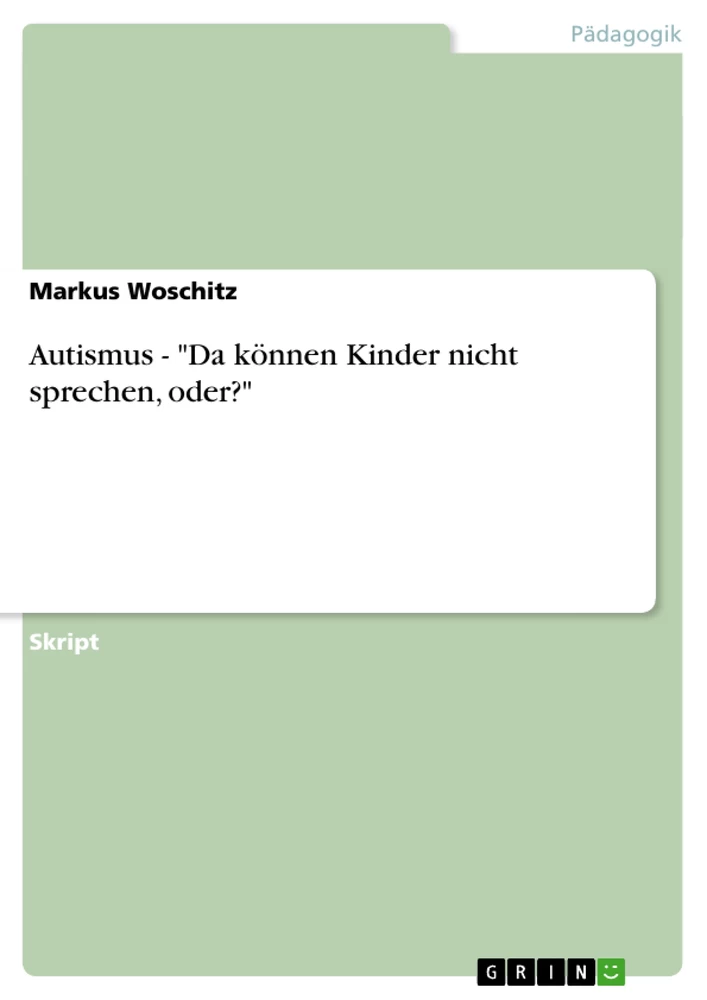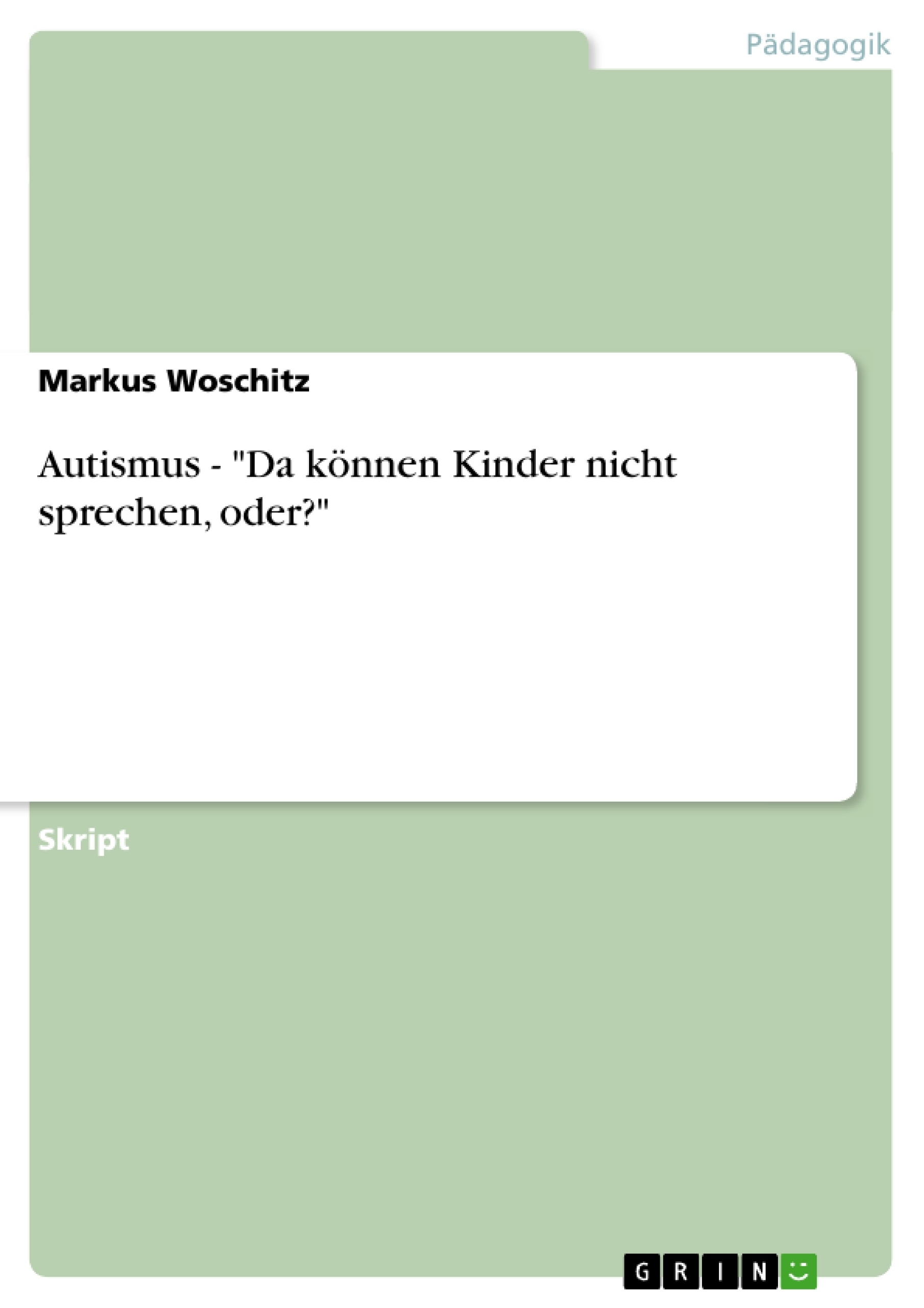Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Kommunikation eine Brücke ist, die sich ständig im Bau befindet, und soziale Interaktion einem Tanz gleicht, dessen Schritte man erst lernen muss. Dieses Buch öffnet eine Tür zu dieser einzigartigen Erfahrungswelt, indem es sich dem frühkindlichen Autismus, auch bekannt als Kanner-Syndrom, widmet. Es ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Eltern, Pädagogen, Sozialarbeiter und alle, die das Verhalten und die Bedürfnisse von Kindern mit Autismus besser verstehen möchten. Die Reise beginnt mit einer klaren Definition des Autismus, wobei die Ursachenforschung von genetischen Veranlagungen bis hin zu neurologischen Besonderheiten reicht. Anschließend werden die vielfältigen Symptome beleuchtet, von den Kernmerkmalen wie sozialer Isolation und dem zwanghaften Bedürfnis nach Gleichförmigkeit bis hin zu sekundären Symptomen wie Sprachstörungen und motorischen Auffälligkeiten. Der Fokus verschiebt sich dann auf die praktische Anwendung des Wissens, indem pädagogische Herausforderungen und geeignete Maßnahmen vorgestellt werden. Verschiedene Therapieansätze werden analysiert, darunter tiefenpsychologische Ansätze, verhaltensorientierte Therapien und die sensorische Integrationstherapie. Ein besonderes Augenmerk wird auf die sozialen Aspekte gelegt, die das Leben von Kindern mit Autismus und ihren Familien prägen. Das Buch zielt darauf ab, eine Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen, um ein tieferes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes Kindes zu fördern. Es bietet wertvolle Einblicke in die Förderung von sozialer Kompetenz, Kommunikation und Selbstständigkeit, um Kindern mit Autismus ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Es ist eine Einladung, Vorurteile abzubauen, Empathie zu entwickeln und die einzigartigen Stärken und Potenziale jedes einzelnen Kindes zu erkennen. Frühkindlicher Autismus, Kanner-Syndrom, Autismus-Spektrum-Störung (ASS), soziale Interaktion, Kommunikation, stereotype Verhaltensweisen, Wahrnehmungsstörungen, Therapieansätze, Verhaltensanalyse, sensorische Integration, Inklusion, Pädagogik, Elternratgeber, soziale Kompetenz, Entwicklungsförderung, Teilhabe, Lebensqualität, Selbstbestimmung, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Autismushilfe, Autismusforschung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
I) Theoretische und medizinische Grundlagen
1.1 Begriffsklärung
1.2 Das Kanner Syndrom
1.3 Ursachen
1.4 Symptome
1.4.1 Kardinalsymptome
1.4.2 Sekundärsymptome
II) Frühkindlicher Autismus in der Praxis
2.1 Pädagogische Probleme
2.2 Pädagogische Konsequenzen
2.3 Therapieformen
2.3.1 Tiefenpsychologischer Ansatz
2.3.2 Verhaltensorientierte Autismustherapie
2.3.3 Führen
2.3.4 Differentielle Beziehungstherapie
2.3.5 Sensorische Integrationstherapie
2.4 Soziale Aspekte
III) Zusammenführung von Theorie und Praxis
IV) Zusammenfassung und Reflexion
Quellenverzeichnis
VORWORT
Am Anfang dieses Schuljahre wurde ich im Rahmen meiner Praxis im Heilpädagogischen Zentrum Hinterbrühl darauf angesprochen, die Freizeitbetreuung für ein autistisches Kind zu übernehmen.
Anfangs wollte ich diese Aufgabe nicht annehmen, da ich viel zu wenig über diese Erkrankung wusste. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit dem Kind umgehen sollte. Es war ein großes Maß an Unsicherheit da. Nach einem Teamgespräch mit den Gruppenerziehern, dem pädagogischen Leiter und dem Therapeuten des Kindes, tat ich mir schon etwas leichter. Um aber dennoch mehr über das Krankheitsbild des frühkindlichen Autismus zu erfahren, habe ich mir dieses Thema für meine Facharbeit aus dem Bereich der Heil- und Sonderpädagogik ausgesucht.
EINLEITUNG
Stefan ist Klient im Heilpädagogischen Zentrum Hinterbrühl. Er ist zwölf Jahre alt und weist starke Symptome des frühkindlichen Autismus auf. Stefan spricht nicht, und er findet nur schwer Vertrauen zu einer Bezugsperson. Dies war auch die Schwierigkeit am Anfang meiner Arbeit mit ihm. Meine konkrete Aufgabe ist es, ihn einmal in der Woche für eineinhalb Stunden zu betreuen.
Am Anfang war es ziemlich schwer heraus zu finden, welche Interessen er hat. Nach einem Gespräch mit den Erziehern wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass Stefan sehr gerne Musik hört. Für ihn ist die Musik eine Möglichkeit sich auszudrücken, sich selbst zu beruhigen. Er wiegt sich zur Musik und erweckt den Eindruck von Zufriedenheit. Und genau diese Zufriedenheit versuche ich ihm in diesen eineinhalb Stunden zu ermöglichen.
Im Laufe meiner Arbeit mit Stefan haben sich viele Fragen für mich gestellt, auf die ich gerne eine Antwort gefunden hätte. Diese Facharbeit soll ein Ratgeber zur Antwortfindung für mich selbst, aber auch für andere sein.
Die wesentlichsten Fragen, die ich dieser Arbeit stelle, sind:
- Was ist frühkindlicher Autismus?
- Welches sind die wesentlichen Symptome und Ursachen
- Welche Ansatzmöglichkeiten für ein erzieherisches Handeln in der Arbeit mit autistischen Kindern gibt es?
- Welche sozialen Aspekte bei Autismus sind für den Erzieher zu beachten?
Ich möchte in meiner Arbeit versuchen einen fließenden Übergang von Theorie und Praxis zu finden. Die Theorie dient für mich als Grundlage des praktischen Teils zur Klärung der einzelnen Begriffe, und um die Thematik überhaupt zu verstehen. Mein Hauptaugenmerk wird aber auf den praktischen Teil gerichtet sein, da ich mir aus dieser Arbeit konkrete Angebote für meine Arbeit als Sozialpädagoge mitnehmen möchte.
I) Theoretische und medizinische Grundlagen
1.1 Begriffsklärung
Die Wortschöpfung Autismus geht auf den bekannten Schweizer Psychiater Eugen Bleuler zurück. Er prägte 1911 die Begriffe «autistisch» und «Autismus». Autismus bedeutet „ selbst “ , und ist griechischen Ursprungs. Natürlich waren die Symptome schon lange bevor es den Begriff Autismus gab bekannt.
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird Autismus folgendermaßen erklärt:
"Eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die durch eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung definiert ist und sich vor dem 3. Lebensjahr manifestiert; außerdem ist sie durch eine gestörte Funktionsfähigkeit in den drei folgenden Bereichen charakterisiert: In der sozialen Interaktion, der Kommunikation und in eingeschränktem repetitiven Verhalten. Die Störung tritt bei Jungen drei- bis viermal häufiger auf als bei Mädchen."
Soweit also die Definitionen. Bei der Verwendung des Begriffes Autismus ist aber Vorsicht geboten, da es im wesentlichen zwei Arten des Autismus gibt. Ich selbst möchte mich, auf Stefan Bezug nehmend, lediglich auf den von Kanner beschriebenen frühkindlichen Autismus beziehen, und deshalb nur diese Form genauer beschreiben.
1.2 Das Kanner-Syndrom (Frühkindlicher Autismus)
Definition: "Form des Autismus, die sich meist vor dem 3. Lebensjahr unter anderem mit Entwicklungsrückstand, Stereotypien, Kontaktstörungen u. verzögerter Sprachentwicklung manifestiert, und eventuell mit einem Intelligenzdefekt einhergeht" (Zitat: PschyrembelKlinisches Wörterbuch, 257. Auflage, 1994, S. 142)
Die Definition beschreibt schon einige Symptome des frühkindlichen Autismus. Der Symptomatik liegen aber verschiedene Ursachen zu Grunde, die ich hier gerne anführen möchte.
1.3. Ursachen
a) Störung der Wahrnehmungsverarbeitung
Das Kind kann die sensiblen und sensorischen Reize aus seiner Umwelt, wahrscheinlich auch aus seinem eigenen Körper, nicht richtig koordinieren. Um sich in der Umwelt zu orientieren, um sich auf die relevanten Dingen zu konzentrieren, bedarf es eines Filters, der das in der aktuellen Situation nicht Notwendige aussondert. Es wird angenommen, dass ein Reglersystem im Gehirn gestört ist.
b) Hirnschädigung als Ursache
In den ersten 1 ½ - 2 Lebensjahren spielen schädigende Einflüsse auf das Gehirn eine wichtige Rolle bei der Erkrankung. Das gilt für Entzündungen verschiedener Art, für Hirnverletzungen ebenso wie für Vergiftungen. Es ist möglich, dass sich auch mangelnde Nährstoff- und Sauerstoffzufuhr zum Gehirn bei schweren Ernährungsstörungen im Säuglingsalter ähnlich auswirken.
Weiter Ursachen bei frühkindlichem Autismus können sein:
- Vererbung
- Abnormitäten des Zentralnervensystems
- Biochemische Störungen
1.4. Symptome
Kommen wir aber nun zu den Symptome, die uns anzeigen können, dass ein Kind am Kanner- Syndrom erkrankt ist. Dieser Punkt ist für einen Sozialpädagogen sehr wichtig, da er, wenn er die Symptome kennt, eine weitere Untersuchung und genaue Differenzierung des Krankheitsbildes bewirken kann. Wir unterscheiden hier zwei Arten von Symptomen:
1.4.1 Kardinalsymptome
- Extreme Abkapselung aus der menschlichen Umwelt
- Ein ängstlich zwanghaftes Bedürfnis nach Gleicherhaltung der dinglichen Umwelt (Veränderungsangst)
Das Wort Kardinalsymptome wurde deshalb gewählt, weil sie bei jeder Erkrankung an frühkindlichem Autismus auftreten, während die Sekundärsymptome individuell unterschiedlich häufig und unterschiedlich stark auftreten.
1.4.2 Sekundärsymptome
- Störung der Intelligenzentwicklung (ist oft nur eine Folge der autistischen Primärsymptomatik, ähnlich kognitiver Behinderungen infolge von Taubheit.)
- Störung der Sprachentwicklung zum Beispiel: Echolalie (wird bei zwei Drittel der betroffenen Kinder festgestellt.)
- Bei den sprechenden Kindern werden oft erstaunliche Gedächtnisleistungen festgestellt, die jedoch meist unwichtige Interessengebiete betreffen. Bei der Sprache werden häufig Neologismen, agrammatische Satzbildungen beobachtet.
- Diverse motorische Auffälligkeiten, die sich auch bei blinden Kindern recht häufig zeigen. (Augenbohren, Hand - Finger Mechanismen, mimische Auffälligkeiten)
- Stereotypien, z. Bsp. Gegenstände werden immer in der gleichen Art und Weise bewegt.
Die Symptome entwickeln sich allmählich während der ersten Lebensjahre und sind im Alter von etwa drei bis vier Jahren am stärksten ausgeprägt. Eine Besserung beginnt in den meisten Fällen ab dem 7. Lebensjahr, sofern der natürliche Ablauf der Krankheit nicht durch falsche Behandlung gehemmt wird. Jedoch scheint in manchen Fällen die Krankheit unaufhaltsam progressiv zu verlaufen.
Der frühkindliche Autismus ist in seinen theoretischen und medizinischen Ausführungen sehr umfangreich. Ich müsste ein Buch verfassen, um sämtliche Theorien und medizinische Gegebenheiten dieser Krankheit zu erläutern. Ich hoffe aber dennoch, dass der Leser sich ein Bild über den Verlauf, die Entstehung und die Symptomatik dieser Krankheit machen kann. Im zweiten Teil meiner Arbeit möchte ich nun auf die Thematik in der Praxis Bezug nehmen. Ich werde versuchen die pädagogischen Aspekte und Schwerpunkte zu beleuchten.
II) Frühkindlicher Autismus in der Praxis
Für jeden Menschen ist es wichtig, Ziele zu haben, weshalb ein jeder versucht sich seine Ziele zu verwirklichen. Auch Kinder haben Ziele, die sie verwirklichen möchten. Auch in der Erziehung gibt es klar definierte Ziele, nämlich den Kindern zu helfen, ein so erfülltes Leben wie möglich zu führen und sie zu vollwertigen Mitbürgern unserer Gesellschaft zu machen. Egal ob das Kind nun gesund oder behindert ist. Die allgemeinen Erziehungsziele sind für behinderte Menschen, wie für normale.
2.1 Pädagogische Probleme bei autistischen Kindern
Es sind die Behinderungen bei frühkindlichem Autismus, die den Erziehungsfortgang erschweren. Man kann diese Behinderungen in drei Gruppen zusammenfassen:
- Biologische Behinderungen (Wahrnehmungs- und Sprachstörungen)
- Sekundäre individuelle Behinderungen: „der Versuch eines Kindes, das zur Kommunikation unzureichend ausgerüstet ist, es mit den Anforderungen seiner Umwelt aufzunehmen, wodurch es sogar in der verständnisvollen Umgebung ein Repertoire sonderbarer Verhaltensweisen entwickelt.“ (J. K. Wing, 1988, S.178)
- Sekundäre soziale Behinderung: „die Reaktion des Kindes auf Umweltbedingungen, die auch bei einem normalen Kind abnormes Verhalten hervorrufen würden. Solche Bedingungen können ihrerseits Reaktionen auf das Verhalten des Kindes sein oder unabhängig davon entstehen.“ J. K. Wing, 1988, S. 178)
Diese drei Arten von Störungen wirken wechselseitig aufeinander ein, und zwar so, dass sich bei jedem Kind eine besondere Struktur gestörten Verhaltens ergibt. Die Verhaltensmuster sind unterschiedlich stark ausgeprägt, womit auch die Lösungen der pädagogischen Probleme individuell gestaltet sein müssen.
2.2 Pädagogische Konsequenzen und Maßnahmen
Die erste Konsequenz ist, dass die Umwelt strukturiert, organisiert und logisch aufgebaut sein soll. Man muss versuchen das autistische Kind zu führen und darf es nicht einfach sich selbst überlassen. Die zweite Konsequenz ist, dass man viel Geduld mit dem Kind in der Phase des Lernens haben muss. Einem Außenstehenden erscheint das Gelehrte trivial. Für das autistische Kind ist es aber eine schwierige Aufgabe. „Eine dritte Konsequenz ist, dass ein Teil des anfänglichen (sozialen) Lernens uneingeweihten Beobachtern „leer“ und sinnlos vorkommen mag. Vielleicht wird einem autistischen Kind beigebracht, seinen Vater zu umarmen, seiner Mutter einen Kuss zu geben [...] ohne dass das Kind versteht, warum es sich so zu benehmen hat.“ (J. K. Wing, 1988, S. 180)
Die Entscheidung, welche pädagogischen Maßnahmen bei einem autistischen Kind erforderlich sind, muss vollkommen unabhängig davon sein, ob es außerhalb der Familie leben soll oder nicht. Das gilt ganz allgemein, besonders aber für Kinder mit schwer gestörtem Verhalten, die auf eine Form von Schulunterricht häufig gut ansprechen. Ein schwer gestörtes Kind darf nicht automatisch als "nicht bildungsfähig" angesehen werden. Man kann unmöglich vorhersagen, ob ein Kind von einem heilpädagogischen Unterricht profitieren wird. Um das zu beurteilen, muss man einen längeren und ernsthaften Versuch in dieser Richtung unternehmen. Wenn man ohne ausreichende Informationen entscheidet, dass ein Kind nur für eine kindergartenähnliche Einrichtung in Frage kommt, in der keine gezielte Unterrichtsarbeit geschieht, so bedeutet das, dass man ihm seine beste Chance zum Vorankommen vorenthält. Der einzige Weg, wenigstens mit einiger Sicherheit herauszufinden, ob ein Kind "bildungsfähig" ist, besteht in dem Versuch, ihm eine Bildung zu geben.
Schon im Vorschulalter, aber auch während des ersten Schuljahres, kann eine Kindergartensituation autistischen Kindern sehr gut tun. Abgesehen davon erhält die Mutter etwas Entlastung von der ständigen Spannung, in der sie lebt, wenn sie das Kind den ganzen Tag über zu Hause hat. Einige autistische Kinder haben in normalen Schulen recht gute Fortschritte gemacht, wenn der Lehrer verständnisvoll und die Klasse klein war, und besonders, wenn sie sich gesittet verhielten und ein bestimmtes Spezialtalent hatten.
Probleme können entstehen, weil das autistische Kind Schwierigkeiten hat, Freundschaften zu schließen, weil es im Verhalten etwas absonderlich ist oder weil ihm das Gefühl für soziale Umgangsformen fehlen.
Die Hauptschwierigkeiten ergeben sich in diesem Fall meist zur Zeit des Schulaustritts, weil Eltern und Lehrer mitunter recht unrealistische Vorstellungen davon haben, was der Jugendliche tun kann, und weil keine Hilfseinrichtungen zur Verfügung stehen, die den Übergang von der Schule zur Arbeitswelt erleichtern. Die meisten autistischen Kinder gehören jedoch nicht in normale Schulen. Zwar ist man in vielen Schulen sehr tolerant und verständnisvoll, selbst wenn die Verhaltensprobleme ziemlich schwerwiegend sind, aber oft sind die Klassen zu groß und die Mitarbeiter ungeübt, um auf autistische Kinder in der richtigen Weise einzugehen. Einige Kinder haben in Sonderschulen für Lernbehinderte gute Fortschritte gemacht, aber es wäre unrealistisch, wenn man erwarten würde, dass dies allgemein zutrifft. Der beste Kompromiss scheint darin zu bestehen, autistischen Kindern in der Schule einen Spezialunterricht zu erteilen und ihnen zu anderer Zeit die Möglichkeit zu geben, mit anderen Kindern zusammen zu sein, die sprechen und spielen können. Dieses Zusammenkommen mit anderen Kindern muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, der dem autistischen Kind helfen kann, am gemeinsamen Tun teilzunehmen; denn sonst zieht es sich vermutlich in einen Winkel zurück und konzentriert sich auf seine eigenen absonderlichen Beschäftigungen.
Es ist wichtig, die Frage der Integration nicht aus dem Auge zu verlieren. Bevor autistische Kinder ein bestimmtes Entwicklungsstadium erreicht haben, profitieren sie allerdings nicht viel davon, wenn sie mit anderen Kindern zusammenkommen. Beobachtet man, wie sie sich in Gegenwart ihrer normalen Geschwister und ihrer Spielgefährten verhalten, so wird man kaum zu der Ansicht gelangen können, dass die Integration an sich schon zu vermehrtem sozialem Verhalten führen wird. Das geschieht nur durch Reifungsvorgänge und durch guten Unterricht und geschickte Lenkung durch Erwachsene.
2.3. Therapieformen und Therapiemöglichkeiten:
Da bei autistischen Kindern Lernen und Erziehen eine wichtige Rolle spielen, sind neben Psychologen, Pädagogen, vor allem Sonderpädagogen auch im Zusammenhang mit der Therapie gefordert. Eine wichtige Aufgabe haben hier aber Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Beschäftigungstherapeuten, Logopäden, Musiktherapeuten und Erzieherinnen. Diese Berufszweige sind es, die die eigentliche therapeutische Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen einzeln und in Gruppen auszuführen haben.
Zur praktischen Durchführung einer Therapie ist es nötig Teilziele zu definieren, da dies eine bessere Überprüfbarkeit der therapeutischen Arbeit ermöglicht. Diese sollten aber möglichst nicht vom einzelnen Therapeuten, sondern von der Gruppe der mit dem einzelnen Kind beschäftigten Bezugspersonen, einschließlich Eltern, Heimbetreuer etc. definiert werden. Abhängig von den verschiedenen Theorien der Ursachen des Autismus existieren verschiedene Ansätze zur Therapie desselben.
2.3.1 Tiefenpsychologische Ansätze
Die wohl ältesten Ansätze basieren auf einer tiefenpsychologischen Sichtweise des Phänomens Autismus.
2.3.2 Verhaltensorientierte Autismustherapie
Die Verhaltensorientierte Autismustherapie nach Ivar Lovaas geht von drei Grundannahmen aus:
A) Autismus ist keine Beziehungsstörung, sondern eine Störung der Wahrnehmung und Kognition.
B) Man muss die Ursachen des Autismus nicht kennen, um die Störung behandeln zu können. Behandlungserfolg besteht im Aufbau wünschenswerten und im Abbau störenden Verhaltens.
C) Auch Nichtfachleute können die Prinzipien der Belohnung und Bestrafung erlernen und anwenden. Die Wirksamkeit der Behandlung ist messbar.
Die isolierte Anwendung lerntheoretischer Erkenntnisse kann Aggressionen fördern, weil hier die Gefahr einer unangemessenen Förderung unauffälligen Verhaltens besteht. Schließlich wird das obengenannte wünschenswerte Verhalten nicht vom betroffenen autistischen Menschen, sondern von seinem Therapeuten bestimmt.
2.3.3 Führen
Der Förderansatz des Führens, der sich an alle wahrnehmungsgestörten Kinder richtet, geht von folgenden Voraussetzungen aus:
A) Verhaltensänderung und Lernen sind auf Spürinformationen (taktile Reize) angewiesen und erfolgen in Stufen.
B) Ohne therapeutische Unterstützung erhalten wahrnehmungsgestörte (also auch autistische) Kinder nur ungenügende Spürinformationen.
C) Gespürte Informationsvermittlung kann über das Führen verschiedener Teile des Körpers - auch bei Schwerstgeschädigten - erfolgen.
Beim Führen soll im Rahmen "problemlösender Alltagsgeschehnisse" den Kindern durch das Führen meist der Hände das Erreichen bestimmter gewünschter Wirkungen ermöglicht werden. Die Kinder sollten in allen möglichen täglichen Situationen geführt werden. Dies macht das Familienleben nicht unbedingt leichter.
2.3.4 Differentielle Beziehungstherapie
Bei der Differentiellen Beziehungstherapie versucht der Therapeut in den ersten Wochen sich gegenstandstypische Eindeutigkeitseigenschaften anzueignen. Er bringt sich als »Objekt« in stereotype Verhaltensmuster des autistischen Kindes ein. Später soll dann der Therapeut immer mehr aus der Rolle des Objekts in die eines Subjekts wechseln, um so dem Kind die Möglichkeit zu geben, ein seinen Fähigkeiten entsprechendes Maß an sozialen Kompetenzen zu erwerben.
Janetzke hebt hierbei hervor, dass mit dieser Methode bei Kindern recht gute Erfahrungen gemacht wurden, die Erfolgsaussichten für Jugendliche und Erwachsene eher gering sind.
2.3.5 Sensorische Integrationstherapie
Bei der sensorischen Integrationstherapie handelt es sich nicht um ein spezielles, auf Autismus konzentriertes Konzept. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass Autismus zum Teil Folge einer gestörten Wahrnehmungsverarbeitung ist. Auf das Kind einströmende Reize können nicht entsprechend differenziert und verarbeitet werden - Verschiedene Reize erreichen erst gar nicht das Gehirn.
Es soll nun versucht werden, für das Kind Reize zu schaffen, die es erreichen, andere Reize sollen vermindert oder ganz erspart werden.
Der Markt an verschiedenen Konzepten der Autismustherapie ist wahrscheinlich noch größer, als die Anzahl der verschiedenen Theorien zur Begründung des Symptoms. Dabei ist es für betroffene Eltern oft nicht leicht zwischen erfolgversprechenden Ansätzen und weniger aussichtsreichen, manchmal sogar betrügerischen Ansätzen zu unterscheiden.
2.4 Soziale Aspekte
Kommt ein autistisches Kind in eine fremde Umgebung, z.B. in eine ärztliche Klinik, in ein Heim mit einem neuen Sozialpädagogen oder in eine neue Schule, so fällt es in seinem Verhalten oft auf eine primitivere Stufe zurück. In einer vertrauten Umgebung ist es dagegen meist weniger in sich zurückgezogen, freundlicher, lebhafter und kooperativer, bereitet aber andererseits auch viele Schwierigkeiten. Der Sozialpädagoge muss sich des jeweiligen Einflusses vieler verschiedener Faktoren auf das Verhalten des Kindes bewusst sein, damit er die Bedeutung jeder einzelnen Situation abschätzen und daraufhin praktische Ratschläge für den Umgang mit dem Kind geben kann.
Für das Verhalten des Klienten trägt , wie wir schon gehört haben, sehr oft sein Umfeld die Verantwortung. Die primären Behinderungen, die am Anfang erklärt wurden, führen zu zahlreichen und verschiedenartigen sekundären Folgeerscheinungen. Die Eltern können es im Grunde gar nicht vermeiden, dass sie beim Umgang mit dem Kind viele Fehler machen. Die Methoden der Kindererziehung, die sie alle in irgendeiner Weise gelernt haben, sind natürlich auf die Bedürfnisse eines Kindes ausgerichtet, dass etwa zur gleichen Zeit laufen und sprechen lernt.
Von autistischen Kindern weiß man in der Öffentlichkeit nichts. Die Leute haben davon gehört, dass Kinder geistig zurückgeblieben oder hochgradig schwachsinnig sein können und haben eine gewisse Vorstellung davon, aber autistisches Verhalten ist etwas völlig Unerwartetes. Den Eltern stehen keine fertigen Redensarten zur Verfügung, auf die sie zurückgreifen können, um anderen Menschen das schwierige Verhalten zu erklären. Ihr Kind ist vielleicht destruktiv, nicht sauber und hat schreckliche Tischmanieren, und all das macht die Familie bei Freunden und Nachbarn unbeliebt und kann das gesellige Leben auf ein Minimum reduzieren. Erklärungen anderer Leute reichen von "Es ist taub" oder "Es ist verwöhnt" bis zu "Es ist eben schwachsinnig".
Wenn die Eltern schließlich den Entschluss fassen, Fachleute zu konsultieren, dann sind sie gewöhnlich unglücklich, verwirrt, voller Schuldgefühle und vollkommen ohne Vertrauen in ihre Fähigkeit, das eigene Kind zu erziehen. Je früher die Familie beraten wird, und je realitätsbezogener und empirisch fundierter diese Beratung ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man einmal die Empfehlung geben muss, die Erziehung des Kindes den Eltern völlig aus der Hand zu nehmen.
Sobald die schlimmsten Verhaltensprobleme überwunden oder mit zunehmender Reife verschwunden sind, kann ein autistisches Kind lernen, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält. Sein Erfahrungskreis wird hierzu allmählich ausgeweitet. Vernünftigerweise sind die Unternehmungen zunächst nur kurz - ein Kaffeebesuch bei einer befreundeten Familie oder eine Stunde im Zoo. Später kann die Zeit ausgedehnt werden. Das Kind soll Erfahrungen mit möglichst vielen Tätigkeiten des alltäglichen Lebens sammeln: wie man in einem Restaurant isst, mit Bus und Bahn fährt usw.
III) Zusammenführen von Theorie und Praxis
Dieser dritte und letzte Teil dient der Zusammenführung von Theorie und Praxis, wobei ich aber betonen möchte, dass eine absolute Trennung der beiden ersten Teile nicht möglich war. Aus diesem Grunde wird ein Zusammenführen des praktischen und theoretischen Teils nur insofern möglich sein, als dass ich mich auf den Fall von Stefan, den ich anfangs geschildert habe, beschränken werde.
Erinnern wir uns an Stefan. Er ist ein Kind von zwölf Jahren und an frühkindlichem Autismus erkrankt, wobei er eine stark ausgeprägte Symptomatik im Bereich der Motorik und der Sprachentwicklung hat. Er kann nicht sprechen, artikuliert seine Bedürfnisse aber mit Hilfe von Lauten, die er meistens aus sich herausschreit. Außerdem „klammert“ sich Stefan ständig an seinen Becher. Es ist für ihn eine stereotype aber beruhigende Aktion.
Aus der Theorie konnte ich für mich sehr viele interessante Informationen zur Entstehung der Krankheit, aber auch über seinen Verlauf erfahren. Eine Antwort auf die Frage was die Ursachen für Stefans Erkrankung sind, konnte ich aber leider nicht finden, da sich die Wissenschaft selbst nicht einig ist, welche Faktoren genau das Kanner-Syndrom begünstigen. Interessanter war für mich der praktische Teil der Arbeit, aus der ich einige gute Ansätze finden konnte, wie ich die Beziehung zu Stefan verbessern kann. Außerdem konnte ich mir einiges an Hintergrundinformation zu möglichen Therapien aneignen.
Weiters sei hier noch erwähnt, dass mir besonders die pädagogischen Maßnahmen wichtig erscheinen, weil sie mir einen Weg zeigen, wie ich mit Stefan umgehen kann, ohne befürchten zu müssen, etwas falsch gemacht zu haben. Was die Therapien anbelangt, war ich eigentlich überrascht, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die Symptome des frühkindlichen Autismus zu behandeln. Auf meine Arbeit mit Stefan wird dies aber keinen wesentlichen Einfluss haben, da ich als Freizeitbetreuer fungiere und nicht als Therapeut.
IV) Zusammenfassung und Reflexion
Die Themenwahl war einfach, da ich mit dieser Krankheit im beruflichen Teil zu tun hatte. Die Sondierung der Themen, die ich aus diesem großen Gebiet herausnehmen wollte, gestaltete sich nicht sehr einfach, da die Fragen, die ich mir anfänglich selber stellte, zu komplex waren. Schließlich habe ich es dann doch geschafft, die wesentlichsten Punkte aus der Theorie und der Praxis anzuführen, die da wären:
- Begriffsklärung
- Ursachen
- Symptome
- Pädagogische Probleme und Maßnahmen
- Therapieformen
- Soziale Aspekte
Ich glaube, dass ich auf die Fragen ganz gut eingegangen bin, und auf alle eine Antwort gefunden habe. Zum Aufbau der Arbeit möchte ich noch bemerken, dass ich mich sehr an die Vorlage gehalten habe, um dem Leser ein gut strukturiertes und interessantes Skriptum zur Thematik des frühkindlichen Autismus zur Verfügung stellen zu können.
Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat, da ich auch sehr gut die Angebote aus dem Internet nutzen konnte. Erschwerend für mich war es aber, dass so viele Wissenschafter sehr stark divergierende Ansichten zu diesem Thema haben.
Ich kann also nur hoffen, dass ich mit meiner Arbeit dem Leser ein objektives Bild über die Krankheit des frühkindlichen Autismus geben konnte, und in ihm das Interesse geweckt habe, sich mit den Kindern, die an diesem Syndrom erkrankt sind, auseinander zu setzen.
Meine Arbeit möchte ich mit einem Zitat beenden, welches meiner Meinung nach passender nicht sein kann.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über frühkindlichen Autismus?
Dieses Dokument ist ein umfassender Überblick über frühkindlichen Autismus (Kanner-Syndrom). Es behandelt theoretische und medizinische Grundlagen, praktische Aspekte in der pädagogischen Arbeit, Therapieformen und soziale Aspekte.
Was sind die Hauptpunkte des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst: Vorwort, Einleitung, theoretische und medizinische Grundlagen (Begriffserklärung, Kanner-Syndrom, Ursachen, Symptome), frühkindlicher Autismus in der Praxis (pädagogische Probleme, Konsequenzen, Therapieformen, soziale Aspekte), Zusammenführung von Theorie und Praxis, Zusammenfassung und Reflexion sowie ein Quellenverzeichnis.
Wie definiert das Dokument Autismus?
Autismus wird als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung definiert, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert und durch Beeinträchtigungen in sozialer Interaktion, Kommunikation und repetitiven Verhaltensweisen gekennzeichnet ist.
Was ist das Kanner-Syndrom?
Das Kanner-Syndrom, auch frühkindlicher Autismus genannt, ist eine Form von Autismus, die sich meist vor dem 3. Lebensjahr manifestiert. Die Symptome sind Entwicklungsrückstand, Stereotypien, Kontaktstörungen und verzögerte Sprachentwicklung, manchmal einhergehend mit einem Intelligenzdefekt.
Welche Ursachen für frühkindlichen Autismus werden genannt?
Mögliche Ursachen sind Störungen der Wahrnehmungsverarbeitung, Hirnschädigung (Entzündungen, Verletzungen, Vergiftungen, Mangelernährung), Vererbung, Abnormitäten des Zentralnervensystems und biochemische Störungen.
Welche Symptome sind typisch für frühkindlichen Autismus?
Kardinalsymptome sind extreme Abkapselung aus der menschlichen Umwelt und ein zwanghaftes Bedürfnis nach Gleicherhaltung der dinglichen Umwelt (Veränderungsangst). Sekundärsymptome umfassen Störungen der Intelligenzentwicklung und Sprachentwicklung (z.B. Echolalie), motorische Auffälligkeiten (Augenbohren, Hand-Finger-Mechanismen), Stereotypien und Neologismen in der Sprache.
Welche pädagogischen Probleme treten bei autistischen Kindern auf?
Es werden biologische Behinderungen (Wahrnehmungs- und Sprachstörungen), sekundäre individuelle Behinderungen (besondere Verhaltensweisen als Reaktion auf unzureichende Kommunikation) und sekundäre soziale Behinderungen (Reaktionen auf Umweltbedingungen) genannt.
Welche pädagogischen Konsequenzen werden vorgeschlagen?
Die Umwelt soll strukturiert und organisiert sein, das Kind soll geführt und nicht sich selbst überlassen werden. Geduld und Verständnis sind wichtig, und ein Teil des Lernens mag uneingeweihten Beobachtern sinnlos erscheinen.
Welche Therapieformen werden beschrieben?
Es werden tiefenpsychologische Ansätze, verhaltensorientierte Autismustherapie nach Lovaas, Führen, Differentielle Beziehungstherapie und sensorische Integrationstherapie beschrieben.
Welche sozialen Aspekte sind im Umgang mit autistischen Kindern wichtig?
Der Sozialpädagoge muss sich der Einflüsse der Umgebung auf das Verhalten des Kindes bewusst sein. Die Eltern benötigen Unterstützung und Beratung. Der Erfahrungskreis des Kindes soll allmählich erweitert werden.
Was wird im dritten Teil des Dokuments behandelt?
Der dritte Teil führt Theorie und Praxis zusammen, indem er sich auf den Fall eines Kindes namens Stefan bezieht, der an frühkindlichem Autismus leidet und stark ausgeprägte Symptome in Motorik und Sprachentwicklung zeigt.
Was ist die abschließende Zusammenfassung und Reflexion?
Die Arbeit hat dem Autor viel Spaß gemacht, insbesondere durch die Nutzung von Internetangeboten. Erschwerend war, dass es viele stark abweichende Ansichten von Wissenschaftlern zu diesem Thema gibt.
- Quote paper
- Markus Woschitz (Author), 2000, Autismus - "Da können Kinder nicht sprechen, oder?", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96083