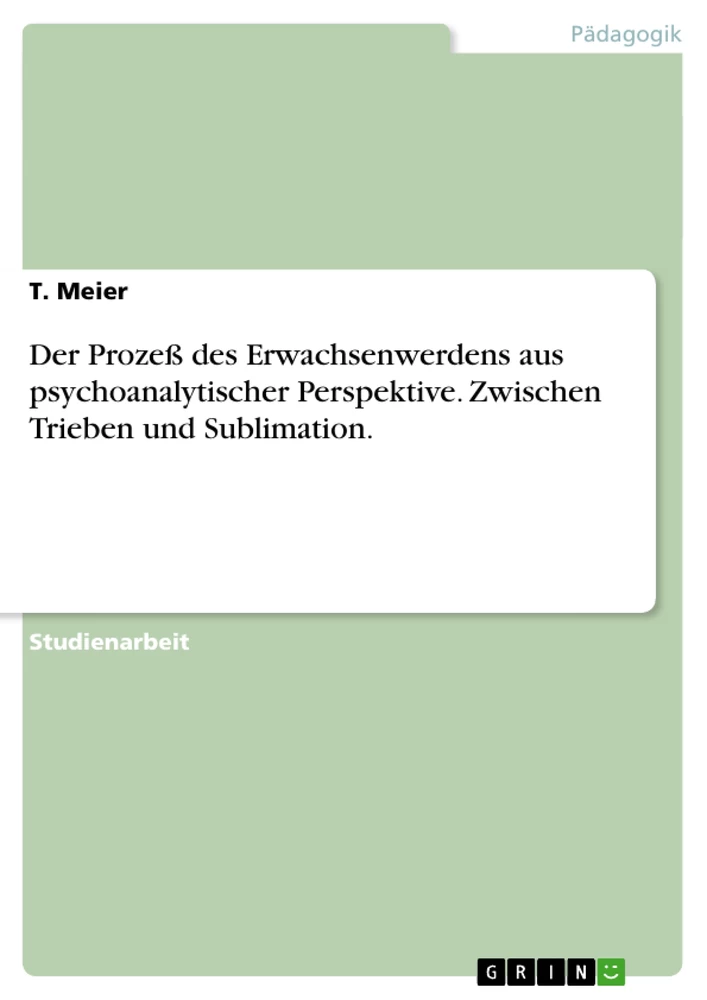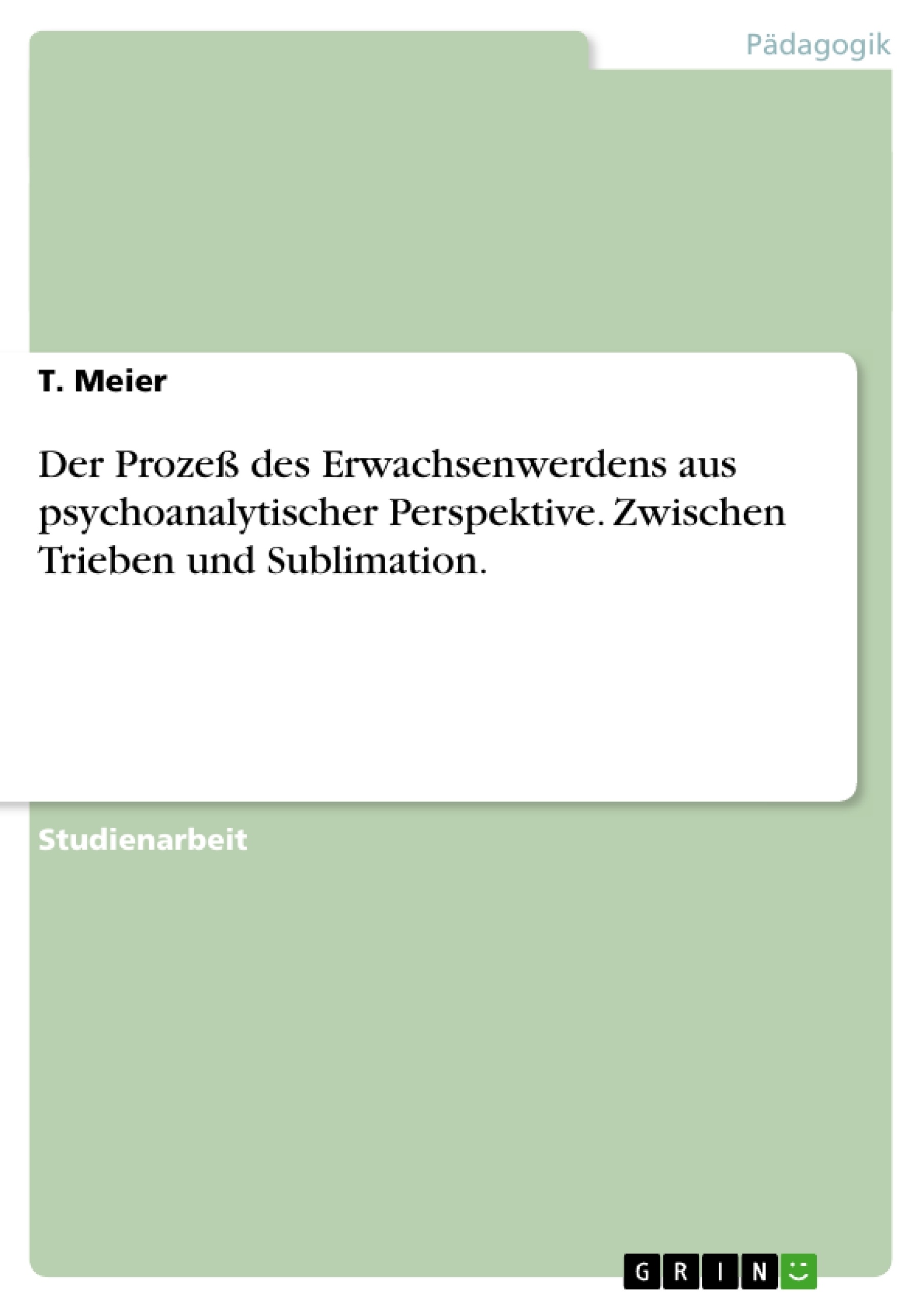„Der Vater der Psychoanalyse“
Wenn bei der Psychoanalyse von einem „Vater“ gesprochen wird, kann nur Freud gemeint sein. Er war ihr Begründer und auch heutzutage gelten seine Vermutungen und Forschungsergebnisse noch immer. Doch wie ist Freud zu seinen Theorien von „Trieben“, „Libido“ und „Es“ gekommen? Dazu möchte Ich ihnen seine Biographie vorstellen.
Sigmund Freud wurde am 6.5.1856 in Freiburg in Mähren geboren. Sein eigentlicher Name war Sigismund Schlomo Freud, den er im Alter von 22 Jahren in Sigmund umändern ließ. Er hatte zwei Stiefgeschwister, die sein Vater Jakob mit in die Familie brachte. Für seine Mutter Amalie war er das erste Kind. Sigmund Freud war Jude. 1860 zog die Familie nach Wien um, da das Geschäft seines Vaters ruiniert war. 1865 besuchte Freud ein Jahr früher als gewöhn- lich das Gymnasium in Lyzeum. 1870 las er das vollständige Werk von Ludwig Börne (*1), was großen Einfluss auf seine Zukunft nahm. Freud bestand 1873 sein Abschlussexamen, wobei man vor allem seinen deutschen Stil bewunderte. Ursprünglich wollte Freud Jura stu- dieren, entschloss sich dann aber doch für Medizin. Er hörte Vorlesungen des Philosophen Franz von Brentano. 1876 führte er erste Forschungen über die Geschlechtsdrüsen der Aale und das zentrale Nervensystem der Neunaugenlarve. Seit 1878 war er befreundet mit Josef Breuer, welcher ihm moralisch und finanziell half. Freud näherte sich der Entdeckung des Neuron (Bestandteil des Nervensystems). 1879 besuchte Freud Vorlesungen von Meynert, war jedoch nicht interessiert, sein ganzes Interesse galt der Neurologie. 1880 leistete Freud ein Jahr Militärdienst und überlegte statt medizinischer Praxis in die Forschung zu gehen.
1881 machte Freud das Abschlussexamen in Medizin. 1882 entdeckte Freud die schmerzbe- täubende Wirkung von Kokain. Er lernte die Jüdin Martha Barnays kennen. 1884 schrieb Freud eine Monographie über die Kokapflanze. Er begann „nervöse“ Krankheiten mit der Elektrotheraphie zu behandeln. Sigmund Freud verlor infolge Ansehen in der Medizin. 1885 ging Freud mit einem Stipendium zur Jean - Martin - Charcot Fakultät nach Paris. Dort lernte er einige Fälle von Hysterie und die Auswirkungen der Hypnose kennen. Er war von Charcot derart begeistert, dass er ihm seine Vorlesungen übersetzte. 1886 ließ sich Freud als Nerven- arzt und Hypnosetherapeut in Wien nieder und arbeitete als Dozent für Neuropathologie. Er heiratete Martha Barnays. Mit ihr hatte Freud sechs Kinder. 1895 veröffentlichte Freud zu- sammen mit Josef Breuer das Werk „Studium über Hysterie“, das erste Grundlagen der Psy- choanalyse enthielt. Freuds Vorlesung über sexuellen Ursachen der Hysterie wird mit Be- fremden aufgenommen. 1897 entwickelte er die Theorie vom Ödipuskomplex (*2). 1899 er- scheint sein Werk „Die Traumdeutung“. 1901 veröffentlicht Freud die „Psychopatologie des Alltagslebens“. 1919 starb seine Tochter Sophie. Sein Werk „Jenseits des Lustprinzip“ er- scheint. 1923 wurde Freud aufgrund eines Lippenkrebs operiert. Er veröffentlichte „Das Ich und das Es“. 1933 ergriffen die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht und Freuds Werke wurden in Berlin von den Nazis verbrannt. Freud führte Briefwechsel mit Albert Ein- stein zum Thema Krieg. 1939 starb Sigmund Freud in London.
Anm.:
(*1) Geboren am 12. Februar 1837 in Frankfurt. Gestorben am 6. Mai in Paris. Börne war Schriftsteller des Jungen Deutschland. Er setzte sich leidenschaftlich für die Demokra- tie als Voraussetzung für soziale und geistige Freiheit ein.
(*2) Begründet in der griechischen Mythologie. Den Eltern vom kleinen Ödipus wurde prophezeit, dass Ödipus seinen Vater umbringen und seine Mutter heiraten wird.
Was untersucht die Psychoanalyse?
Die Psychoanalyse ist eine wissenschaftliche Disziplin, die von Sigmund Freud begründet wurde und mit seinem Namen auch heute noch unlösbar verknüpft ist. Ihr Beginn lässt sich nicht genau datieren, da er sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstreckte. Um 1805 jedoch war die Entwicklung der Psychoanalyse schon in vollem Gange. Wie jede andere wissenschaftliche Disziplin hat die Psychoanalyse zur Entstehung gewisser Theorien geführt, die aus ihren Beobachtungsdaten abgeleitet sind und diese Daten zu ordnen und zu erklären versuchen. Was wir die psychoanalytische Theorie nennen ist deshalb ein System von Hypo- thesen über die Funktionsweise und Entwicklung der menschlichen Psyche.[...] Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die psychoanalytische Theorie sich ebenso mit dem normalen wie mit dem pathologischen (*1) Funktionsablauf der Psyche befaßt. Sie ist kei- neswegs nur eine Theorie der Psychopathologie. Es ist richtig, dass die Praxis der Psychoana- lyse in der Behandlung von Menschen besteht, die psychisch krank oder gestört sind.[...] Wie bei jeder wissenschaftlichen Disziplin sind auch die verschiedenen Hypothesen der psy- choanalytischen Theorie untereinander verknüpft. Einige davon sind natürlich von fundamen- talerer Bedeutung als andere und einige haben eine so nachhaltige Bestätigung erfahren und erscheinen in ihrer Bedeutung so fundamental, dass wir geneigt sind, sie als feststehende Ge- setze der Psyche anzusehen.
Zwei solche fundamentale Hypothesen, die durch eine Fülle von Beweisen bestätigt wurden sind: das Prinzip der psychischen Determiniertheit (*2) oder die Kausalität und der Satz, dass Bewusstheit eher ein außergewöhnliches als ein regelmäßiges Attribut psychischer Prozesse ist. Um letzteren Satz etwas anders auszudrücken, können wir auch sagen, dass nach der psy- choanalytischen Theorie unbewusste psychische Vorgänge sowohl bei normalem wie bei ab- normalem Funktionieren der Psyche von sehr großer Häufigkeit und Bedeutung sind. [...]
Ich möchte mit dem Prinzip der psychischen Determiniertheit beginnen. Der Sinn dieses Prin- zips ist, dass in der uns umgebenden physischen Natur auch in der Psyche nichts zufällig oder aufs Geratewohl geschieht. Jedes psychische Geschehen wird durch die Vergangenheit deter- miniert. Wenn Geschehnisse in unserem psychischen Leben zufällig und mit dem, was voran- ging, nicht verknüpft zu sein scheinen, so ist das eben nur scheinbar der Fall. In Wirklichkeit ist bei psychischen Phänomenen ein solches Fehlen kausalen Zusammenhangs genauso un- möglich wie bei physischen. Diskontinuität in diesem Sinne existiert im psychischen Leben nicht. Das Verständnis und die Anwendung dieses Prinzips ist für die richtige Einstellung beim Studium der menschlichen Psychologie sowie in ihren normalen, wie in ihren pathologischen Aspekten unerlässlich. Wenn wir es wirklich verstehen und richtig anwenden, werden wir niemals eine psychische Entscheidung als sinnlos oder zufällig abtun. Wir werden uns in Bezug auf jedes derartige Phänomen, das uns interessiert fragen: „Wodurch wurde es verursacht? Warum geschah es auf diese Art und Weise?“ [...]
Ein Beispiel für diesen Zugang zu psychischen Phänomenen: Es ist eine häufige Erfahrung im täglichen Leben, dass man etwas vergisst oder verlegt. Die übliche Meinung über ein solches Vorkommnis ist, dass es „Zufall“ war, dass es „halt geschah“. Aber eine gründliche Untersu- chung solcher „Zufälle“ durch Psychoanalytiker in den letzten fünfundsiebzig Jahren, mit den Untersuchungen Freuds selbst angefangen, hat gezeigt, dass sie keineswegs zufällig sind, wie sie dem üblichen Urteil erscheinen. Im Gegenteil, es lässt sich zeigen, dass jeder solcher „Zu- fälle“ durch einen Wunsch oder eine Absicht der betreffenden Person verursacht wurde, in genauer Übereinstimmung mit dem Prinzip der psychischen Funktionsweise, über das wir sprachen. [...]
Wenn wir uns jetzt den Erscheinungen der Psychopathologie zuwenden, so werden wir erwar- ten, dass das gleiche Prinzip gilt, und in der Tat haben Psychoanalytiker unsere Erwartungen immer wieder bestätigt. Jedes neurotische Symptom, welcher Natur es auch sei, ist durch an- dere psychische Prozesse verursacht, trotz der Tatsache, dass der Patient selbst oft glaubt, das Symptom sei seinem ganzen Wesen fremd und völlig ohne Zusammenhang mit seinem übrigen psychischen Leben. [...]
An diesem Punkt kommen wir nicht mehr um das Eingeständnis herum, dass wir nicht nur von der ersten unserer grundlegenden Hypothesen sprechen, dem Prinzip der psychischen Determiniertheit, sondern auch von der zweiten, nämlich der Existenz und Bedeutsamkeit psychischer Prozesse, die der Einzelne selbst nicht bemerkt oder die ihm nicht bewusst sind. (Anm.: vorhandenes Unterbewusstsein steuert das bewusste Handeln.) Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Hypothesen ist tatsächlich so eng, dass man kaum die eine erörtern kann, ohne auch die andere einzubeziehen. Gerade die Tatsache, dass so viel von dem, was sich in unserer Psyche abspielt, unbewusst ist, d.h. uns selbst unbekannt, ist der Grund für die scheinbaren Diskontinuitäten in unserem psychischen Leben. Wenn ein Gedanke, ein Gefühl, ein zufälliges Vergessen, ein Traum oder ein pathologisches Symptom keinen Zusammenhang mit dem zu haben scheint, was zuvor in uns vorging, so kommt das daher, dass dieses Geschehen mit einem unbewussten, nicht mit einem bewussten, psychi- schem Vorgang in Kausalzusammenhang steht. Wenn die unbewusste Ursache oder die un- bewussten Ursachen entdeckt werden können, dann verschwinden alle scheinbaren Diskonti- nuitäten, und die Kausalkette, der kausale Ablauf wird deutlich.
(Charles Brenner, Grundzüge der Psychoanalyse, Fischer, Frankfurt a. M. 1994, S. 14-17)
Anm.:
(*1) Pathologie = Wissenschaft von den Krankheiten pathologisch = krankhaft
(*2) Determiniertheit = Bestimmtheit, Abhängigkeit des (unfreien) Willens.
Der topographische Aspekt (griech.: topos = der Ort):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Bewusst: Sind Inhalte, um die wir spontan wissen oder m.a.W., alles was uns gedanklich präsent ist.
- Vorbewusst: Sind im dynamischen Sinne Inhalte, um die wir nicht spontan wissen, die jedoch nach einer Bemühung wieder relativ bewusst zugänglich sind. Im deskriptiven Sinne ist auch das Vorbewusste unbewusst.
- Unbewusst: Sind im dynamischen Sinne Inhalte, die gegenüber des Bewusstseins so gründlich versperrt sind, dass sie durch allen noch so bemühten Einsatz von eigenem Denken und Wollen niemals zugänglich werden. Im deskriptiven Sinne ist das Unbewusste ein psychischer Vorgang, der derzeit aktiv ist, ohne dass wir es wissen.
Der dynamische Aspekt (Freudsche Triebtheorie):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Mischverhältnis der beiden Triebe ist bedeutsam für die Persönlichkeitsentwicklung
(z.B.: Guter Liebhaber - Triebtäter). Bei ausgeglichenen Menschen beträgt es 50/50 und wird duales Verhältnis genannt.
Sexualität im erweiterten Sinne: Alles, was mit sinnlich, körperlicher Wollust und dranghafter Begierde, oder mit anderen Worten mit Lust und Liebe zu tun hat.
Der strukturelle Aspekt (der psychische Apparat):
Instanz: zuständige Stelle
Freud: „Ein Neugeborenes ist ein polymorph perverses Triebbündel“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der genetische Aspekt:
(Genere: Entwicklung)
Beachte: Erweiterte Sexualität nach Freud
Die psychosexuelle Entwicklungstheorie Freuds:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erwachsene erleben oft ein partielles Steckenbleiben in der oralen Phase, da sie in ihr während der oralen Stufe Befriedigung gefunden haben (rauchen, KGK, Freude u.s.w.). Dies gilt auch für die anale Phase: Freude an anrüchigen Witzen.
Kinder können an der oralen und analen Phase verhaften, wenn ein Liebesobjekt, wie die Mutter, nicht vorhanden ist bzw. ihnen weggenommen wird. Sie können die Kräfte ihrer Libido nicht binden. Zur Stabilisierung des seelischen Gleichgewichts zieht man sich auch diese Phasen zurück, wenn eine reale Situation eine hohe Belastung darstellt (Geburt einer Schwester/ eines Bruders und damit Vernachlässigung).
Kräftespiel der Instanzen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abwehrmechanismen:
Im Laufe des Erwachsenwerdens werden diese Triebe von der Gesellschaft so zurechtgebogen, dass der Mensch nicht negativ auffällt. Dies geschieht im eigenen Interesse des Menschen. Die Triebe des Menschen werden unbewusst durch die folgenden Abwehrmechanismen zurückgehalten. Die Abwehrmechanismen wirken somit als sozialisationsfördernde Instanzen. Es gibt folgende 14 Abwehrmechanismen:
- Neutralisierung: emotionale Distanzierung von peinlichen Frustrationen, Zuständen und Erlebnissen, wie z.B. Behinderungen.
- Vermeidung: Situationen, die zu einem Konflikt führen, werden trotz ihres Reizes be- wusst vermieden.
- Verzicht: Zwei oder mehrere zuwiderlaufende Triebwünsche; auf einen muss zumindest verzichten werden.
- Verschiebung: Konfliktbewältigung durch Lösen vom ursprünglichen Triebobjekt auf Ersatzobjekt auf gleicher Ebene überwechselt. (Beispiel)
- Kompensation: Wechsel von Triebobjekt auf Ersatzobjekt auf niedrigerer Ebene
- Sublimierung: Wechsel von ursprünglichen Triebobjekt auf Ersatzobjekt auf höherer E- bene.
- Verleugnung: Ein Nicht - wahr - haben - wollen / Verleugnung einer Unannehmlichkeit.
- Verdrängung: „Ich“ drängt unerwünschten „Es“ - Impuls (Trieb) ins Unbewusste zurück, bleibt weiterhin bestehen und beeinflusst das Verhalten.
- Regression: Zurückfallen in eine bereits überwundene Phase der Entwicklung.
- Fixierung: Siehe Regression; der Fixierte erreicht Ausgangspunkt des Zurückfallens (Regredierens) jedoch gar nicht. Dadurch kommt es zu einem „Festkleben" an einem be- stimmten Punkt.
- Reaktionsbildung: Verdrängte Impulse werden in ihr Gegenteil verkehrt.
- Projektion: Eigenschaften und eigene unzulängliche Triebregungen werden auf andere Personen übertragen.
- Somatisierung: Verlagerung von scheinbar unlösbaren psychischen / sozialen Problemen in körperliche Krankheitssymptome.
- Rationalisierung: Zurechtlegen von Situationen und eigenen Verhaltensweisen, die objek- tiv betrachtet falsch sind und nur der subjektiven Rechtfertigung und Gewissensberuhigung dienen. Handeln soll logisch erscheinen.
Beispiel:
Um die Funktionsweise dieser Abwehrmechanismen aufzuschlüsseln füge ich ein Beispiel ein.
Herr X., passionierter Kettenraucher, will mit dem Rauchen aufhören, weil er gelesen hat, dass Rauchen schädlich ist und mehrere tausend Menschen im Jahr davon Lungenkrebs be- kommen.
Der psychische Apparat des Herrn X. in dieser Situation:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
a) Das Verlangen nach eine Zigarette kommt nicht auf. Herr X schafft es ohne Schwierigkei- ten sich das Rauchen abzugewöhnen. (Verdrängung)
b) Herr X versucht seine Sucht zu bekämpfen. Jedesmal, wenn er eine Zigarette rauchen möchte, isst er statt dessen etwas Süßes. (Verschiebung)
c) Herr X greift nach einer Weile doch wieder zur Zigarette, nimmt sich aber vor, zum Aus- gleich viel Sport zu treiben. (Sublimierung)
d) Herr X raucht wieder und denkt sich: „Ich werde schon nicht krank! Wenn man nicht die Veranlagung zu Krebs hat, bekommt man auch trotz Rauchen keinen. Herr A von nebenan hat auch 50 Zigaretten am Tag geraucht und ist doch 80 Jahre alt geworden. (Rationalisie- rung)
Störung der Persönlichkeit nach Freud:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Entstehung von Neurosen und Perversionen:
(siehe: Störungen der Persönlichkeit nach Freud)
Der Mensch ist ein konfliktträchtiges Wesen zu dessen Alltag es gehört, Konflikte zu bewäl- tigen. Nach Freuds strukturellem Aspekt ist das Ich diejenige Instanz, die ihn austrägt. Mögli- che Konflikte können entstehen zwischen Es und Realität, zwischen Es und Über-Ich bzw. Ich-Ideal oder zwischen verschiedenen Es-Impulsen (z.B. sexueller und aggressiver Trieb). Lösungen dieser Konflikte wären es, sich nur für eine der Konfliktkomponenten zu entschei- den, einen Kompromiss aus beiden zu bilden, oder aber die Impulse bzw. Triebe nacheinander zu erleben. Ist das Ich hierfür zu schwach, greift es zu den Abwehrmechanismen, wodurch eine Konfliktsituation nicht bewusst verarbeitet, sonder ins Unbewusste abgewehrt wird. Die- se Impulse versuchen sich jedoch weiterhin durchzusetzen. Kommt es erneut zu einer Ab- wehr, kann dies so aussehen, dass ein unterdrückter Onanie-Implus (Es - Impuls wurde wegen Über-Ich Angst verdrängt) in der Pubertät sich in einem Waschzwang der Genitalien äußert, der eine ständige Manipulation an diesen mit sich bringt. Werden die Impulse jedoch nicht mehr abgewehrt, kommt es zu Perversionen, die sich in einem anormalen Sexualleben äußern.
Konsequenzen für die Erziehung:
- Es ist zu bedenken, dass auch Erzieher unbewusste Seelenregungen haben, die auf ver- drängten Trieben des Es in einer der psychosexuellen Entwicklungsstufen beruhen. Diese können sich gegenüber dem Kind, unter dem Deckmantel einer pädagogisch sinnvollen Sanktion (z.B. extreme Formen der Kinderzüchtigung), wieder durchsetzen. Das Kind ist auf den Erzieher angewiesen und ihm gegenüber hilflos, so ist es dem Unbewussten des Erziehers leichter seine Triebe hier auszuspielen, als gegenüber der erwachsenen Gesell- schaft. (Rivalität zwischen Erzieherin und Mutter wird am Kind ausgelassen, Privatlehrer überträgt seinen Neid gegenüber dem Vater seines Schülers auf den Schüler, Analysant lebt Ödipuskomplex am Analytiker aus). Auch versuchen Eltern oft sich in ihren Kindern zu verwirklichen (narzißtischer Elternwunsch)
- Eingreifen in die Entwicklung eines Kindes soll der Erzieher immer erst am Ende einer psychsexuellen Phase, da sonst der Übergang zur nächsten nicht unbedingt gewährleistet ist. Es muss aber sichergestellt sein, dass das Kind eine gute, enge Bindung zum Erzieher hat, so dass Versagungen nicht zu Hassreaktionen des Kindes gegenüber dem Erz. führen.
Was ist ein Traum?
Subjektiv betrachtet ist das Wesen des Schlafes geheimnisvoll und Träume sind sogar ein noch größeres Geheimnis. Es gibt sie, wir alle kennen sie, aber kein Mensch kann den Traum eines anderen sehen. Es ist, als seien alle unsere Leitungen zu Wirklichkeit abgeschnitten; als betreten wir eine Welt, in der es weder Zeit noch Raum gibt: Wir können wieder jung sein, wir können in der Vergangenheit oder Zukunft leben oder irgendwo anders, wo keine von beiden regiert, wir können durch eine Tür in London schreiten und in Indien oder Australien wieder herauskommen oder auch an einem völlig unbekannten Ort.
Viele Träume führen uns in das Land der Märchen, wo sich ein Stein in einen Kuchen ver- wandelt, eine Mutter in eine böse Hexe und unser schlimmster Feind in unseren Retter. Die Verbindung zwischen Märchen und Träumen wurden von Forschern aufgespürt; beide gestat- ten Einblick in die Funktionsweise des Unbewussten mit seiner Sprache aus Symbolen und Verwandlungen, beide kennen keine Logik und beide haben eine geheimnisvolle „subjektive Wirklichkeit“.
Vor 30 Jahren bemerkte Dr. Nathaniel Kleitman aus Chicago, dass schlafende Menschen von Zeit zu Zeit ihre Augäpfel bewegten und die geschlossen Lider zu flattern begannen. Wenn man sie aus dieser Schlafperiode weckte, stellte sich jedesmal heraus, dass sie geträumt hatten. Es ist allgemein anerkannt, dass wir uns im Traum „umschauen“; oft bestätigten Schläfer, die aus Träumen geweckt wurden, dass sie, wenn ihre Augenbewegungen besonders erregt und heftig waren beim Pferderennen oder etwas ähnlichem zugesehen hätten.
Früher galt es als ausgemacht, dass ein Mensch, den man nicht träumen ließ, verrückt werden würde. William C. Dement, der sich in den fünfziger Jahren mit Traumentzug zu beschäftigen begann, war dieser Meinung. Seine Experimente zeigten, wie entschlossen der Mensch zu träumen ist. Dr. Dement weckte seine Versuchspersonen in dem Augenblick, da der Schlaf begann. Nach vierzehn Tagen brauchten die Personen ihre Träume so dringend - so sah es jedenfalls aus -, dass sie selbst wenn man sie auf Beine stellte und schüttelte, lauten Geräu- schen aussetzte oder gewaltsam wachhielt, innerhalb von Sekunden in den bewusstlosen Zu- stand zurückfielen, der sich am Ende nicht mehr unterbrechen ließ. Und wenn diese Personen dann normal schlafen durften, waren ihre Schlafperioden anfangs viel länger als gewöhnlich, als wollten sie die verlorene Traumzeit nachholen.
Was wir auch immer träumen, unsere Sinne halten eisern daran fest; bekanntlich ist es sehr schwer jemanden aus dem Schlaf aufzuwecken - in solchen Augenblicken sind wir wahr- scheinlich der Alltagswelt so fern wie nur möglich. Lautstärken von bis zu 80 Dezibel waren nötig, um jemanden aus dem Traumschlaf aufzuwecken. Andererseits schlüpfen manchmal leise Geräusche durch und dringen in unsere Träume vor - zum Beispiel Namen. Offenbar befördert unser Körper immer noch genaue Botschaften von unseren Sinnen zu un- serem Gehirn, obwohl sie manchmal verzerrt ankommen: Mache den Fuß eines Schläfers nass, und er tritt im Traum in eine Pfütze, klopfe ihm auf den Kopf und träumt, er werde über- fallen. Vielleicht noch interessanter ist, dass wir im Traum anscheinend ganz deutlich hören, obwohl der Verstand auch hier Fehler machen oder Schabernack mit den Geräuschen treiben kann.
Alle Menschen träumen. Ein normaler Nachtschlaf enthält stets nicht nur eine sondern mehrere Traumperioden. Das haben Experimente zweifelsfrei bewiesen. Einige Menschen vergessen jeden Traum und behaupten, sie träumen nie. Andere behalten ihre Träume fast ganz, doch die meisten erinnern sich an ein paar Bruchstücke und Träumen nur hin und wieder einen Traum, der in allen Einzelheiten haften bleibt und ihnen aus irgend einem Grund besonders eindrucksvoll, besonders wichtig erscheint.
Der Glaube an das Gewicht der Träume hat die Zeiten, da man sie für Botschaften der Götter hielt weit überlebt. Das Werk Freuds hat die Traumdeutung zu einem wichtigen Bestandteil der Psychotherapie erhoben und unsere Einsicht in das Unbewusste vertieft. Seit etwa 35 Jah- ren wird eifrig in Traumlaboratorien experimentiert. Es wird wissenschaftlich untersucht, ob die schlafenden Versuchspersonen träumen, und wenn, wie häufig und was. Dauer und Art der Träume werden mit physischen und physiologischen Vorgängen, die beim Schlafen und Träumen auftreten verglichen. Die Versuche auf diesem Gebiet weisen neue Wege der Traumdeutung.
Träume nach Freud:
Träume spielen folglich in der Psychoanalyse eine große Rolle, darum möchte ich auf das bereits angesprochene Werke „Die Traumdeutung“ von Sigmund Freud näher eingehen. Dar- in behauptet er, Träume seien keinesfalls zufällige, vielleicht sogar durch äußere Reize ausge- löste Irrungen, sondern im Gegenteil äußerst wichtige Offenbarungen unseres Innenlebens - verschleierte Erfüllungen der manchmal geheimsten Wünsche, die er sich im wachen Zustand oftmals nicht eingestand. Gewiss gab es da eine Art Gerüst aus wirren und möglicherweise sinnlosen Bildern (die er den manifesten Inhalt des Traumes nannte), aber dieses Gerüst stütz- te „Traumgedanken“ - den latenten Inhalt - , die völlig logisch waren und bei einer Psycho- analyse interpretiert werden konnten. Freud zufolge vereinigten Träume zwei Funktionen: Sie erlaubten, dass verlorene Wünsche in verschleierter Form ausgedrückt wurden, und indem sie wahre Natur dieser Wünsche eingestanden, ließen sie den Schläfer oder Träumer ungestört weiterschlafen. Der Traum, sagte Freud, ist der Wächter der Schlafes.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Sigmund Freud?
Sigmund Freud war der Begründer der Psychoanalyse und wird oft als ihr "Vater" bezeichnet. Er wurde am 6. Mai 1856 in Freiburg in Mähren geboren und starb 1939 in London. Seine Theorien über Triebe, Libido und das Es sind auch heute noch relevant.
Was sind die wichtigsten Stationen in Freuds Leben?
Freud zog 1860 mit seiner Familie nach Wien. Er studierte Medizin, forschte über das Nervensystem und entdeckte die schmerzbefreiende Wirkung von Kokain. 1885 ging er nach Paris, um bei Jean-Martin Charcot über Hysterie und Hypnose zu lernen. Später ließ er sich als Nervenarzt in Wien nieder und entwickelte die Psychoanalyse.
Was ist Psychoanalyse?
Die Psychoanalyse ist eine wissenschaftliche Disziplin, die von Sigmund Freud begründet wurde. Sie befasst sich mit der Funktionsweise und Entwicklung der menschlichen Psyche, sowohl im normalen als auch im pathologischen Bereich.
Welche grundlegenden Hypothesen liegen der Psychoanalyse zugrunde?
Zwei fundamentale Hypothesen sind das Prinzip der psychischen Determiniertheit (Kausalität) und die Annahme, dass Bewusstheit eher eine Ausnahme als die Regel bei psychischen Prozessen ist. Das bedeutet, dass unbewusste psychische Vorgänge eine große Bedeutung haben.
Was bedeutet psychische Determiniertheit?
Das Prinzip der psychischen Determiniertheit besagt, dass nichts in der Psyche zufällig geschieht, sondern jedes psychische Ereignis durch die Vergangenheit determiniert ist. Auch wenn Ereignisse zufällig erscheinen, gibt es einen kausalen Zusammenhang.
Was untersucht die Psychoanalyse im Bezug auf das Vergessen oder Verlegen?
Die Psychoanalyse geht davon aus, dass das Vergessen oder Verlegen von Dingen nicht zufällig ist, sondern durch einen Wunsch oder eine Absicht der betreffenden Person verursacht wird.
Welche Aspekte werden in der Psychoanalyse unterschieden?
Die Psychoanalyse unterscheidet den topographischen Aspekt (Bewusst, Vorbewusst, Unbewusst), den dynamischen Aspekt (Freudsche Triebtheorie: Eros und Thanatos), den strukturellen Aspekt (Es, Ich, Über-Ich) und den genetischen Aspekt (psychosexuelle Entwicklungstheorie).
Was beinhaltet die Freudsche Triebtheorie (dynamischer Aspekt)?
Die Freudsche Triebtheorie unterscheidet zwischen zwei grundlegenden Trieben: Eros (Lebenstrieb, Sexualtrieb) und Thanatos (Todestrieb, Destruktionstrieb). Das Mischverhältnis dieser Triebe ist bedeutsam für die Persönlichkeitsentwicklung.
Was sind die Instanzen des psychischen Apparats (struktureller Aspekt)?
Der psychische Apparat besteht aus drei Instanzen: dem Es (Triebe, Wünsche), dem Ich (Vermittler zwischen Es und Realität) und dem Über-Ich (moralische Instanz, Gewissen).
Was ist die psychosexuelle Entwicklungstheorie Freuds (genetischer Aspekt)?
Die psychosexuelle Entwicklungstheorie Freuds beschreibt verschiedene Phasen der Entwicklung: die orale, anale, phallische, Latenz- und genitale Phase. In jeder Phase steht eine bestimmte Körperzone und Triebbefriedigung im Vordergrund.
Was sind Abwehrmechanismen?
Abwehrmechanismen sind unbewusste Strategien des Ich, um Konflikte zwischen Es, Über-Ich und Realität zu bewältigen und Angst zu reduzieren. Beispiele sind Verdrängung, Verschiebung, Sublimierung, Verleugnung, Projektion und Rationalisierung.
Wie entstehen Neurosen und Perversionen?
Neurosen entstehen, wenn das Ich zu schwach ist, um Konflikte zu bewältigen, und auf Abwehrmechanismen zurückgreift. Perversionen entstehen, wenn Impulse nicht mehr abgewehrt werden und sich in einem anormalen Sexualleben äußern.
Welche Konsequenzen hat die Psychoanalyse für die Erziehung?
Erzieher sollten sich ihrer eigenen unbewussten Regungen bewusst sein und diese nicht auf das Kind übertragen. Sie sollten erst am Ende einer psychosexuellen Phase in die Entwicklung des Kindes eingreifen und sicherstellen, dass das Kind eine gute Bindung zum Erzieher hat.
Welche Bedeutung haben Träume in der Psychoanalyse?
Träume sind in der Psychoanalyse von großer Bedeutung, da sie als verschleierte Erfüllungen von Wünschen gelten, die im wachen Zustand oft nicht eingestanden werden. Freud unterscheidet zwischen dem manifesten Inhalt (dem erinnerten Traum) und dem latenten Inhalt (den unbewussten Traumgedanken).
Was ist der manifeste und latente Inhalt von Träumen?
Der manifeste Inhalt ist der erinnerten Traum, das Gerüst aus wirren Bildern. Der latente Inhalt sind die unbewussten Traumgedanken, die völlig logisch sind und interpretiert werden können.
- Quote paper
- T. Meier (Author), 2000, Der Prozeß des Erwachsenwerdens aus psychoanalytischer Perspektive. Zwischen Trieben und Sublimation., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96080